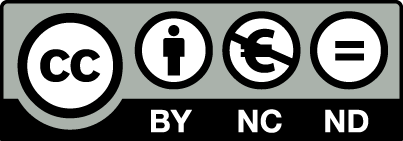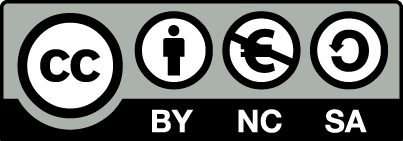Friedrich der Große
- Dates of Life
- 1712 – 1786
- Place of birth
- Berlin
- Place of death
- Sanssouci bei Potsdam
- Occupation
- König von Preußen/seit 1772 ; König in Preußen/bis 1772 ; Komponist ; Philosoph ; Schriftsteller
- Religious Denomination
- reformiert
- Authority Data
- GND: 118535749 | OGND | VIAF: 12303200
- Alternate Names
-
- Friedrich II. der Große
- Friedrich II.
- Friedrich II. von Preußen
- Friedrich der Große
- Friedrich II. der Große
- Friedrich II.
- Friedrich II. von Preußen
- Alter Fritz
- Bedřich II., Veliký
- Charles Frédéric II., Prusse, Roi
- Der alte Fritz
- Dom Calmet
- F. R.
- F.R.
- FR
- Federic
- Federic II., Prusse, Roi
- Federico Augusto II., Prussia, Rey
- Federico II., Prussia, Re
- Federico, il Grande
- Federigo II., Prussia, Re
- Frederic
- Frederic II., Prússia, Rei
- Frederick II, King of Prussia
- Frederick II., Prussia, King
- Frederick II., the Great
- Frederick the Great, König von Preussen
- Frederick, the Great
- Frederico II., Prússia, Rei
- Frederik II., Preußen, Konge
- Fredric II., Preussen, Konung
- Fréderic II, Roi de Prusse
- Frédéric
- Frédéric II, König von Preussen
- Frédéric II, Roi de Prusse
- Frédéric II.
- Frédéric II., Preußen, König
- Frédéric II., Prusse, Roi
- Frédéric II., le Grand
- Frédéric le Grand, König von Preussen
- Frédéric, Prusse, Roi, II.
- Frédéric, le Grand
- Frédéric, philosophe de Sans-Souci
- Friderich
- Friderich II., Preußen, König
- Friderich, Preußen, König
- Friderich, der Große
- Fridericus
- Fridericus II., Borussia, Rex
- Fridericus II., Preußen, König
- Fridericus II., Prussia, Rex
- Fridericus Secundus
- Fridericus, Magnus
- Fridericus, Porussia, Rex
- Fridericus, Rex
- Friederich
- Friederich II., Preußen, König
- Friederich, Preußen, Cron-Prinz
- Friederich, Preußen, König
- Friederich, der Einzige
- Friederich, der Große
- Friedericus II., Borussia, Rex
- Friedericus II., Preußen, König
- Friedrich
- Friedrich 2, Preussen ; König
- Friedrich II, King of Prussia
- Friedrich II, König von Preussen
- Friedrich II, Preussen, König
- Friedrich II, Roi de Prusse
- Friedrich II., Preußen, König
- Friedrich II., der Große
- Friedrich II., von Preußen
- Friedrich der Grosse, König von Preussen
- Friedrich, Preußen, König, II.
- Friedrich, der Einzige
- Friedrich, der Grosse
- Friedrich, der Große
- Friedrich, der andere
- Friedrich, von Hohenzollern
- Fryderyk II., Prusy, Król
- Fryderyk II., Wielki
- Graf Dufour
- Guillaume, Frederic
- Main de Maître
- Volkna, Johann
- Alther Fritz
- Dom Kalmet
- Frederick II, Cing of Prussia
- Frederick II., Prussia, Cing
- Frederick the Great, Cönig von Preussen
- Frederik II., Preußen, Conge
- Fredric II., Preussen, Conung
- Frédéric II, Cönig von Preussen
- Frédéric II., Preußen, Cönig
- Frédéric le Grand, Cönig von Preussen
- Friderich II., Preußen, Cönig
- Friderich, Preußen, Cönig
- Fridericus II., Preußen, Cönig
- Friederich II., Preußen, Cönig
- Friederich, Preußen, Cönig
- Friedericus II., Preußen, Cönig
- Friedrich 2, Preussen ; Cönig
- Friedrich II, Cing of Prussia
- Friedrich II, Cönig von Preussen
- Friedrich II, Preussen, Cönig
- Friedrich II., Preußen, Cönig
- Friedrich der Grosse, Cönig von Preussen
- Friedrich, Preußen, Cönig, II.
Linked Services
- Bach - digital [2017-]
- * Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik online [2006-2007]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- * Bayerisches Musikerlexikon Online (BMLO) [2005-]
- * Westfälische Geschichte [1996-]
- Bio-bibliographisches Register zum Archiv der Franckeschen Stiftungen [1995-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1961] Autor/in: Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu (1961)
- I. Singer (Hg.): Jewish Encyclopedia. 1901-1906 [1901-1906]
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Ranke, Leopold von (1878)
- Eugenio Pacelli - Nuntiaturberichte von 1917-1929
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Manuscripta Mediaevalia
- * Germania Sacra Personendatenbank [2008-]
- * Personen im Personenverzeichnis der Fraktionsprotokolle KGParl [1949-]
- Bach - digital [2017-]
- Members of the Russian Academy of Sciences since 1724 [2017]
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Personendaten-Repositorium der BBAW [2007-2014]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Eugenio Pacelli - Nuntiaturberichte von 1917-1929
- * Gesamtkatalog deutschsprachiger Leichenpredigten (GESA)
- Behring-Nachlass digital
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- Aloys Hirt – Briefwechsel 1787-1837
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Adlige und bäuerliche Lebenswelten in den Akten ostpreußischer Gutsarchive
- * Die wissenschaftliche Korrespondenz des Historikers Karl Hegel
- Kritische Online-Edition der Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers (1911–1952)
- Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800
- Personen in den Nachschriften zu Alexander von Humboldts »Kosmos-Vorträgen«
- Personen in den Schatullrechnungen Friedrichs des Großen
- EGO European History Online
- Forschungsplattform zu den "Großen Deutschen Kunstausstellungen" 1937-1944
- Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte)
- August Wilhelm Ifflands dramaturgisches und administratives Archiv
- Personen in der Briefdatenbank Francesco Algarotti (1712-1764)
- Diplomatische Dokumente der Schweiz 1848-1975 (via metagrid.ch) [2019]
- * Filmothek des Bundesarchivs [2015-]
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Nachlass Sommerfeld beim Deutschen Museum
- * Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Manuscripta Mediaevalia
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- Personen in der Judaica-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt/Main
- Personen im Francke-Portal
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Biodiversity Heritage Library (BHL)
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
- Personen im Auftrittsarchiv der Wiener Philharmoniker
- * Bildarchiv des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung
- Archivportal-D
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Forschungsplattform zu den "Großen Deutschen Kunstausstellungen" 1937-1944
- Objektdatenbank der Museumslandschaft Hessen Kassel
- Interaktiver Katalog des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- * Bildindex der Kunst und Architektur - GND-referenzierte Personen [2018]
- * Graphikportal - Akteure (Künstler, Verleger, Auftraggeber etc.) [2018]
- * Bildarchiv des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung
- * Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014]
- * Westfälische Geschichte [1996-]
- Virtuelles Kupferstichkabinett
- Trierer Porträtdatenbank
- Digiporta - Digitales Porträtarchiv
- * Porträtnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Digitaler Portraitindex
Relations
Genealogical Section (NDB)
Life description (NDB)
- August Wilhelm
- Bach
- Bismarck
- C. H. Graun
- C. von Carmer
- Ch. Wolff
- Elisabeth Christine
- F. A. von Finck
- Ferdinands von Braunschweig
- Franz I.
- Frau von Wreech
- Fredersdorff
- Friedrich Wilhelm I.
- G. Svarez
- G. W. von Knobelsdorff
- General von Grumbkow
- Georg II.
- Goethes
- H. de Catt
- Herder
- Hobbes
- J. A. Hasse
- J. Keith
- J. Quantz
- Josef II.
- Justus Möser
- Kaiserin Elisabeth
- Kaiserin Friedrich
- Karl Albrecht
- Karl VI.
- Karl von Lothringen
- Katharina II.
- Kaunitz
- Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt
- Leibniz
- Lessing
- Ludwigs XIV.
- Machiavelli
- Maria Antonia von Sachsen
- Maria Theresias
- Maupertuis
- Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode
- Peter III.
- Peter dem Großen
- Philipp Emanuel
- Prinzen Eugen
- Rousseau
- S. von Cocceji
- Shakespeares
- Voltaire
- Winckelmann
- von Katte
- von Natzmer
- von Podewils
- von Schwerin
Life description (ADB)
- ADB 45 (1900), S. 274 (Zimmermann, Johann Georg)
- ADB 45 (1900), S. (Zimmermann, Johann Georg)
- NDB 1 (1953), S. 79*
- NDB 1 (1953), S. 301* (Anna Amalia)
- NDB 1 (1953), S. 302*
- NDB 1 (1953), S. 447* (August Wilhelm)
- NDB 2 (1955), S. 131 (Bernoulli, Johann)
- NDB 2 (1955), S. 270 (Bismarck, Otto Eduard Leopold von, Graf von Bismarck-Schönhausen, Fürst)
- NDB 2 (1955), S. (Brühl, Heinrich, Reichsgraf)
- NDB 2 (1955), S. 727 (Bülow, von)
- NDB 3 (1957), S. 529 (Daun, Leopold Joseph Maria, Graf von, Fürst von Thiano)
- NDB 3 (1957), S. 577 (Delbrück, Hans Gottlieb Leopold)
- NDB 4 (1959), S. 148 (Du Bois-Reymond, Emil Heinrich)
- NDB 4 (1959), S. 456 (Eller, Elias)
- NDB 4 (1959), S. 688 (Euler, Leonhard)
- NDB 4 (1959), S. 689 (Euler, Leonhard)
- NDB 5 (1961), S. 87*
- NDB 5 (1961), S. 540*
- NDB 5 (1961), S. 558*
- NDB 5 (1961), S. 595*
- NDB 5 (1961), S. 190 (Fischer, Johann Christian)
- NDB 5 (1961), S. 538 (Friedrich I.Friedrich III.)
- NDB 5 (1961), S. 558 (Friedrich Wilhelm II.)
- NDB 5 (1961), S. (Friedrich Wilhelm II.)
- NDB 6 (1964), S. 212* (Georg II.)
- NDB 6 (1964), S. 538 (Görtz, Johann Eustach Graf von)
- NDB 6 (1964), S. 643 (Gontard, Carl Philipp Christian von)
- NDB 7 (1966), S. 87 (Grimm, Friedrich Melchior Freiherr von)
- NDB 7 (1966), S. 428 (Haedenkamp, Karl Christian Friedrich Hermann)
- NDB 7 (1966), S. 543 (Haller, Albrecht von)
- NDB 8 (1969), S. 383*
- NDB 8 (1969), S. 64 (Hatzfeldt, Karl Friedrich Anton Graf von)
- NDB 8 (1969), S. (Haude, Ambrosius)
- NDB 8 (1969), S. 716 (Hertzberg, Ewald Friedrich Graf von)
- NDB 9 (1972), S. 498 Familienartikel Hohenzollern (Hohenzollern)
- NDB 10 (1974), S. 222 (Jacobi, Friedrich Heinrich Ritter von)
- NDB 10 (1974), S. 415 (Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm)
- NDB 10 (1974), S. 618 (Joseph II.)
- NDB 10 (1974), S. 621 (Joseph II.)
- NDB 11 (1977), S. 223* (Karl I.)
- NDB 11 (1977), S. 224*
- NDB 11 (1977), S. 267* (Karl Eugen)
- NDB 11 (1977), S. 56 (Kalide, Theodor)
- NDB 11 (1977), S. (Karl VII.)
- NDB 11 (1977), S. (Karl VII.)
- NDB 11 (1977), S. 252 (Karl Philipp)
- NDB 11 (1977), S. 262 (Karl August)
- NDB 11 (1977), S. (Karl Eugen)
- NDB 11 (1977), S. 484 (Kempelen de Pázmánd, Wolfgang Ritter von)
- NDB 11 (1977), S. 605 (Kilian, Philipp Andreas)
- NDB 12 (1980), S. 206 (Knötel, Richard)
- NDB 12 (1980), S. 614 (Koser, Reinhold)
- NDB 12 (1980), S. 742 (Kreittmayr, Wiguläus Xaverius Aloysius Freiherr von)
- NDB 13 (1982), S. 437 (Lambert, Johann Heinrich)
- NDB 13 (1982), S. 549 (Lange, Joachim)
- NDB 14 (1985), S. 267 (Leopold I.)
- NDB 14 (1985), S. 531 (Lienhard, Friedrich)
- NDB 14 (1985), S. 548 (Ligne, Karl Joseph Fürst de)
- NDB 15 (1987), S. 257* (Louis Ferdinand)
- NDB 15 (1987), S. 500* (Luise, Königin von Preußen, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz)
- NDB 16 (1990), S. 196* (Maria Feodorowna, Kaiserin von Rußland, geborene Prinzessin Sophie von Württemberg)
- NDB 16 (1990), S. 40 (Mann, Heinrich)
- NDB 16 (1990), S. 44 (Mann, Thomas)
- NDB 16 (1990), S. 177 (Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich)
- NDB 16 (1990), S. 178 (Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich)
- NDB 16 (1990), S. (Maria Antonia Walburga, Kurfürstin von Sachsen, geborene Prinzessin von Bayern)
- NDB 16 (1990), S. 329 (Marx, Karl)
- NDB 16 (1990), S. 431 (Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de)
- NDB 16 (1990), S. 432 (Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de)
- NDB 16 (1990), S. (Maximilian III. Joseph)
- NDB 17 (1994), S. 103 (Menzel, Adolph von)
- NDB 18 (1997), S. (Molo, Walter Ritter von)
- NDB 18 (1997), S. 178 (Moser von Filseck, Friedrich Carl Freiherr von)
- NDB 18 (1997), S. 270 (Mühlbach, Luise)
- NDB 18 (1997), S. 524 (Münchhausen, Gerlach Adolf Freiherr von)
- NDB 20 (2001), S. 326 (Pfeil, Christoph Carl Ludwig Freiherr von)
- NDB 25 (2013), S. 362 in Artikel Stobwasser, Johann Heinrich
- NDB 25 (2013), S. 453 in Artikel Stosch, Philipp Freiherr von
- NDB 25 (2013), S. 569 in Artikel Stroell, Johann Baptist
- NDB 25 (2013), S. 686 in Artikel Süßmilch, Johann Peter
- NDB 25 (2013), S. 702 in Artikel Sulzer, Johann Georg
- NDB 25 (2013), S. 721 in Artikel Svarez, Carl Gottlieb
- NDB 25 (2013), S. 731 in Artikel Swieten, Gottfried Freiherr von (Swieten, Gottfried Bernhard Freiherr von)
- NDB 26 (2016), S. 424 in Artikel Trippel, Alexander
- NDB 27 (2020), S. 129 in Artikel Voss, Christian Friedrich (Voss, Christian Friedrich)
- NDB 27 (2020), S. (Wegely, Wilhelm Caspar )
Places
Map Icons
 Place of birth
Place of birth
 Place of activity
Place of activity
 Place of death
Place of death
 Place of interment
Place of interment
Localized places could be overlay each other depending on the zoo m level. In this case the shadow of the symbol is darker and the individual place symbols will fold up by clicking upon. A click on an individual place symbol opens a popup providing a link to search for other references to this place in the database.
-
Friedrich II. der Große
König in, seit 1772 von Preußen, * 24.1.1712 Berlin, † 17.8.1786 Sanssouci bei Potsdam, ⚰ Potsdam, Garnison-Kirche, jetzt Burg Hohenzollern.
-
Genealogy
V Kg. Frdr. Wilh. I. in P. († 1740, s. NDB V);
M Sophie Dor. († 1757), T d. Georg I. († 1727), Kf. v. Hannover, Kg. v. Großbritannien;
Om Georg II. († 1760), Kf. v. Hannover, Kg. v. Großbritannien;
6 B (3 jung †), 7 Schw (1 jung †) Aug. Wilh. (1722–58), preuß. Gen. (s. NDB I), →Heinrich († 1802), preuß. Gen., →Ferdinand (1730–1813), preuß. Gen. d. Inf., Herrenmeister d. Johanniter-Ordens (s. ADB VI; Priesdorff I, S. 405-07, P), Mgfn. →Wilhelmine v. Brandenburg-Bayreuth († 1758), Frieder. Luise (1714–84, ⚭ 1729 Mgf. Karl v. Brandenburg-Ansbach, 1712–57, s. ADB XV), Philippine Charl. (1716–1801, ⚭ 1733 Hzg. Karl I. v. Braunschweig-Lüneburg, 1713–80, s. ADB XV), Sophie (1719–65, ⚭ 1734 Mgf. Frdr. Wilh. v. Brandenburg-Schwedt, 1700–71, preuß. Gen., „d. tolle Mgf.“, s. Priesdorff I, S. 147 f., P), →Ulrike (1720–82, ⚭ 1744 Kg. →Adolf Frdr. v. Schweden, 1710–71), →Amalie (1723–87), Äbtissin v. Quedlinburg;
⚭ Salzdahlum 1733 Elisabeth Christine (1715–97), T d. Hzg. Ferd. Albrecht II. v. Braunschweig-Lüneburg-Bevern (1680–1735); kinderlos;
N (S d. Aug. Wilh.) Kg. Frdr. Wilh. II. v. P. († 1797, s. NDB V), Hzgn. →Anna Amalia v. Sachsen-Weimar u. Eisenach († 1807, s. NDB I). -
Biography
F.s Jugend war vom Gegensatz zum Vater überschattet. →Friedrich Wilhelm I., der im Grunde seine Familie liebte, ging mit der äußersten Strenge gegen seinen ältesten Sohn vor, als er zu sehen glaubte, daß sich dieser seinen künftigen Pflichten entzog. Nach dem eigenen Vorbild wollte er den Thronfolger zu einem guten Soldaten und Christen erziehen. F. setzte den Bemühungen, der freien Entwicklung seiner Individualität Fesseln anzulegen, Widerstand entgegen. Er hatte kaum Veranlassung, im Vater schon den bedeutenden Verwalter des Staates zu bewundern. Die Familie hatte unter dessen unberechenbaren Launen zu leiden. Am verhängnisvollsten war es wohl, daß er den Vater, dessen Lebensart er ablehnte, nicht einmal genügend achtete und daß dieser das fühlte. →Friedrich Wilhelm hat sich daher nicht selten von seinem Jähzorn hinreißen lassen; es haben sich unwürdige Szenen abgespielt, die das Ehrgefühl des sensiblen Knaben tief verletzten. Die Mutter war zur Vermittlung ungeeignet. Ähnlich wie später die →Kaiserin Friedrich empfand die stolze Welfin den preußischen Hof als untergeordnet. Sie verfolgte ehrgeizige Pläne für ihre Kinder; mit allen Mitteln betrieb sie die Doppelheirat ihrer ältesten Kinder mit Mitgliedern des englischen Königshauses. Die offiziellen und geheimen Verhandlungen führten zu keinem Ergebnis. F., der 1728 ein weit reicheres Hofleben in Dresden kennengelernt hatte, entschloß sich zur Flucht nach England, um sich dem von ihm als unerträglich empfundenen Druck durch den Vater zu entziehen. Der Plan war durchaus unüberlegt und unreif; er scheiterte im August 1730 während einer Reise an den Oberrhein schon an der Wachsamkeit der kronprinzlichen Begleitung. Die Beichte eines Pagen enthüllte dem König alles. Als sich Vater und Sohn zum erstenmal wieder in Wesel gegenüberstanden, scheint F.s Leben einen Augenblick bedroht gewesen zu sein. Der Kommandant von Wesel, General von der Mosel, mußte sich schützend vor den Kronprinzen stellen. F. wurde auf der Festung Küstrin unter strengste Bewachung gestellt. →Friedrich Wilhelm nahm als König und als Vater den Fluchtversuch außerordentlich schwer. Er sah darin nicht nur die Desertion eines Offiziers, sondern Hoch- und Landesverrat, nicht ohne Grund, da sich unabsehbare Konsequenzen für das schon an und für sich gespannte Verhältnis Preußens zu England-Hannover hätten ergeben können. Als Vater fühlte er sich vor ganz Europa bloßgestellt. Er wollte nicht den Tod des Kronprinzen, wie es die Legende behauptet, sondern dessen Thronverzicht, da er ihn des Königsamtes nicht mehr für würdig hielt. F. war aber nicht der „effeminierte Kerl“, für den ihn sein Vater gehalten hatte. Von der Außenwelt abgeschnitten, bewies er in langen zermürbenden Verhören eine erstaunliche Geistesgegenwart. Er nahm die Verantwortung für den Fluchtversuch auf sich; auf alle Fragen jedoch, ob er sich noch für würdig halte, König zu werden, antwortete er ausweichend: er übergebe sich der Gnade des Königs. F. mußte die Hinrichtung seines Freundes, des Leutnant →von Katte, der in den Fluchtplan eingeweiht war, vom Gefängnis aus mitansehen. Vergeblich bot er sein eigenes Leben an; vor dem Anblick des zum Tode Geführten brach er ohnmächtig zusammen (6.11.). Als ihn der Feldprediger Johann Ernst Müller in der Zelle aufsuchte, glaubte der Kronprinz sogar, daß er auf den eigenen Tod vorbereitet werden sollte. Doch hatte dieser nur den Auftrag, F. seinen Glauben an Vorausbestimmung auszureden.
Die Katastrophe bedeutete einen Wendepunkt in F.s Leben. Fortan wird er auf offenen Widerstand gegen den König verzichten, allerdings auch darauf bedacht sein, sich soweit wie möglich von ihm fernzuhalten. Verstellung, Berechnung und Taktik bestimmen künftig das Verhältnis vom Sohn zum Vater, wenn es auch an gelegentlichen sentimentalen Regungen nicht fehlt. Es ist oft behauptet worden, F. sei erst durch die bitteren Erfahrungen seiner Jugend zur notwendigen Härte erzogen worden, er habe auch viel für seine spätere Politik lernen können. Mit größerem Recht kann man sagen, daß die ständige Notwendigkeit, das Recht der eigenen Persönlichkeit gegen einen mächtigen Willen zu behaupten, zu einer Verkümmerung seelischer Kräfte führen und die bei F. schon angeborene Neigung zum Zynismus verstärken mußte. Seit Dezember 1730 durfte F. als jüngster Kriegsrat bei der Kriegs- und Domänenkammer in Küstrin arbeiten. 1731 kam es zu weiteren Erleichterungen, im November anläßlich der Hochzeit der Schwester →Wilhelmine zu einer äußerlichen Aussöhnung. Die praktische Tätigkeit, vor allem der Anschauungsunterricht auf gemeinsam mit dem König unternommenen Besichtigungsreisen, haben dann F. deutlich die großartige organisatorische Tätigkeit des Königs vor Augen geführt, Verdienste, die er später uneingeschränkt anerkannt hat und die ihm selbst zum Vorbild dienten. In diese Zeit fällt auch die harmlose Schwärmerei für die Schloßherrin von Tamsel, →Frau von Wreech. 1732 durfte F. als Chef das Infanterieregiment in Ruppin übernehmen; er hat seine militärischen Pflichten zur vollen Zufriedenheit des Königs erfüllt. Aber im gleichen Jahre lehnte sich sein Unabhängigkeitsgefühl in leidenschaftlichen Briefen an den →General von Grumbkow auf, als ihm der Vater eine Gemahlin bestimmte, für die vor allem die Verwandtschaft mit dem österreichischen Kaiserhaus sprach. Offenen Widerstand wagte F. jedoch nicht mehr. Die Ehe gab ihm eine gewisse Unabhängigkeit, er konnte in Ruppin einen eigenen Haushalt begründen, Freunde um sich sammeln und seinen musikalischen Neigungen nachgehen. 1734 nahm er in der Umgebung des →Prinzen Eugen am Polnischen Thronfolgekrieg teil, vermochte aber von dem alternden Feldherrn nicht mehr viel zu lernen. Im Herbst erkrankte der König so schwer, daß F. mit Bestimmtheit auf die Regierungsübernahme rechnete; er gab seiner Enttäuschung einen recht drastischen Ausdruck, als der Vater wider Erwarten im Frühjahr 1735 gesundete. Der Zeitgewinn war jedoch für seine innere Entwicklung sehr wichtig. Im Herbst 1736 siedelte F. nach Rheinsberg über; er ließ das Schloß nach eigenem Geschmack durch seinen Freund →G. W. von Knobelsdorff ausbauen und einrichten. Rheinsberg war wohl die glücklichste und menschlich entspannteste Periode seines Lebens. In einem Kreise von gleichgesinnten Freunden und von jungen Frauen wurde viel musiziert und Theater gespielt. Auch in seiner Ehe fühlte sich F. noch leidlich zufrieden. →Elisabeth Christine fehlte es nicht an Gemüt und Klugheit, ihr Geist besaß aber nicht genügend Tiefe und Anmut, um den Gatten dauernd zu fesseln. Nach den schlesischen Kriegen vollzog F. die Trennung, legte jedoch Wert darauf, daß sie als Königin respektiert wurde. →Elisabeth hat unter dem Bruch sehr gelitten, ihre Liebe blieb bis an ihr Lebensende unerschüttert. Sie war als Übersetzerin tätig und schrieb|ein kleines Buch „Gedanken und Betrachtungen zum Neuen Jahr“ (1777). Von einer grundsätzlichen Frauenfeindlichkeit darf man bei F. nicht sprechen. Im Briefwechsel mit geistig hochstehenden Frauen, wie mit der Kurfürstin →Maria Antonia von Sachsen oder der →Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt, zeigte F. sich durchaus fähig, die galante und graziöse Sprache des Rokoko zu führen.
Während der Rheinsberger Zeit hat sich F. mit einer beispiellosen Intensität darum bemüht, ein umfassendes Wissen zu erwerben. Es fehlten ihm manche Grundlagen für das Selbststudium. F. beherrschte keine Sprache außer der französischen, selbst in dieser war seine Orthographie mehr als dürftig. Er sprach nach seinem eigenen Ausdruck Deutsch wie ein Kutscher, er verstand kein Latein, so daß er die Klassiker des Altertums häufig nur in schlechten Übersetzungen lesen konnte. Da ihm planmäßige Anleitung in seiner Jugend gefehlt hatte, war seine Lektüre, die sich vornehmlich auf philosophische, literarische und historische Werke bezog, etwas wahllos. Das Autodidaktische blieb immer spürbar. Aber F. studierte doch gründlich, „lesen heißt denken“ wird er später einmal sagen. F. hat sich gerne als Philosophen von Sanssouci bezeichnet. Er war jedoch kein origineller Denker. Er wurde zum überzeugten Anhänger der Aufklärungsphilosophie. Das Gedankengut übernahm er von anderen, vor allem von →Voltaire. Er hat sich nie einem bestimmten System verschrieben, es ist charakteristisch für ihn, daß er dasjenige in sich verarbeitete, was seiner eigenen Veranlagung und Denkrichtung entsprach. Schon als Kronprinz, vollends aber als König ist er sich stets bewußt gewesen, daß ihm vom Schicksal eine bestimmte Aufgabe zugewiesen sei und daß er sich über deren Sinn und Zweck Klarheit verschaffen müsse. Er fühlte sich zunächst stark von →Ch. Wolff angezogen, der das System von →Leibniz weiter entwickelt hatte, vor allem die Lehre vom einfachen Wesen, das heißt von der unzerstörbaren Substanz, so daß ihm damals der Glaube an eine unsterbliche Seele gerechtfertigt zu sein schien. Sehr bald geriet er jedoch unter den Einfluß von →Voltaire; fortan wird er dem englisch-französischen Skeptizismus, im besonderen Locke zuneigen. Die Verbindung mit →Voltaire ist für F. von größter Bedeutung geworden. Er entschied sich damit für die Welt des französischen Geistes, ohne daß diese Orientierung jemals einen Einfluß auf die Unabhängigkeit seiner Politik ausgeübt hätte. F. sah den Höhepunkt der europäischen Zivilisation im Zeitalter →Ludwigs XIV. Er empfand diese Epoche als die vollkommene Einheit von Macht des Staates, Glanz und Würde des Königtums und einer auf der strengen Form des Cartesianismus beruhenden Gesellschaftskultur. →Voltaire war für F. die schönste Blüte dieser Kultur, der letzte Vertreter einer großen Tradition. Er bewunderte in Voltaire nicht nur den Philosophen, sondern den universal gerichteten Menschen, der auch gleichermaßen in der Literatur, in der Geschichte wie in den Naturwissenschaften zu Hause war. Er achtete in ihm aber auch den Weltmann, der in politischen Geschäften zu gebrauchen war, den mutigen Kämpfer gegen religiösen Fanatismus und Aberglauben, den praktischen Landwirt. Bei dem merkwürdigen Verhältnis zwischen F. und →Voltaire darf eine Art von geistiger Verwandtschaft nicht übersehen werden; sie waren trotz der Verschiedenheit der Charaktere gewissermaßen aufeinander angewiesen, aristokratische Naturen, zur Spottsucht neigend, Verächter der Masse, so daß auch der schroffe Bruch der fünfziger Jahre den Meinungsaustausch nicht beendete.
Wie →Voltaire wurde F. Deist. An dem Dasein eines Gottes hat er nie gezweifelt und damit eine gesetzmäßige Weltordnung anerkannt. Nur über das Wesen dieser Gottheit vermochte er keine Klarheit zu gewinnen, vor allem nicht über ihr Verhältnis zu den Menschen. Letzten Endes neigte aber F. zu der Annahme, daß dieser Gott sich gegenüber den menschlichen Angelegenheiten vollkommen gleichgültig verhalte. F. hat im Unterschied zu →Voltaire die Willensfreiheit zunächst schroff abgelehnt, schon aus physiologischen Gründen. Später neigte er dazu, wenigstens die Entscheidungsfreiheit zwischen Vernunft und Leidenschaften für möglich zu halten, er blieb jedoch davon überzeugt, daß die meisten Menschen zum vernünftigen Handeln unfähig seien. Dem Zufall maß er eine große Bedeutung zu, er war für ihn aber kausal begründet in einer Kette menschlicher Irrtümer und Leidenschaften. Die Unsterblichkeit der menschlichen Seele gab er preis. Trotz der Geringschätzung aller kirchlichen Dogmen scheint F. niemals ganz sein religiöses Erbe überwunden zu haben. Sein Vorleser →H. de Catt hat wohl richtig beobachtet, daß schon in der aggressiven Art, wie F. über Religion zu sprechen pflegte, der unbewußte Wunsch nach einer Widerlegung zum Ausdruck gekommen sei. Nach der Katastrophe von Hochkirch (1758) muß F. für eine kurze Zeit durch eine religiöse Krise durchgegangen sein. Es war eine der schwersten Stunden seines Lebens. Er erhielt die Nachricht vom|Tode der Lieblingsschwester →Wilhelmine und verlor gleichzeitig einen seiner letzten Freunde, den Feldmarschall →J. Keith. Die Religion vermochte ihm jedoch keinen dauernden Trost zu spenden, von der Metaphysik wandte er sich ganz ab. Er hielt sich für seine Moral an das Beispiel großer Persönlichkeiten aus dem Altertum und der Neuzeit sowie an die Morallehren der Philosophie.
In Rheinsberg haben sich auch bereits die Hauptzüge seiner Staatsanschauung gebildet. Im Sinne der Aufklärung wollte er von dem göttlichen Ursprung der Herrschergewalt nichts mehr wissen. Er setzte einen ursprünglichen Vertrag voraus, der dem Herrscher die unkündbare Gewalt übertragen hatte. Er vertrat den aufgeklärten Absolutismus, wie →Hobbes davon überzeugt, daß die Souveränität unbeschränkt sein müsse, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Er folgte also weder der Staatslehre →Lockes noch →Montesquieus. Von letzterem übernahm er aber die Auffassung, daß die Verschiedenheit der Volkscharaktere und der Regierungsformen sich aus Klima, Bodenbeschaffenheit und den Gewohnheiten erklären lasse. Anders wie Hobbes stellte F. den Fürsten unter das Gesetz, er sollte ebenso wie seine Untertanen zum Dienst am Staat verpflichtet sein. F. erwartete von den staatstragenden Schichten Vaterlandsliebe, die über das reine Pflichtgefühl hinausgehen sollte. Er besaß kein eigentliches dynastisches Solidaritätsgefühl; aus seinen Prosaschriften und Dichtungen können mit Leichtigkeit zahlreiche Äußerungen zusammengestellt werden, die sich mit ihrem beißenden Spott über die fürstlichen Zeitgenossen kaum von späteren antimonarchischen Pamphleten unterscheiden. Doch heißt das nicht, daß für F. die hohe Geburt gar nichts bedeutet hat. Er verachtete die Fürsten, die sich ihren Verpflichtungen entzogen, er schätzte die meisten Regenten kleiner Staaten gering ein, weil sie keine großen Aufgaben zu erfüllen hatten. Aber im Grunde besaß F. einen sehr ausgeprägten, beinahe überheblichen Stolz auf seine Königswürde. Gerade deshalb verlangte er von einem König außerordentlich viel; er wollte kein bloßer Schein- oder Bettelkönig sein. Er hielt deshalb – wenigstens in jüngeren Jahren – auch die Ruhmsucht nicht für verwerflich, soweit sie den Herrscher zu mutigen und edlen Taten für das Wohl des Staates anspornte. Der Fürst, das war seine Forderung, mußte die Verantwortung allein tragen und zu jedem persönlichen Opfer bereit sein. Er sollte alle Fähigkeiten zur Regierung besitzen, denn F. sah den Staat als eine Maschine oder als einen Organismus an. Nur einer konnte diese Maschine bedienen, nur einer der Kopf sein. Er legte daher auf die Prinzenerziehung besonderen Wert; in den politischen Testamenten wird sie ausführlich behandelt. Aber er war schon deshalb davon überzeugt, daß die Erbmonarchie die beste Regierungsform sei, weil er von der Aristokratie mehr Führungsbegabung, mehr Sinn für hohe Gedanken und Taten erwartete. „Trotzen muß ich dem Verderben, muß als König denken, leben, sterben“, rief er Voltaire 1757 zu. Gerade das Beispiel des republikanischen Roms bedeutete ihm viel; von einem König mußte erst recht die gleiche Haltung erwartet werden. F. hat der monarchischen Idee eine neue Bedeutung gegeben, aber er hat gleichzeitig auch die Erbmonarchie überfordert, es war ein gefährliches Unterfangen, ihr das metaphysische Fundament zu entziehen.
F. hat in der Rheinsberger Zeit schon mit großer Aufmerksamkeit die Politik beobachtet. Die Ansichten des aufgeklärten Philosophen und werdenden Staatsmannes durchdringen sich gegenseitig in eigentümlicher Weise. Er litt unter der gesunkenen Reputation Preußens, wie sein Vater sehr erbittert über österreichische Machenschaften. Schon in einem Brief an den Kammerjunker →von Natzmer (1731) hatte er sich offen für die Notwendigkeit einer Machterweiterung ausgesprochen. 1738 schrieb er die „Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe“, die zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht worden sind. Der Blick ist noch ganz nach Westen gerichtet, wo es um das jülich-bergische Erbe ging. In versteckter Form wirbt F. um ein Bündnis mit Frankreich. Von den Großmächten verlangt er eine maßvolle von der Staatsräson bestimmte Politik. Viel wichtiger als Bekenntnis des werdenden Staatsmannes war die „Réfutation du prince de Machiavel“ (erst von Voltaire der Titel „l'Antimachiavel“ eingeführt). F. verfaßte diese Schrift 1739, angeregt durch die Henriade von Voltaire, der die Absicht des Kronprinzen lebhaft unterstützte. Dieser kannte nur den „Fürsten“, und zwar in einer schlechten französischen Übersetzung. Die Widerlegung von →Machiavelli ist F. durchaus mißglückt. Die Vertretung humanitärer Ideale im ersten Teil geht an dessen Grundkonzeption vorbei. Im zweiten Teil nähert sich F. zusehends, ihm selbst wohl kaum klar bewußt, →Machiavellis Ansichten, besonders in den Abschnitten, in denen er von den zwischenstaatlichen Beziehungen und militärischen Angelegenheiten spricht. Doch darf die von F. zum Ausdruck gebrachte Empörung nicht nur als literarische Stilübung abgetan werden; die Ablehnung der von →Machiavelli vorgeschlagenen Mittel im Kampf um die Macht war aufrichtig gemeint, F. kannte die ungünstige Wirkung auf die Fürsten kleiner Staaten. In dieser Schrift hat F. auch bereits die Grundsätze niedergelegt, nach denen er zu regieren beabsichtigte: Das Wohl und das Glück der Untertanen müßten das eigentliche Ziel sein, die Gerechtigkeitsliebe wird stark betont, schon hier wird von F. der Ausdruck gebraucht, daß der Fürst der erste Diener des Staates zu sein habe. Voltaire hat das Manuskript des Kronprinzen überarbeitet, nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich, so daß sich charakteristische Unterschiede der Auffassung ergeben. F. war mit der Bearbeitung nicht zufrieden, wünschte nach dem Regierungsantritt die Veröffentlichung auch deshalb nicht mehr, weil er fremde Staatsmänner wenig schmeichelhaft gezeichnet hatte. Trotzdem erschienen noch 1740 zwei Ausgaben in Holland. Rasch folgten weitere Nachdrucke, da der anonyme Verfasser unschwer erraten wurde.
F. hat sich als König und Staatsmann in Widerspruch zu den humanitären Forderungen gesetzt, die er als Philosoph und Schriftsteller vertreten hatte. Er richtete sich ausschließlich nach dem Staatsinteresse, verschmähte auch die bedenklichsten Mittel zur Erreichung seiner Ziele nicht. Auch seine Urteile über die menschliche Natur werden immer pessimistischer. Die Menschenverachtung der späteren Jahre hatte er in seinen Jugendschriften noch durchaus abgelehnt. Der Vorteil lag darin, daß er gegen einen philosophischen Fanatismus immun war und in seiner Innenpolitik weit stärker als sein Nachahmer, →Josef II., die geschichtlich gegebenen Realitäten beachtete. F. war sich stets bewußt, daß er als Staatsmann im Widerstreit zur Privatmoral stand. Man darf jedoch den sich daraus ergebenden Konflikt nicht überschätzen. Er war überzeugt, daß er, gebunden an eine höhere, wenn auch unbegreifliche Ordnung, in erster Linie die Verpflichtung habe, für den ihm anvertrauten Staat zu sorgen und für diesen zu jedem persönlichen Opfer (auch in moralischer Hinsicht) bereit zu sein. Das Bewußtsein, diese Forderung zu erfüllen, rechtfertigte ihn einigermaßen vor seinem Gewissen. Seine Problematik lag in einer anderen Richtung. Genau wie →Bismarck hat sich F. in der Selbsttäuschung befunden, daß er in einem stillen und beschaulichen Leben viel glücklicher geworden wäre. Sein überschäumendes Temperament, sein dämonischer Machtinstinkt waren immer die stärkste Triebkraft. Aber die Welt der Kunst und des Geistes hatte für ihn ihren eigenen Wert, er konnte ohne sie nicht auskommen. Seiner Veranlagung nach war er für die Schönheit und den heiteren Lebensgenuß sehr empfänglich. Er wäre gern ein →Marc Aurel gewesen und mußte stattdessen einen Staat regieren, den er noch für barbarisch hielt. Angesichts seiner Sensibilität war er ungewöhnlichen Stimmungsschwankungen ausgesetzt; stoische Haltung war für ihn nicht selbstverständlich, er mußte sie ständig seiner Natur abringen. Erschwerend kam noch hinzu, daß F. einen hellwachen, äußerst kritischen Verstand besaß. Es war ihm deshalb nur möglich, sich wohl vorübergehend, aber nicht auf die Dauer in Illusionen und Selbsttäuschungen zu bewegen. Die Reflexion stand in einer unablässigen Auseinandersetzung mit der Aktion. Hierin lag das Einmalige: F. mußte sich gewissermaßen in einem Spiegel sehen, der ihm die Gefahren seiner Leidenschaften, seiner Fehler und Irrtümer, ja die Fragwürdigkeit des menschlichen Daseins entgegenhielt. Die Belastung, unter der F. stand, darf bei seiner Beurteilung nicht außer acht gelassen werden.
Als F. am 31.5.1740 die Regierung antrat, war sein politischer Blick noch dem Westen zugewandt. Mit einer unter der vorigen Regierung nicht üblichen Energie ging er gegen den Bischof von Lüttich vor, als ihm dieser die Herrschaft Hersdal streitig machen wollte. Am 20. Oktober 1740 starb der letzte habsburgische Kaiser →Karl VI. F. sah eine einzigartige Gelegenheit gekommen, Preußen mit einem Schlage in das Spiel der Großmächte einzuführen und das Ansehen seines Staates zu heben. Er vollzog die grundsätzliche Schwenkung von der West- zur Ostorientierung. Durch den Einfall in Schlesien zog er sich die Todfeindschaft der Donaumonarchie zu. Die Art seines Vorgehens ist weder vom Standpunkt der Staatsräson noch von dem der Moral aus zu rechtfertigen. Es hätte nahe gelegen, Gewehr bei Fuß abzuwarten, bis eine für Preußen günstige Situation entstand. Auf ganz Schlesien konnte kein Rechtsanspruch geltend gemacht werden, obwohl es nachträglich versucht wurde. Frühere Ansprüche auf einige schlesische Herzogtümer waren zum mindesten umstritten. F. stürzte sich mit der ganzen Unbesonnenheit der Jugend in ein Unternehmen, das ein großes Risiko in sich schloß und den König zum Friedens- und Vertragsbrecher stempelte. Er hat stets offen zugegeben, daß ihn das Ungestüm seiner Jugend, Ruhmsucht, ja|bloße Neugierde zu seinem Schritt veranlaßt hätten. Doch ist es zum mindesten eine Übertreibung, wenn die Eroberung Schlesiens und die spätere Teilung Polens als die „sensationellsten Verbrechen der Neuzeit“ bezeichnet worden sind (→G. P. Gooch). F. stand unter dem Zwang des geschichtlichen Auftrages. Preußen befand sich noch immer nach einem Ausdruck von F. in einer Zwitterstellung zwischen Kurfürstentum und Königtum, der Staat war nach allen Seiten hin infolge seiner unzusammenhängenden Gestalt und der ungünstigen Grenzen gefährdet. Es wäre auf jeden Fall schwierig gewesen, für Preußen die Unabhängigkeit einer Großmacht zu erreichen, ohne in einen Gegensatz zu den Interessen Österreichs oder einzelner Reichsstände zu geraten. Schon der Kronprinz hatte sich mit der schädlichen Rivalität des schlesischen Handels näher befaßt. Eine so reiche Provinz wie Schlesien verhalf Preußen zu einer erweiterten Wirtschaftbasis, ohne die es keine große Politik zu treiben vermochte. Schlesien war auch ein gegebenes Aufmarschgebiet für Operationen in Böhmen, es trennte überdies Sachsen von Polen. F. hat daher auch niemals die Entscheidung von 1740 bereut; noch im 7jährigen Krieg setzte er die Lebensfähigkeit seines Staates mit der Behauptung des schlesischen Besitzes gleich. Bestand ein grundsätzlicher Unterschied zu den Kriegen Ludwigs XIV.?
F. täuschte sich in seinen Berechnungen. Obwohl er für die Abtretung Schlesiens die Garantie des österreichischen Gesamtstaates und die Zustimmung zur Nachfolge →Maria Theresias anbot, entschloß sich die junge Königin fast allein zum äußersten Widerstand. Die Eroberung von Schlesien gelang; der protestantische Teil der Einwohnerschaft begrüßte F. als Befreier. Im übrigen aber entstand eine sehr ernste internationale Situation. →Georg II. bemühte sich um eine große Koalition gegen Preußen; Frankreich unter →Fleury versagte sich einem Bündnis. Erst die Schlacht von Mollwitz (10.4.1741) brachte den Umschwung. F. verfügte als Feldherr noch nicht über ausreichende Erfahrungen, seine Dispositionen stifteten Verwirrung an; auf Anraten des Feldmarschalls →von Schwerin verließ er das Schlachtfeld in einer wenig rühmlichen Flucht. Mollwitz wurde in seiner Abwesenheit →von Schwerin gewonnen. Der Eindruck auf Europa war groß. Am 5.6. kam es in Breslau zum preußisch-französischen Bündnis. Da jedoch die französische Kriegführung wenig energisch war und F. keine Lust hatte, für fremde Interessen zu kämpfen, schloß er mit Österreich das vielumstrittene Abkommen von Klein-Schnellendorf (9.10.). Schlesien blieb vorläufig bei Preußen. F. kam in den Ruf eines unzuverlässigen Verbündeten. Für Österreich bedeutete es die dringend benötigte Atempause, um seine Kräfte erneut zu sammeln. Nach kurzer Zeit trat daher F. wieder in den Krieg ein, diesmal im Bunde mit Bayern, dessen Kurfürst →Karl Albrecht in Frankfurt zum Kaiser (→Karl VII.) gewählt worden war (24.1.1742). F.s Sieg bei Chotusitz in Böhmen (17.5.) ermöglichte den Friedensschluß in Berlin (28.7.). Preußen erhielt Schlesien mit Einschluß der Grafschaft Glatz. Der Kampf ging in den Österreichischen Erbfolgekrieg über, Bayern wurde von den österreichischen Truppen erobert. Die sogenannte pragmatische Armee (Engländer, Holländer, Österreicher und deutsche Miettruppen) errangen den großen Sieg bei Dettingen über die Franzosen (27.6.1743). In diesem kritischen Stadium unternahm F. den Versuch, mit Hilfe des Reiches das österreichische Übergewicht zu brechen. Schon 1742 hatte er in München die Säkularisation geistlicher Gebiete angeregt. Nunmehr schlug er eine Assoziation von Reichsständen und Reichskreisen vor; eine Neutralitätsarmee sollte gebildet werden. Für sich verlangte F. die Stellung eines ständigen Generalleutnants. Von Reichspatriotismus läßt sich kaum sprechen, F. hatte nur das Interesse seines Staates im Auge. Der Plan scheiterte völlig, das Mißtrauen vieler kleinerer Reichsstände gegenüber Preußen war damals weit größer als gegenüber Österreich. Auch das vorgesehene französische Protektorat erregte Mißfallen. F. unternahm den 2. Schlesischen Krieg, nachdem ein neues Bündnis mit Frankreich zustandegekommen war (5.6.1744). Ohne genügende Sicherung der Verbindungswege fiel der König in Böhmen ein. Die Eroberung von Prag gelang ihm wohl; die österreichische Armee unter dem Prinzen →Karl von Lothringen drängte jedoch F. von seinen Magazinen in Prag und an der oberen Elbe ab. F. war genötigt, nach Schlesien zurückzugehen, die Armee war demoralisiert; vorübergehend kam es sogar zu einer Vertrauenskrise des Offizierkorps. Am 26.1.1745 starb →Karl VII., Bayern schloß eilig mit Österreich Frieden. Es war daher ein Glück, daß F. bei Hohenfriedberg ein glänzender Sieg gelang (4.6.). Hier hat er zum erstenmal sein Feldherrntalent voll unter Beweis stellen können. Österreich wurde erst durch weitere Mißerfolge friedensreif. Nach Siegen F.s bei Soor (30.9.) und des Alten Dessauers bei Kesselsdorf über die Sachsen (15.12.) kam in Dresden der Frieden zustande (25.12.). F. behielt Schlesien, Sachsen mußte eine Million Taler|Kriegsentschädigung zahlen. Seine Reichspläne waren allerdings völlig gescheitert; er erkannte den Gemahl der →Maria Theresia, →Franz I., als Kaiser an.
F. hat einen neuen Krieg für unvermeidlich gehalten. Er war sich der gefährdeten Lage Preußens sehr bewußt. Im Politischen Testament von 1752 betonte er vor allem die unregelmäßige Gestalt seines Staates, die ungeschützten Grenzen angesichts feindlicher Nachbarn. In den „Politischen Träumereien“ dieses Testaments bezeichnete er die Erwerbung von Sachsen, Westpreußen und auch Mecklenburg in hohem Grade für erwünscht. – F. hat unermüdlich an der Vervollkommnung der Armee gearbeitet; die in den Schlesischen Kriegen gewonnenen Erfahrungen wurden nutzbar gemacht. Er stellte allgemeine Richtlinien und Instruktionen auf, vor allem in den Generalprinzipien des Krieges (1748) und in einem Lehrgedicht über die Kriegskunst. Bei der Ausbildung legte er großen Wert auf kühnen Angriffsgeist, vornehmlich bei der Kavallerie, die überdies stark vermehrt wurde. Die Offiziersstellen waren so gut wie ausschließlich dem Adel vorbehalten. F. war der Meinung, daß der Adel als Stand mehr Ehrgefühl und mehr Führungstalent besitzen müsse als das Bürgertum. Er hielt den Adel für den ersten Stand, infolgedessen wurde dieser auch in seiner wirtschaftlichen Stellung begünstigt. Nur der Adlige durfte ein Rittergut erwerben, da damit Privilegien verbunden waren. Trotzdem kann man kaum sagen, daß F. die ständische Ordnung in ihrer ursprünglichen hierarchischen Bedeutung erhalten hat. Der erste Stand wurde so weitgehend in den Staat integriert, sein Ansehen so ausschließlich auf Leistung und Verdienst begründet, daß geradezu von einer gesellschaftlichen Umbildung gesprochen werden darf.
F. steuerte nicht bewußt auf einen Offensivkrieg hin, den er nur unter bestimmten Voraussetzungen für möglich hielt. Der Krieg wurde erst durch die großen Verschiebungen ausgelöst, die sich im europäischen Staatensystem vollzogen. Das „renversement des alliances“ hat sich schon seit langem vorbereitet. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts war aus der Rivalität zwischen Frankreich und England ein säkularer Gegensatz entstanden. Auch die anderen Gruppierungen waren in Fluß geraten. Mit allem Nachdruck betrieb Österreich unter →Kaunitz die Annäherung an Frankreich. Der Hauptfeind war Preußen geworden. In Frankreich waren die Meinungen gespalten. Während noch viele an der antihabsburgischen Tradition festhielten, gab es eine einflußreiche Partei, die Österreich schon deshalb Preußen vorzog, weil die Donaumonarchie als ein wertvollerer Bundesgenosse angesehen wurde. Nicht nur die →Marquise de Pompadour, sondern auch →Ludwig XV. und andere Politiker waren von der Notwendigkeit des Frontwechsels überzeugt; das Erstarken Preußens wurde mit Argwohn beobachtet. Auch die Haltung Rußlands, schon seit 1740 mit Österreich verbündet, ist nicht hauptsächlich aus dem persönlichen Haß zu erklären, den die →Kaiserin Elisabeth gegenüber F. empfand. Die zunehmende Handelsrivalität zwischen England und Rußland, der russische Ausdehnungsdrang nach dem Westen seit →Peter dem Großen, vor allem die polnische Frage, für deren rein russische Lösung Preußen im Wege stand, gaben den Ausschlag. Die Beziehungen zwischen England und Österreich waren mehr und mehr erkaltet. Die Gefahr einer sich herausbildenden antipreußischen Koalition wurde F. erst seit 1755 bewußt. Am 16.1.1756 schloß er die Westminster-Konvention mit England, in der sich England und Preußen zur gemeinsamen Abwehr jeden Angriffes einer fremden Macht verpflichteten. F. befürchtete eine Bedrohung Hannovers durch die Russen, er hoffte auf diese Weise diese an England zu binden und Österreich zu isolieren. Umgekehrt erwartete London von der Konvention, daß die große Auseinandersetzung mit Frankreich, die in Nordamerika bereits 1754 begonnen hatte, sich nicht zu einem europäischen Krieg erweitern würde. Die Erwartungen erfüllten sich nicht. Die französische Regierung betrachtete die Konvention als Verrat des preußischen Verbündeten. Sie entschloß sich zu einem Neutralitäts- und Verteidigungsbündnis mit Österreich (1.5.1756). Auch in Petersburg bestand Bereitschaft zum Kriege. Auf das äußerste beunruhigt über russische und österreichische Rüstungen und angebliche Truppenbewegungen entschloß sich F. zum Präventivkrieg, in der Überzeugung, daß es ihm noch durch rasche Siege gelingen werde, die sich bildende Koalition zu sprengen. Im August 1756 fiel er in Kursachsen ein; der Versuch, aus Dresdener Archiven Sachsens preußenfeindliche Haltung und die Kriegsabsichten seiner Gegner zu beweisen, verfehlte seine Wirkung. Bei den meisten Reichsständen herrschte helle Empörung über F.s Vorgehen. Die brutalen Maßnahmen, die er militärisch und wirtschaftlich in dem eroberten Lande traf, gaben diesen Gefühlen ständig neue Nahrung. Auch in Frankreich schlug die Stimmung zu F.s Ungunsten um. Aus dem Defensivvertrag wurde der Offensivvertrag vom 1.5.1757. Rußland und Schweden traten in den Krieg ein. Der Sieg von Prag (6.5.) über →Karl von Lothringen war durch große Opfer und den Tod von Schwerin teuer bezahlt. Die Niederlage von Kolin (18.6.) wirkte sich militärisch, politisch und psychologisch gleich verhängnisvoll aus. Sie zerschlug alle Friedenshoffnungen, nahm F. den Nimbus der Unbesiegbarkeit und brachte den Reichskrieg in Gang. Böhmen mußte sofort geräumt werden. Prinz →August Wilhelm ließ sich bis Bautzen zurückdrängen, so daß Schlesien bedroht war. F. behandelte seinen Bruder mit unnachsichtiger Härte, er enthob ihn des Kommandos. In der nächsten Zeit häuften sich die Unglücksbotschaften. Die Österreicher drangen bis Berlin, die Russen in Ostpreußen, die Schweden in Pommern vor. Durch die Konvention von Kloster Zeven¶ (8.9.) zog sich England-Hannover zeitweilig aus dem kontinentalen Krieg zurück. F., der noch mit einer gewissen Unbekümmertheit und Überheblichkeit in den Krieg eingetreten war und seinen Minister →von Podewils, der ihn gewarnt hatte, spöttisch „Monsieur de la politique timide“ nannte, kämpfte fortan um den Bestand seines Staates. Er sollte merkwürdigerweise seinen Ruhm auf schweren diplomatischen und militärischen Fehlern begründen. Denn erst jetzt konnte er unter Beweis stellen, daß er ein Feldherr von hohem Range war. Im Unglück entwickelte er jene erstaunliche moralische Energie, die allein die Selbstbehauptung gegenüber der feindlichen Übermacht ermöglicht hat.
F. kann als Feldherr nur dann zutreffend gewürdigt werden, wenn davon ausgegangen wird, daß Politik und Strategie bei ihm eine vollkommene Einheit bildeten. Seine strategischen Pläne waren weitgehend von politischen Erwägungen abhängig. Da er häufig vor der Notwendigkeit stand, sich gegenüber zahlenmäßig überlegenen Gegnern zu behaupten, mußte er darauf bedacht sein, das Zusammenwirken mehrerer feindlicher Armeen zu vereiteln beziehungsweise mit durchschlagenden Erfolgen Friedenschancen zu eröffnen. Der Mut zum Wagnis, aber auch die nüchterne Erfassung aller sich ergebenden Möglichkeiten bestimmten die Art seiner Kriegführung. F. darf nicht auf ein starres System festgelegt werden, da er sich durch Erfahrungen belehren ließ. Der Streit, ob F.s Kriegführung mehr der Ermattungsstrategie oder der Vernichtungsstrategie zuzurechnen ist, darf daher als erledigt gelten. Angesichts der beschränkten Mittel, der ungünstigen Verkehrsverhältnisse, mit einer Armee, die sich zum Teil aus Ausländern und unzuverlässigen Elementen zusammensetzte, konnte F. nicht daran denken, den Feind in offenen Feldschlachten vernichtend zu schlagen. Aber er war auch nicht mehr ein Anhänger der bisherigen Manövriertaktik, er nahm das Risiko der Schlacht auch unter ungünstigen Bedingungen auf sich. Fehlschläge waren unvermeidlich. Durch diese offensive Kriegführung hat F. jedoch die Gegner demoralisiert, die lähmende Wirkung, die von seinen manchmal gänzlich unerwarteten Erfolgen ausging, läßt sich kaum überschätzen. – Im November 1757 faßte F. einen überaus kühnen Entschluß. Ohne Rücksicht auf die akute Gefährdung Schlesiens wandte er sich gegen die von Westen vordringenden Franzosen und Reichstruppen und schlug sie bei Roßbach (5.11.). Die Wirkung war außerordentlich. In London verwarf →W. Pitt die Konvention von Kloster Zeven¶; Preußen erhielt Subsidien, ein Hilfskorps unter der ausgezeichneten Führung →Ferdinands von Braunschweig operierte seitdem im nordwestlichen Raum erfolgreich gegen die Franzosen. Roßbach wurde aber auch in Deutschland als nationales Ereignis gefeiert. In Eilmärschen wandte sich F. nach Schlesien zurück, das inzwischen fast ganz verlorengegangen war. Bei Parchwitz vereinigte er sich mit der schlesischen Armee. Hier hat F. seine berühmte Ansprache an seine Offiziere gehalten. Sie war ein psychologisches Meisterstück. Er verheimlicht den verzweifelten Ernst der Lage nicht, appelliert an das Ehrgefühl, droht aber auch zugleich schwere Strafen für etwa versagende Regimenter an. Unter Anwendung der schiefen Schlachtordnung, das heißt bei anfänglicher Zurückhaltung des linken Flügels, errang er bei Leuthen einen großen Sieg über die an Zahl weit überlegenen Österreicher (5.12). Ganz Schlesien fiel wieder in seine Hand. Niemals war F. seiner Armee, die an diesem Tage überwiegend aus Landeskindern bestand, die für den König und ihren Glauben kämpften, so nahe, wie am Abend von Leuthen, als der Choral „Nun danket alle Gott“ über das Lager hinweg erklang. Hoffnungen auf den Frieden zerrannen jedoch bald, das österreichisch-französische Bündnis wurde Anfang 1758 erneuert. F. schlug zwar die Russen bei Zorndorf (25.8.); aber die Verluste waren außerordentlich schwer. Er lernte die Tapferkeit und Disziplin der russischen Soldaten fürchten. Bei dem nächtlichen Überfall von Hochkirch (14.10.) durch die Österreicher büßte F. einen großen Teil seiner Artillerie ein. Seit 1759 befand sich F. bereits in der strategischen Defensive. Er wagte den Angriff auf die vereinigten Russen und Österreicher, die sich rechts der Oder bei Kunersdorf in|günstigen Stellungen befanden, er erlitt eine vernichtende Niederlage (12.8.). F. hat in der Schlacht den Tod gesucht, er gab hinterher alles verloren, es kam vorübergehend zu einer schweren physischen und psychischen Krise. Er übergab den Befehl über die Trümmer der Armee dem General →F. A. von Finck und trug sich ernstlich mit Selbstmordgedanken. Als der Gegner infolge von Meinungsverschiedenheiten und aus Furcht vor dem Genie des Königs den Sieg nicht ausnutzte (das Mirakel des Hauses Brandenburg!), fing sich F. nach wenigen Tagen wieder. Er konnte jedoch die Kapitulation von →Finck bei Maxen (20.11.) nicht verhindern. Er hatte diesem eine undurchführbare Aufgabe übertragen. Die Siege bei Liegnitz (15.8.1760) und bei Torgau (3.11.) konnten nur eine zeitweilige Entlastung bringen; Schlappen von Unterführern hielten die Waage; trotz vielfacher Bemühungen gelang es F. nicht, mit einer der feindlichen Mächte einen Sonderfrieden zu schließen. Die Russen wurden durch die Aussicht auf Ostpreußen festgehalten. Allerdings war F. keinen Augenblick zur Preisgabe auch nur eines Teils von Schlesien bereit.
Seine Kräfte waren erschöpft. Fortan mußte er sich auf die reine Defensive beschränken. Das Ersatzproblem wurde immer ernster. In zunehmendem Maße wurde auf Landeskinder zurückgegriffen. Freibataillone wurden aufgestellt, blutjunge Kadetten und auch Bürgerliche rückten in die Offiziersstellungen ein. Die Wirtschaft lag schwer danieder, selbst vor einer Münzverschlechterung schreckte der König nicht zurück. Gewiß darf bei F. die Neigung zur Schauspielerei, die Vorliebe für eine antike Pose nicht übersehen werden. Er ließ sich manchmal mehr gehen, als notwendig war. Auch klammerte er sich immer wieder an die Hoffnung auf eine Hilfe von den Türken und Tataren. Aber letzten Endes hat der König doch ganz illusionslos sich die furchtbare Lage seines Staates klargemacht. Die Last der Verantwortung drückte ihn schwer, gegen die Schrecken des Krieges war er durchaus nicht unempfindlich. Zum erstenmal bezogen Österreicher und Russen 1761 auf preußischem Boden Winterquartiere. In England wurde →Pitt gestürzt, der das preußische Bündnis sehr hoch eingeschätzt hatte; ein englisch-französischer Sonderfriede stand vor der Tür. Nur der Tod der Kaiserin Elisabeth am 5.1.1762 hat F. vor dem Schlimmsten bewahrt. Ihr Nachfolger, der Holsteiner →Peter III., ein infantiler Narr, aber ein glühender Bewunderer des preußischen Königs, schloß mit diesem sofort ein Bündnis. Nach →Peters baldigem Sturz kündigte →Katharina II. wohl das Bündnis, trat aber nicht wieder in den Krieg ein. Nachdem F. bei Burkersdorf (21.7.), →Prinz Heinrich bei Freiberg (29.10.) Erfolge davongetragen hatten, konnte angesichts der allgemeinen Kriegsmüdigkeit der Friede von Hubertusburg zustandekommen (15.2.1763). Der territoriale Besitzstand blieb unverändert, F. gab die Zusage, einer künftigen Wahl des Erzherzogs →Josef zum Kaiser zuzustimmen. Der 7jährige Krieg war ein Weltkrieg gewesen, den Hauptgewinn trug England davon, zu dessen Gunsten war die Entscheidung in Amerika und Indien gefallen.
Europa und Nordamerika blickten bewundernd auf F., der Nimbus der preußischen Armee wirkte lange nach. In den Augen vieler Engländer und Amerikaner hat F. bis in das 19. Jahrhundert hinein als Vorkämpfer der protestantischen Freiheit gegolten. Er kehrte jedoch enttäuscht zurück. Er hatte auf territorialen Gewinn, besonders auf Sachsen gehofft. Im politischen Testament von 1768 sprach F. Preußen noch immer den Charakter einer Großmacht ab, er wußte, daß die Außenposten Ostpreußen und die westlichen Besitzungen im Kriege nicht zu halten waren. F. war weiterhin bemüht, die Schlagkraft der Armee zu erhalten beziehungsweise zu mehren – zu den damals schon notwendigen umfassenden Reformen kam es allerdings nicht –, einen neuen Krieg wünschte er nicht. Er fürchtete die russische Macht und war deshalb bereit, mit →Katharina ein Verteidigungsbündnis zu schließen (11.4.1764). F. hat es beklagt, daß der preußisch-österreichische Dualismus ein Zusammengehen mit dem Kaiserstaat zur Abwehr des russischen Druckes unmöglich machte. Seine Zusammenkünfte mit →Josef II. in Neiße (25.8.1769) und Mährisch-Neustadt (3.-7.9.1770) führten nur zu einer vorübergehenden Entspannung. F. hatte die Erwerbung Westpreußens stets als erstrebenswertes Ziel angesehen. Die Verhandlungen mit →Katharina II. über Polen kamen unter Vermittlung des Prinzen →Heinrich in Gang. →Katharina hat Preußen zunächst nur Ermland zugedacht. Infolge der drohenden Haltung Österreichs, das über die russischen Erfolge im Kriege gegen die Türkei sehr beunruhigt war und die Festsetzung der Russen in den Donaufürstentümern um keinen Preis zulassen wollte, gab sie nach. So kam am 5.8.1772 der endgültige Vertrag über die sogenannte 1. Teilung Polens zustande, die Preußen den Gewinn von Ermland und Westpreußen ohne Danzig und Thorn eintrug, also nur polnische Eroberungen nach dem Zusammenbruch des Ordensstaates. Gegen schwere Gewissensbedenken →Maria Theresias setzte →Josef Österreichs Beteiligung durch, es erhielt Galizien. Der Unwille über die Teilung war im übrigen Europa schon damals groß. Frankreich sah sich außerstande, Polen zu helfen. In England waren die Meinungen geteilt. Es gab sehr scharfe Kritik, man sorgte sich auch um den Handel mit Danzig; es fehlte jedoch nicht an Stimmen, die schon aus konfessionellen Gründen und aus Verachtung der polnischen Zustände der Regierung strikte Neutralität anempfahlen. F. beobachtete nach wie vor die österreichische Politik voller Mißtrauen. Als →Josef II. den Übergang Bayerns an die kurpfälzische Linie mit österreichischen Erbansprüchen auf Niederbayern beantwortete, kam es 1778 zum Bayerischen Erbfolgekrieg, da F. unter keinen Umständen eine derartige Verstärkung der österreichischen Machtstellung im Reich zulassen wollte. Sachsen stand ihm zur Seite. Es kam jedoch zu keinen größeren Kriegshandlungen (Kartoffelkrieg), F. und auch →Maria Theresia wollten den Frieden; die Haltung der Großmächte war Österreich wenig günstig. So begnügte sich dieses im Teschener Frieden mit dem Innviertel (13.5.1779). Aber →Josef II. gab nach dem Tode seiner Mutter (1780) seine Pläne nicht auf. Im Kurfürstentum Köln und im Fürstbistum Münster war durch die Wahl eines Sohnes →Maria Theresias zum Koadjutor der österreichische Einfluß sehr verstärkt worden. Es war →Josef gelungen, Rußland auf seine Seite zu ziehen. Da er auf französische Unterstützung rechnete, wollte er den bayerischen Kurfürsten zu einem Tausch gegen die Niederlande bewegen. F. fand sich in Europa isoliert, so übernahm er dieses Mal die Rolle des Protektors der ständischen Freiheiten. Es gelang ihm, eine Anzahl der über die österreichischen Pläne beunruhigten deutschen Fürsten 1785 im Fürstenbund zu einigen. Den Kern bildeten zunächst Preußen, Hannover und Sachsen, andere Reichsstände, sowohl protestantisch wie katholisch, schlossen sich an. Wieder waren für F. reichspatriotische Erwägungen nicht bestimmend. Das Ziel wurde erreicht, Österreich wich zurück, Bayern blieb selbständig. Immerhin wies der Fürstenbund schon deutlich in die Zukunft. Das Reich war keine machtpolitische Realität mehr. Die deutschen Staaten waren daher genötigt, sich je nach der Konstellation um die beiden Kraftfelder Österreich und Preußen zu gruppieren.
Seit dem Ende der ersten Schlesischen Kriege war F. in rastloser Fürsorge für seine Länder tätig. Die Selbstregierung aus dem Kabinett wurde von ihm auf die Spitze getrieben. Bis ins kleinste hinein wünschte er alles selbst zu regeln. Es lag hierin eine Überspannung des Systems, zumindest gilt dies für die späteren Jahre. Notwendig ergaben sich Schwierigkeiten mit den Provinzen, da deren Bedürfnisse sehr verschieden gelagert waren. Als Organisator war F. seinem Vater nicht ebenbürtig. Im allgemeinen ließ er die von diesem eingerichtete Verwaltungsordnung bestehen. Im Generaldirektorium wurden zwei neue Departements eingeführt, für Kommerzien- und Manufakturwesen sowie für die Militär- und Proviantverwaltung. Sie waren für den ganzen Staat zuständig. Für Schlesien wurde ein Provinzialminister ernannt, der dem König direkt verantwortlich war. Das Landratsamt, eine ständische Einrichtung, wurde auf alle Provinzen ausgedehnt, auf dem Lande konnte sich daher eine kräftige Selbstverwaltung entfalten, während in den Städten hiervon noch nicht die Rede sein konnte. 1744 kam Ostfriesland durch Erbfall an Preußen. Die alte ständische Verfassung wurde zunächst beibehalten, Widerstand gegen die Staatsgewalt freilich rasch gebrochen. Die Stände verzichteten freiwillig auf wesentliche Rechte. Sehr bedeutsam waren die Reformen im Zivilrecht. Sie verfolgten zwei Hauptziele: Die Verbesserung beziehungsweise Vereinfachung der Gerichtsverfassung und Prozeßordnung sowie die Schaffung eines allgemeinen Landrechtes. F. fand in den beiden Großkanzlern →S. von Cocceji und →C. von Carmer für das große Werk vorzüglich geeignete Helfer. Die Reformen in der Gerichtsverfassung gewährleisteten größere Sicherheit für jeden einzelnen; die Voraussetzungen für einen unabhängigen und tüchtigen Richter- und Anwaltsstand wurden geschaffen. Die Kodifizierung des allgemeinen Landrechts begann →Carmer mit Unterstützung von →G. Svarez nach dem 7jährigen Krieg. Es ist erst 1794 in Kraft getreten, und es war eine wichtige Etappe auf dem Wege zum Rechtsstaat. F. wollte im Prinzip die Unabhängigkeit der Zivilgerichte. Im Prozeß des Müllers Arnold (1779) hob er jedoch das Urteil willkürlich auf und bestrafte die Mitglieder des Kammergerichts hart. Er war des irrigen Glaubens, daß das Recht zu Ungunsten der schwächeren Prozeßpartei gebeugt worden war. Gerade dieser Mißgriff erwarb F. im In- und Auslande den Ruf unbestechlicher Gerechtigkeit und eines Beschützers der Schwachen. Gleich nach dem Regierungsantritt beseitigte er die Tortur und sorgte für Milderung der Strafen im zivilen Bereich. In der Armee behielt er die barbarischen Strafen ohne Einschränkung bei, von der|Überzeugung ausgehend, daß ohne Furcht des gemeinen Mannes vor den Offizieren die Disziplin nicht aufrechterhalten werden könne. – In seiner Toleranz gegenüber den Kirchen ging F. sehr weit. Auch die katholische Kirche wurde von ihm geschützt. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens hat er diesem eine Freistatt in seinen Landen angeboten. Konflikte mit dem fürstbischöflichen Stuhl in Breslau waren allerdings trotzdem nicht zu vermeiden. Die – ohnehin beschränkte – Pressefreiheit wurde bald wieder aufgehoben, aber „raisonnieren“ war durchaus gestattet, da F. das für ungefährlich hielt. Den Ausländern fiel die freimütige Kritik in preußischen Landen besonders auf. – Obwohl sich F. in der Spätzeit für pädagogische Probleme besonders interessierte – auch die Schrift über die deutsche Literatur verfolgte einen pädagogischen Zweck –, blieben die Reformen im Erziehungswesen nur Stückwerk. F. begünstigte das humanistische Gymnasium, er wünschte auch eine Verbesserung des Deutschunterrichts in den höheren Schulen, für die breiten Volksschichten hielt er nur elementarste Kenntnisse für erforderlich.
Seine Wirtschaftspolitik wurde von den merkantilistischen beziehungsweise kameralistischen Zeitanschauungen bestimmt. In der Landwirtschaft richtete sich das Hauptstreben auf Melioration und „Peuplierung“, da F. in der menschlichen Arbeit die Quelle des Reichtums eines Landes erblickte. Zahlreiche Kolonistenfamilien wurden angesiedelt, vorwiegend im Oder- und Warthebruch, später auch im Netzebruch. Auf den königlichen Domänen wurde die Erbuntertänigkeit der Bauern aufgehoben. Der König scheute jedoch davor zurück, seinem Landadel ähnliche Reformen aufzuzwingen, da er ihm für den Dienst in der Armee und in der Zivilverwaltung unentbehrlich war. Man fürchtete auch, daß die Bauern nach der Aufhebung der Gutsuntertänigkeit in die Städte abwandern würden. Wie bereits seine Vorgänger verbot jedoch F. im fiskalischen Interesse das Bauernlegen.
Handel und Gewerbe wurden von ihm mit allen Mitteln gefördert. Sie standen gänzlich unter der Kontrolle des Staates; von Freizügigkeit und Privatinitiative konnte noch nicht die Rede sein. Die Folgen des 30jährigen Krieges waren durchaus noch nicht völlig überwunden; ein von Vorurteilen freier und selbstbewußter Bürgerstand mußte sich erst bilden. Es war allerdings schon ein gewisser Anachronismus, wenn F. auch nach dem 7jährigen Krieg noch an den starren merkantilistischen Methoden mit Zollsperren festhielt. Den zukunftsweisenden Gedanken der Physiokratie, die Freiheit des Handels, übernahm er nicht. Besondere Aufmerksamkeit wandte F. der Textil- und Seidenindustrie zu. Später begann der große Aufschwung der schlesischen Montanindustrie, die Berliner Porzellanmanufaktur wurde berühmt. Sehr viel ist für die Verbesserung der Verkehrswege, insbesondere der Wasserstraßen geschehen. Westpreußen hat von der Verwaltung, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, bedeutenden Nutzen gezogen. Nach dem 7jährigen Krieg mußte F. auf das „Rétablissement“, auf den Wiederaufbau, mit dem verwaltungsmäßige Maßnahmen verbunden waren, bedacht sein. Die Heilung der Kriegsschäden ging verhältnismäßig rasch vonstatten, obwohl zahlreiche Dörfer zerstört worden waren. F. scheute in dieser Periode nicht vor Experimenten zurück. Das Tabak- und Kaffeemonopol machten in weiten Kreisen böses Blut. Sehr umstritten war auch die sogenannte Regie, die einheitliche Verwaltung der Akzise, das heißt der indirekten Steuern. Für die leitenden Kontrollstellen zog er Franzosen heran, da er sie für besser vorgebildet hielt. Die staatliche Planwirtschaft wirkte sich günstig auf die Getreidehandelspolitik aus, da vermittels Anlage von Getreidemagazinen und der Regelung von Ein- und Verkauf der Preis in einer für Produzenten und Konsumenten annehmbaren Höhe erhalten wurde. Nur durch eine solche Vorratssammlung konnte die furchtbare Hungersnot der Jahre 1771/72 aufgefangen werden. Im großen und ganzen läßt sich doch von F.s Wirtschaftspolitik sagen, daß sie beträchtliche Erfolge erzielte. Seine Regierung schloß mit einer aktiven Handelsbilanz ab.
Der Kunst, der Literatur und den Wissenschaften wandte F. vor allem vor dem 7jährigen Krieg das lebhafteste Interesse zu Schloß Sanssouci ließ er sich fast ganz nach eigenen Entwürfen erbauen (1745-47). Der Ausbau des Potsdamer Stadtschlosses und das Berliner Opernhaus waren unter anderem Schöpfungen von →Knobelsdorff. Das Rokoko erhielt durch diesen ein eigentümlich preußisches Gepräge. Als Bildersammler begünstigte F. zunächst die Franzosen (→Watteau), später Niederländer und Italiener. Die in Verfall geratene Akademie empfing einen ganz neuen Geist; sie wurde repräsentativ für alle Zweige der Wissenschaft und schönen Künste. F. zog die Franzosen auffällig vor, nicht nur weil er von deutschen Gelehrten nicht allzuviel hielt, sondern weil er bei ihnen das weltgewandte Auftreten der Franzosen vermißte. Erster Präsident wurde der berühmte Mathematiker →Maupertuis. Bedeutend waren zum Teil die der Akademie angehörenden Naturforscher. Zu den exakten Wissenschaften gewann F. nie das rechte innere Verhältnis. F. gab aber schon dadurch der Akademie ein ungewöhnliches Ansehen, daß er sich selbst als Mitglied betrachtete und seine Arbeiten in diesem Kreise verlesen ließ. Er war, soweit es ihm die Zeit erlaubte, literarisch tätig. Er schrieb Schriften politischen, militärischen, philosophischen Inhalts, zahllose Oden, Episteln, Satiren. Von seinen Gedichten haben nur sehr wenige einen künstlerischen Wert, aber gerade sie verraten viel vom Denken des Menschen und Königs. 1746-51 entstanden die „Memoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg“ und die „Histoire de mon temps“, die F. dann nach dem 7jährigen Krieg fortsetzte. F. konnte selbstverständlich kein objektiver Geschichtsschreiber sein. Die Handlungen einzelner Persönlichkeiten stehen im Vordergrund. Aber das Bemühen um Distanz von der eigenen Person ist auffallend, eigene Fehler und Irrtümer werden nicht verschwiegen. Diese Geschichtsschreibung sollte nicht nur Rechtfertigung seiner Politik, sondern auch Kontrolle der von ihm gewonnenen Erfahrungen durch die Geschichte sein.
In Sanssouci sammelte F. eine Tafelrunde um sich, zu der 1750-53 auch →Voltaire gehörte. Dieser schied dann unter unerfreulichen Umständen im Zorn und verfaßte ein überaus gehässiges Pamphlet über den Berliner Hof. Der Briefwechsel wurde jedoch im 7jährigen Krieg wieder aufgenommen. In den späteren Jahren wurde es immer schwieriger, einen festen Kreis zusammenzuhalten. F. verdarb sich durch verletzende Spottsucht vieles; manche Ausländer fühlten sich auf die Dauer in der Berliner und Potsdamer Atmosphäre nicht wohl. Einen überragenden Platz nahm in F.s Leben die Musik ein. 1742 wurde das neue Opernhaus eröffnet, zusätzlich hat der König das sogenannte „Intermezzo“ im Potsdamer Stadtschloß errichtet. Sein musikalischer Geschmack war einseitig, er neigte vornehmlich der älteren Neapolitanischen Schule zu. 1747 kam es zu einer Begegnung mit →Bach. F. bewunderte sein Spiel auf Silbermannschen Hammerklavieren, wahrscheinlich hat er jedoch für die Widmung des „Musikalischen Opfers“, dessen Thema er selbst angegeben hatte, nicht einmal gedankt. →Bachs geistliche Musik stand ihm fern. Bachs Sohn →Philipp Emanuel war seit 1740 erster Cembalist in Berlin, ging aber 1767 nach Hamburg, weil er sich wie auch andere vernachlässigt fühlte. Während und nach den ersten beiden Schlesischen Kriegen hat F. viel komponiert. Es werden ihm unter anderem etwa 121 Sonaten für Flöte und Cembalo und 4 Konzerte für Flöte und Streichorchester zugeschrieben. F. hat auch einzelne Stücke zu Opern von →C. H. Graun und →J. A. Hasse in Musik gesetzt und Opernlibretti geschrieben. Der Hohenfriedberger Marsch stammt vermutlich nicht von ihm. Musikkenner rühmen den Schwung und die Eleganz der melodischen Erfindung und beanstanden eine gewisse Unsicherheit in der Ausführung. Das Flötenspiel (Ausbildung hauptsächlich von →J. Quantz) war für F. gleichzeitig Anregung und Erholung; er griff zeitweilig tagsüber vier- bis fünfmal zur Flöte. Er spielte, soweit bekannt ist, ausschließlich eigene Kompositionen und diejenigen von →Quantz. Die Zeitgenossen fanden sein Adagio bemerkenswert. Nach dem 7jährigen Krieg ließ F.s Interesse an der Musik merklich nach. Die Oper geriet allmählich in Verfall. Nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg hat der König die Flöte nicht mehr in die Hand genommen. F. war in seinem Alter für Neues nicht mehr aufnahmefähig. Selbst von der jüngeren italienischen Musik wollte er nichts wissen.
Der geistigen Bewegung der späteren Jahre stand F. mit geringerem Verständnis gegenüber. Das galt auch für die jüngere französische Generation, deren Gesellschaftskritik er überheblich fand, deren formloser Subjektivismus seinen Spott herausforderte. Nur für Einen aus dem Umkreis der Enzyklopädisten, für →d'Alembert, brachte er Zuneigung auf. →Rousseau hielt er im Grunde für einen Narren, wenn er ihm auch vorübergehend in Neuchâtel Asyl gewährt hat. F. hat die große Revolution nicht vorausgeahnt. Aber sein aristokratischer Instinkt verriet ihm, daß durch die neuere Literatur und Philosophie die Ordnung, wie er sie verstand, gefährdet wurde. Den Aufflug des deutschen Geistes hat er nicht mehr zu erkennen vermocht. →Lessing, →Herder, →Winckelmann hätte er nach Berlin ziehen können. 1780 verfaßte er seine Schrift „De la littérature allemande“. Die Beispiele, die er für die deutsche Rückständigkeit anführte, waren willkürlich und wenig überzeugend, sie verrieten geringe Sachkenntnis. In seiner Ablehnung des „Götz“ und →Shakespeares stand er allerdings nicht allein. Als Voraussetzung für Ebenbürtigkeit mit französischer Kultur forderte F. die Erziehung zum Geschmack, die Reinigung und Veredelung der deutschen Sprache. Er kündete jedoch bereits die Morgenröte einer besseren Zeit an. Die Schrift rief in der deutschen Bildungswelt Entrüstung und Ablehnung hervor. →Justus Möser schrieb eine Gegenschrift (1781). Trotzdem wird F.s indirekter Einfluß auf die deutsche geistige Bewegung nicht zu unterschätzen sein. →Goethes bekannte Bemerkung in „Dichtung und Wahrheit“, daß erst durch F. und die Taten des 7jährigen Krieges der erste und höhere eigentliche Lebensgehalt in die deutsche Poesie gekommen sei, mag vielleicht etwas übertrieben sein. Aber schon sein Dasein wirkte anregend und aufreizend, gleichgültig wie man zu ihm stand. Die deutsche Aufklärung konnte ihn vollends nicht übersehen. In Berlin begann sich ein reges geistiges Leben zu entwickeln, das allerdings erst nach seinem Tode zur vollen Entfaltung kam.
F. galt in den Augen des Volkes nach dem 7jährigen Krieg als der „Alte Fritz“. Die seelischen Belastungen des Krieges hatten ihm hart zugesetzt, die Schroffheit seines Wesens hatte merklich zugenommen, er hatte keine Freunde mehr; seine Menschenverachtung stand in einem eigentümlichen Widerspruch zu der unablässigen Fürsorge für sein Volk. Fehlte es ihm, wie oft behauptet worden ist, durchaus an Güte und Gemüt? F. konnte sehr hart, ja ungerecht gegen alle diejenigen sein, denen er irgendein Amt aufgetragen hatte. Er glaubte von den anderen Menschen das gleiche wie von sich selbst verlangen zu müssen. Aber für den kleinen Mann empfand er zum mindesten Mitleid. Solchen Menschen konnte er freundlich, ja warmherzig begegnen, die Briefe an seinen Kammerdiener →Fredersdorff bezeugen das eindrucksvoll. Seine Maßnahmen waren durchaus nicht ausschließlich dem Staatszweck unterworfen; der König war auch dann hilfsbereit, wenn es echte Not zu lindern galt. Man könnte meinen, daß er geradezu darauf ausging, zwischen sich und den Mitmenschen eine Schranke zu errichten und sich mehr zu isolieren, als nötig war. F. hätte geliebt werden können. Wenn er wollte, konnte seine Persönlichkeit einen unwiderstehlichen Zauber ausstrahlen. Wieviele haben auf ein einziges freundliches Wort von ihm gewartet. Hat er sich bewußt gegen die weicheren Seiten seines Wesens abzuschätzen gesucht? Popularitätshascherei fand er eines Königs unwürdig. Die größte Wirkung ist von dem Vorbild ausgegangen, das F. seinem Lande gab. Er war allgegenwärtig. Auf zahlreichen Reisen überzeugte er sich durch Augenschein von der Durchführung seiner Befehle. Mit seinen Beamten stellte er förmliche Examen an, er verlangte genaueste Kenntnisse. Es war schwer, ihn zufriedenzustellen. Bei militärischen Besichtigungen war es das Gleiche, sie waren fast mehr gefürchtet als der Krieg; Kinder von Kommandeuren haben vorher darum gebetet, daß der Vater seine Stellung behalten möge. Aber des Königs ungeheure Arbeitsleistung war ein ständiger Ansporn. Das gemeine Volk hatte unbegrenztes Vertrauen in die Gerechtigkeitsliebe des Königs, wie es in den zahlreichen Anekdoten zum Ausdruck kommt, die noch anderthalb Jahrhunderte später selbst in den untersten Volksschichten von Mund zu Mund gingen. Wenn auch der Druck des Despotismus von vielen als unerträglich empfunden worden ist, hat sich doch bei Beamten und Offizieren das Staatsethos weiter verstärkt, der Sinn für den Vorrang des Gemeinwohls. Wie schon sein Vater, gab F. durch sein Beispiel dem Wort „dienen“ eine Würde, die es im üblichen Sprachgebrauch nicht besitzt.
F. ist von der Mit- und Nachwelt sehr verschieden beurteilt worden. Die Meinungen schwanken bis zum heutigen Tage zwischen Bewunderung, kühler Achtung, Ablehnung und sogar Abscheu. Das Urteil über F. ist gewissermaßen ein Spiegelbild der geistesgeschichtlichen Wandlungen. Er stand zwischen 2 Epochen. Er durchlebte den Widerstreit zwischen Macht und Recht, zwischen Gewalt und Humanität, zwischen Freiheit und Notwendigkeit in ungewöhnlicher Stärke. Es wird immer notwendig sein, sich mit dem Menschen und Staatsmann kritisch auseinanderzusetzen. Eine so außerordentliche Erscheinung wie F. muß aber im Zusammenhang mit der abendländischen Geschichte gesehen werden. Die geistige Ruhelosigkeit und die moralische Aktivität, die Europas Ehre und Gefahr ausgemacht haben, konnten sich von Zeit zu Zeit in einer einzigen Persönlichkeit in solchem Übermaß verdichten, daß sie das Gefäß manchmal sprengten. Angesichts starker Gegengewichte konnte es bei F. dazu nicht kommen. Aber vielleicht stand er nicht an dem seinem Genie angemessenen Platz? F.s Entwicklung wurde nicht nur durch seine unglückliche Jugend gehemmt. Es läßt sich vielleicht sagen, daß F. die räumliche Enge und die ständige Gefährdung seines Staates die volle Entfaltung aller seiner Anlagen und Talente nicht erlaubt haben. Die Wirkung ging von der Gesamterscheinung aus; der schöpferische Impuls war in den inneren Spannungen seines Wesens begründet. Keinesfalls darf er nur als der Funktionär einer seelenlosen Maschinerie gesehen werden. In seinem Staat wirkte eine geistige und sittliche Energie fort, wie sie in der großen Reformzeit so eindrucksvoll zutage trat. Preußen war durch F. noch nicht in einer|bestimmten Richtung für alle Zukunft festgelegt. Es blieben noch andere Entscheidungsmöglichkeiten offen. Gegenüber einer rein negativen Kritik behält noch immer das Wort seine Gültigkeit, das im Angesicht von F.s Totenmaske einem Kritiker zugerufen worden sein soll: „Sehen sie erst so aus – dann mögen Sie ihn verurteilen.“
-
Works
Œuvres de Frédéric le Grand, hrsg. v. J. D. E. Preuß, 30 Bde., 1846 ff., dt. hrsg. u. eingel. v. G. B. Volz, 10 Bde., 1912 ff.;
Polit. Korr., Bd. 1-44 (1740-82), 1879-1939, Erg.Bd. Die pol. Testamente F. d. Gr., ed. G. B. Volz, 1920;
Preuß. Staatsschrr. aus d. Regierungszeit Kg. F. II., hrsg. v. R. Koser u. O. Krauske, 3 Bde., 1877 ff.;
G. B. Volz, F. d. Gr. im Spiegel s. Zeit, 3 Bde., 1926-27;
Miscellaneen z. Gesch. Kg. F. d. Gr., 1878 (enthält sämtl. Ausgg. u. Überss. d. W bis zu diesem Zeitpunkt). Briefwechsel, Memoiren u. Tagebücher v. Zeitgenossen s. DW 11807-34, Nachträge: W. Kratz, Ungedr. Briefe F.s d. Gr., in: Archivum hist. Societatis Jesu 1, Rom 1932, S. 281-91;
G. B. Volz, Ungedr. Briefe u. Dichtungen F.s d. Gr., in: FBPG 33, Bd. 45, 1933, S. 366-74;
Um e. dt. Prinzessin, Ein Briefwechsel F.s d. Gr., d. Landgfn. Karoline v. Hessen-Darmstadt u. Katharinas (Ekaterina) II. v. Rußland (1772–1774), übers. u. hrsg. v. Gfn. A. Keyserling, 1935;
Die Randbemerkungen F.s d. Gr., ges. u. erl. v. G. Borchardt, 1936;
beste krit. Ausg. d. Antimachiavell in: Studies on Voltaire and the eighteenth Century, ed. W. T. Westerman, V, Genf 1958. -
Literature
(in Auswahl) ADB VII (Ranke);
L. v. Ranke, F. II., = Sämtl. Werke 51 u. 52, 1888;
H. G. R. de Mirabeau, De la monarchie Prussienne sous Frédéric le Grand, 7 Bde., London 1788, auch dt. (wichtigste zeitgenöss. Kritik);
T. B. Macaulay, in: Essays, 1843, dt. u. d. T. Pol. u. Moral, 1947 (typisch f. d. engl. Liberalismus);
R. Koser, Kg. F. d. Gr., 4 Bde., ⁷1925 (Standardwerk, L);
O. Klopp, Kg. F. II., 1860, ²1867 (sehr kritisch, großdt. Standpunkt);
Th. Carlyle, History of Frederick II of Prussia, 6 Bde., London 1858–65, dt. 6 Bde., 1858-69 (Heroenkult);
W. F. Reddaway, Frederick the Great and the rise of Prussia, ebd. 1904, ²1926;
A. Berney, F. d. Gr., 1934 (b. z. 7j. Krieg, wichtig f. geistige Entwicklung);
G. Ritter, F. d. Gr., ³1954;
W. Elze, F. d. Gr., ²1939 (dt.-nat. Gesichtspunkt);
P. Gaxotte, F. d. Gr., Paris 1938 (dt. ²1940);
G. P. Gooch, F. d. Gr., London u. New York 1947, dt. 1950. – Kronprinzenzeit: E. Lavisse, La jeunesse du Grand Frédéric, Paris ³1899;
C. Hinrichs, Der Kronprinzenprozeß, 1936. – Geistige Welt u. Staatsanschauung: E. Zeller, F. d. Gr. als Philosoph, 1886;
W. Dilthey, F. u. d. dt. Aufklärung, in: Ges. Schrr. III, 1927;
F. Meinecke, Die Idee d. Staatsräson in d. neueren Gesch., 1924;
H. H. Jacobs, F. d. Gr. u. d. Idee d. Vaterlandes, 1939;
E. Spranger, Der Philosoph v. Sanssouci, in: Abhh. d. Ak. Berlin, 1942; s. auch Ueberweg III, S. 474 f., Ziegenfuß, S. 361 f. (L). – Verhältnis z. Kunst:
G. Thouret, F. d. Gr. als Musikfreund u. Musiker, 1898;
P. Seidel, F. d. Gr. u. d. bildende Kunst, ²1924;
s. a. ThB XII, XXI (unter Knobelsdorff);
H. Becker, in: MGG IV, Sp. 955-62 (W, L). – Verwaltung, Wirtsch.pol., Strategie: Acta Borussica;
G. Schmoller, Unterss. z. Vfg., Verwaltung u. Wirtsch.gesch. d. preuß. Staaten im 18. u. 19. Jh., 1898;
Th. v. Bernhardi, F. d. Gr. als Feldherr, 2 Bde., 1881;
z. Kontroverse üb. F.s Strategie s. Koser, a.a.O., IV, S. 71-74;
F. v. Boetticher, F. d. Gr., in: Führertum, hrsg. v. F. v. Cochenhausen, 1930 (P). – Neuerscheinungen u. a. W. Bussmann, F. d. Gr. im Wandel d. europ. Urteils in Dtld. u. Europa, in: Festschr. Rothfels, 1951;
M. Braubach, Versailles u. Wien v. Ludwig XIV. bis Kaunitz, 1952;
W. Mediger, Moskaus Weg nach Europa, 1952;
St. Skalweit, Frankreich u. F. d. Gr., 1952;
K. E. Born, Der Wandel d. F.-Bildes in Dtld. während d. 19. Jh., Diss. Köln 1953 (ungedr.);
W. Hubatsch, Das Problem d. Staatsräson b. F. d. Gr., 1956;
W. Martineit, Die friderizian. Verwaltung v. Ostpreußen, 1958;
DW 11922-12017;
G. Franz, Bücherkde. z. dt. Gesch., 2361-76;
Gebhardt, Hdb. z. dt. Gesch. II 1955, S. 271. – Zu Elisabeth Christine: ADB VI;
E. Poseck, Die Kronprinzessin…, 1940 (L, P). -
Portraits
Das Bildnis F. d. Gr., Zeitgenöss. Darst., 1942 (naturgetreue P nur aus d. Kronprinzenzeit, vor allem v. A. Pesne. Augen blau, oft braun gemalt;
Foto Marburg);
Totenmaske v. J. Eckstein (früher Berlin, Schloß Monbijou);
E. v. Campe, Die graph. Porträts F.s d. Gr. aus s. Zeit u. ihre Vorbilder, 1958. -
Author
Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode -
Citation
Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu, "Friedrich der Große" in: Neue Deutsche Biographie 5 (1961), S. 545-558 [online version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118535749.html#ndbcontent
-
Friedrich II.
-
Biography
Friedrich II., König von Preußen, ist am 24. Januar 1712 im Schlosse zu Berlin geboren worden. Seine Geburt wurde von seinem Großvater Friedrich I., welcher sich hauptsächlich darin glücklich fühlte, daß er dem Hause Brandenburg die königliche Würde verschafft hatte, mit Freude begrüßt, weil ihm in dem Sohne seines einzigen Sohnes ein fernerer Erbe der neuen Krone geboren war. Nur in der Familie aber ward dieß eigentlich beachtet; denn die Krone war noch schwach und nach allen Seiten hin abhängig. — Als Friedrich II. am 17. August 1786 in Sanssouci starb, hatten Europa und Amerika ihre Augen auf diesen Platz geheftet; ein Staat war geschaffen, welcher der königlichen Würde allgemeine Bedeutung gab. Friedrich II. hatte sich einen Ruhm erworben, der die Welt erfüllte. Manchem Fürsten ist der Name des Großen nur bei seinen Lebzeiten beigelegt, dann aber wieder weggelassen worden; Friedrich II. hat denselben bei der Nachwelt behauptet.
Niemand wird in dem Artikel einer allgemeinen deutschen Biographie sich über die einzelnen Ereignisse eines Regentenlebens, wie dieses war, unterrichten zu können erwarten; auch Der, der einen solchen zu schreiben unternimmt, würde nicht daran denken können, die Wißbegier in dieser Ausdehnung zu befriedigen; es kann nur darauf ankommen, eine Gesammtanschauung der politischen Handlungen Friedrichs und seiner kriegerischen Thaten zu gewinnen und der Nation vorzulegen.
Friedrich II. hat in seiner Jugend sehnlich gewünscht, sich mit einer englischen Prinzessin zu vermählen, andere dachten ihm die Erbtochter von Oesterreich, noch andere die Thronfolgerin von Rußland zu. Aber Friedrich's Bestimmung war es, in der Mitte dieser Potenzen, im Kampfe besonders mit den beiden Kaiserinnen von Rußland und von Oesterreich eine selbständige Macht zu gründen.
Die Mittel dazu lieferte ihm sein strenger Vater, Friedrich Wilhelm I., der die preußische Armee zwar nicht von Grund aus geschaffen, aber doch in der ihr dann gebliebenen Form eingerichtet und durch den Staatshaushalt, den er einführte, aufrecht zu erhalten verstanden hat.
Friedrich Wilhelm I. sagt in seinem, schon 18 Jahre vor seinem Tode abgefaßten politischen Testamente, sein Großvater habe das Haus Brandenburg in Aufnahme gebracht, sein Vater demselben die königliche Würde verschafft, er selbst Armee und Land in Stand gesetzt, an seinem Sohne sei es nun, zu behaupten, was seine Vorfahren erworben, und dasjenige herbeizuschaffen, was ihm von Gott und Rechtswegen gehöre. Für diesen Beruf dachte er den Sohn zu erziehen; er hielt ihn vor allen Dingen von Kindheit auf zu militärischen Uebungen an, denn einen Offizier wollte er aus ihm bilden, wie seine besten Offiziere waren, und einen solchen, der einmal die Armee ins Feld führen könne. So sollte er auch in geistigen und in geistlichen Dingen sich als Nachkomme und Fortsetzer erweisen: bibelgläubig zwar nach der calvinistischen Auffassung, aber doch in einem der wichtigsten Dogmen nach lutherischer Form; so sollte er sich auch an den kaiserlichen Hof halten, von dem das nächste Anrecht des Hauses, der Erbanspruch an Berg, soeben garantirt worden war. Indeß der Sohn, in vielem folgsam und gelehrig, entwickelte doch in der Tiefe eine andere Gesinnung; er war mit vollem Eifer Soldat, aber er hielt es nicht für seine ausschließliche Bestimmung das zu sein, er suchte sich selbst zu unterrichten und auszubilden, hauptsächlich durch Lectüre französischer Bücher, poetischer namentlich, in deren Nachahmung er sich bereits versuchte. Die Phantasien der Jugend zogen ihn mehr nach St. James, als nach der Hofburg in Wien, zwei politischen Mittelpunkten, die eben in den heftigsten Gegensatz geriethen. Während der König zu Oesterreich, dem Kaiser hielt, war sein Sohn, wie der Hof überhaupt, mehr eingenommen für England, wie denn seine Mutter Sophia Dorothea eine hannoverisch-englische Prinzessin war. Diese Differenz aber zwischen dem aufbrausenden, unnachsichtigen Vater, der seine Familie und sein Land ganz nach seinem Sinne zu lenken wünschte, und dem Prinzen, der seinem eigenen Genius folgte und abweichende Gesichtspunkte ins Auge faßte, brachte eine Krisis hervor, welche einen funesten Ausgang zu nehmen drohte. Ungeduldig über den Druck, der ihm auferlegt wurde, und zugleich in seinem Ehrgefühl beleidigt, faßte der Sohn den Entschluß, den Vater zu verlassen. Es war auf einer Reise, welche König Friedrich Wilhelm I, eigentlich im Interesse des Kaisers, nach Oberdeutschland unternahm, im Juli 1730, daß der Prinz sich Pferde verschaffte, um aus dem Nachtlager, das in dem Dorfe Steinfurt bei Mannheim genommen wurde, davon zu reiten, noch ehe der Vater aufbrach. Allein er war viel zu gut überwacht, als daß er das hätte ausführen können; das Vorhaben aber wurde ruchbar,|weil der Page, der die Pferde herbeigeführt, Reue fühlte und dem Könige kurz darauf Alles entdeckte. Friedrich Wilhelm I., der darin eine Handlung politischer Widersetzlichkeit und zugleich ein Verbrechen gegen die militärische Disciplin erblickte, gerieth in die heftigste Aufwallung und ließ seinen eigenen Sohn vor ein Kriegsgericht stellen. So weit ist es nicht gekommen, was man oft gesagt hat: der König habe seinen Sohn hinrichten lassen wollen und sei nur durch die Dazwischenkunft des Kaisers und anderer befreundeter Fürsten davon abgehalten worden.
Das Kriegsgericht fand in der Handlung nicht einmal eine Desertion, da das Vorhaben nicht zur Ausführung gekommen war; in die Streitigkeiten zwischen Vater und Sohn sich einzulassen, vermied es, weil das den Mitgliedern als Unterthanen nicht zukommen würde; es findet sich nicht, daß der König etwas dagegen eingewendet hätte, und Friedrich war viel zu besonnen, als daß er ein Wort sich hätte entschlüpfen lassen, was auf die politischen Verhältnisse Bezug gehabt hätte. Ganz anders aber sah der König das Verhalten eines früheren Vertrauten des Kronprinzen, Katte, an, welcher um das Vorhaben wußte und für das Gelingen desselben außerordentliche Vorbereitungen getroffen hatte; er gab ihm das Verbrechen der beleidigten Majestät schuld und ließ sich nicht abhalten, ihn dafür zum Tode zu verurtheilen. Welch' eine Strafe für den Prinzen, daß er gezwungen wurde, aus dem Fenster seines Gefängnisses in Küstrin die Vorbereitungen zur Hinrichtung seines Freundes anzusehen; er fiel in Ohnmacht, ehe sie vollzogen wurde. Aber er selbst fürchtete seinen Tod.
Er sah sich wegen einer geringen Schuld mit dem schwersten Verluste heimgesucht, mit der äußersten Gefahr bedroht; wenn etwas hätte erdacht werden sollen, um einem jungen Menschen den Ernst des Lebens zum Bewußtsein zu bringen, so hätte sich nichts Geeigneteres auffinden lassen. Die Disciplin des Schreckens stählte die Seele Friedrichs, die dadurch doch nicht unterjocht wurde. Er war genöthigt, dem Willen des Vaters in jeder Beziehung nachzuleben und sich die Aussöhnung mit demselben zu verdienen. Er nahm eine Gemahlin nicht nach seiner Wahl, sondern der des Vaters. Zusammenleben konnten Vater und Sohn seitdem nicht weiter. Der Prinz commandirte fortan sein Regiment in Ruppin; den militärischen Pflichten kam er mit pünktlichem Gehorsam nach; er machte im J. 1734 den kurzen Feldzug der Kaiserlichen unter dem Prinzen Eugen, an dem die Preußen theilnahmen, mit; er gab bei kleinen zufälligen Ereignissen viel persönliche Unerschrockenheit kund. Die Hauptsache war, daß er den berühmten Kriegführer kennen lernte. Dann aber zog er sich auf seinen Landsitz Rheinsberg zurück, um sich mit seiner Musik und seinen Büchern zu beschäftigen; mit den Studien der früheren Jahre machte er nun Ernst; sie erhoben ihn über den geistigen Horizont seines Vaters. Er bewegte sich nicht mehr in den erwähnten confessionellen Streitfragen, sondern in den noch umfassenderen, zwischen Deismus und dem positiven Christenthum; die aufkommenden philosophischen Doctrinen ergriff er mit empfänglichem Verständniß; nachdem er sich eine Zeit lang mit dem Wolff’schen System befreundet hatte, ging er zum Ideenkreis Locke's über.
In Dem aber löste sich das gute Verhältniß zwischen dem kaiserlichen Hofe und Friedrich Wilhelm I auf; es beruhte einzig darauf, daß dem König auf die Succession von Berg sichere Zusagen gegeben worden waren; in den späteren politischen Verwickelungen aber fand es der kaiserliche Hof unthunlich, dieselben zu erfüllen. Friedrich Wilhelm I. gerieth, als er sich enttäuscht sah, in Entrüstung, so daß er nun in der wenngleich eigenartigen Ausbildung des Sohnes selbst eine Art von Trost erblickte; er hat wohl gesagt: der würde ihn rächen.
Noch unmittelbar vor seinem Tode hat der Vater den Sohn in das Geheimniß|der politischen Lage eingeweiht; er gab ihm dabei, wenn er dessen noch bedurfte, die Anweisung „vollkommen auf eigenen Füßen zu stehen“.
So gelangte Friedrich zur Regierung, 31. Mai 1740. Davon aber, daß Preußen Ursache habe, sich an Oesterreich zu rächen, sind seine ersten Beschlußnahmen nicht ausgegangen. Vorlängst hatte sich Friedrich die politische Lage des Landes, das ihm zufiel, überlegt; er hatte die Meinung, daß es so nicht bleiben könne, wie es war, daß er im Osten Westpreußen, das noch polnisch war, und im Westen das Gesammtgebiet von Jülich und Berg erwerben müsse, wenn sein Staat zu einer wirklichen Bedeutung gelangen solle; auch waren die ersten Handlungen seiner Regierung nach den westlichen Regionen gerichtet, wo er nur zeigen wollte, daß er ein kräftigeres Regiment nach Außen hin führen werde, als sein Vater. Die Richtung gegen Oesterreich entsprang in ihm in dem Augenblicke, als Kaiser Karl VI. starb.
Durch diesen Todesfall veränderte sich die Gesammtlage. Das große Haus, welches Spanien und Indien, Italien und die Niederlande beherrscht und unter dem sich eine neue österreichische Macht in Deutschland, Ungarn und Böhmen gebildet hatte, ging nun in seinem Mannesstamme vollkommen zu Ende. Der Abgang der älteren, der spanischen Linie hatte einen europäischen Krieg veranlaßt; wie durfte man erwarten, daß der Abgang der zweiten ohne große Erschütterungen vor sich gehen würde! Zwar hatte der Wiener Hof Alles gethan, um die Nachfolge in den Erblanden für die Erbtochter Karls VI., Maria Theresia, zu sichern; allein das lief doch dem in den deutschen Landen seit alten Zeiten üblichen Erbfolgerecht entgegen. Ein großes deutsches Haus, das bairische, machte Ansprüche, die ihm gerade für diesen Fall, so behauptete es, zugesichert worden seien. Es ließ sich nicht denken, daß Frankreich den Gemahl Maria Theresia's, der aus dem Hause Lothringen stammte, zur kaiserlichen Krone gelangen lassen sollte: denn dadurch würden die Ansprüche dieses Hauses wieder erneuert worden sein; ein Kaiser aus demselben, der zu wirklicher Macht gelangt wäre, würde den Franzosen den Besitz von Lothringen auf das Ernstlichste streitig gemacht haben. Und ohne Zweifel hätte England, in neuen Zerwürfnissen mit den bourbonischen Mächten begriffen, in einem solchen Kampfe für Oesterreich Partei genommen; der Krieg der alten großen Allianz gegen Frankreich mußte sich alsdann erneuern. Und durfte man nicht erwarten, daß auch Preußen, wie in dem letzten Feldzug, die Partei von Oesterreich ergreifen würde? Hatte es doch die pragmatische Sanction, welche der Erbtochter die Nachfolge versichern sollte, förmlich angenommen. Der junge König war nicht dieser Meinung; denn Oesterreich selbst hatte die Verbindlichkeiten gebrochen, an welche die Versicherung der Nachfolge Maria Theresia's geknüpft war. Nicht eigentlich Haß war dadurch in dem Hause Brandenburg entstanden, aber es fühlte sich von den Verpflichtungen frei, die es eingegangen hatte, und Friedrich faßte nun bei dem Schwanken aller großen Verhältnisse sein eigenes Interesse ins Auge.
Von alter Zeit her hatte Brandenburg Erbansprüche an drei schlesische Herzogthümer, die von der Krone Böhmen, zu welcher Schlesien gehörte, anerkannt worden waren, noch ehe Böhmen an das Haus Oesterreich gelangte; die Kaiser-Könige von Böhmen hatten dieselben für ungültig erklärt, Brandenburg immer daran festgehalten; nach dem Abgange der Habsburger glaubte der junge König darauf zurückkommen zu können. Und noch ein anderer Hader entzweite die Häuser: in den Zeiten der allgemeinen politisch-religiösen Bewegungen, die dem dreißigjährigen Kriege vorangegangen waren, hatte Brandenburg durch die Erwerbung des Fürstenthums Jägerndorf eine sehr bedeutende Stellung für Schlesien und selbst für Böhmen erworben, aber die großen Entscheidungen des Krieges zu Gunsten des Katholicismus hatten Brandenburg nicht allein dieser Stellung,|sondern auch jenes Territoriums beraubt. Oesterreich hat das brandenburgische Anrecht nie geleugnet; es war der Anspruch, für welchen der große Kurfürst durch Ueberlassung des Kreises Schwiebus hatte entschädigt werden sollen; da aber dies Gebiet später hatte zurückgegeben werden müssen, so hielt man dafür, daß das alte Recht wieder zur Geltung gelangt sei. Und keineswegs waren diese Ansprüche bei dem Hause Brandenburg seitdem in Vergessenheit gerathen; schon Kurfürst Friedrich Wilhelm hat an eine Invasion in Schlesien gedacht. Man darf nicht bezweifeln, daß der Entwurf dazu, der zu den geheimsten Papieren gehörte, die von Fürst auf Fürst übergingen, dem neu eintretenden König bekannt geworden ist. Vergegenwärtigen wir uns einen jungen Fürsten, voll von Geist und Ehrgeiz, in den Besitz von Rechten gelangt, die seine Vorfahren niemals hatten durchführen können, aber auch in den Besitz der Macht, dieselben durchzuführen. Lag es nicht in der Natur der Sache, daß er den Entschluß faßte, sie zur Geltung zu bringen? Er machte der Tochter des Kaisers ihre Erbfolge nicht streitig, aber er meinte, daß die schlesischen Fürstenthümer gar nicht das wahre Eigenthum ihres Vaters gewesen seien; er vindicirte seinem Hause ein unverjährbares Recht an dieselben, für dessen Ausführung nun die Zeit gekommen sei. Noch in Rheinsberg ist er darüber mit dem Feldmarschall Schwerin und dem Minister Podewils zu Rathe gegangen, jedoch nicht sowohl über die Sache selbst, über die sein Entschluß vom ersten Augenblicke an feststand, als über die Mittel, sie in's Werk zu setzen. Da boten sich nun zwei sehr verschiedene Möglichkeiten dar.
Maria Theresia konnte durch die Gefahr, in der sie sich befand, und das Bedürfniß einer starken Hülfe, wenn Friedrich ihr eine solche anbot, sich bewogen fühlen, seinen schlesischen Ansprüchen gerecht zu werden. Friedrich II. und seine Rathgeber meinten jedoch, dies nicht etwa abwarten zu müssen, denn mit Unterhandlungen würde nichts zu erreichen sein; sie zogen es vor, die Fürstenthümer, auf welche der König rechtlichen Anspruch habe, in Besitz zu nehmen; würde dann der Hof zu Wien darin eine Feindseligkeit sehen, so bleibe der ganz entgegengesetzte Weg immer noch offen, sich mit dessen Feinden zu verbinden; dann werde Preußen den Anspruch, den es eigenmächtig geltend mache, auch durch offene Gewalt behaupten.
Es ist ein Irrthum, wenn man angenommen hat, daß Friedrich II. im Voraus mit Frankreich einverstanden gewesen sei; mit voller Wahrheit konnte er den Truppen, die er zu der Unternehmung in Krossen vereinigte, sagen, er habe keine andern Verbündeten als sie. Am 16. Dec. 1740 überschritten die preußischen Truppen die Grenze und fanden in Schlesien Verbündete, die der König nicht erwartet hatte. Man möchte fast sagen, der dreißigjährige Krieg ging dort noch immer fort: denn die Restauration des Katholicismus, die in jener Epoche in Böhmen durchdrang und dann auch in Schlesien unternommen wurde, war doch hier auf mannigfaltigen Widerstand gestoßen; sie war von Karl XII. bei seinem Vordringen nach Sachsen inhibirt worden, allein bei dem Beginn der neuen Regierung schien sie wieder in Angriff genommen zu werden; sie glaubte an jene schwedische Convention nicht mehr gebunden zu sein. Das Vorrücken österreichischer Truppen, denen man die Absicht gewaltsamer Conversion zuschrieb, erweckte ängstliche Besorgnisse, als das preußische Kriegsheer eindrang. Die Truppen der Königin und Landesfürstin wurden als Feinde, die des Königs, der Schlesien erobern wollte, als Freunde und Erretter betrachtet; in der Landeshauptstadt Breslau wirkte noch ein anderes Motiv, das der städtischen Gerechtsame, mit dem religiösen zusammen. Auch in Breslau wurde der König bei seiner Ankunft willkommen geheißen. Er hatte binnen wenigen Wochen Schlesien so gut wie|erobert; Schwerin occupirte die Grenzplätze am Gebirge. Nie wurde eine gewaltsame Besitzergreifung friedlicher vollzogen.
Nachdem die Preußen Glogau eingenommen hatten, hat man in der Umgegend ihren Sieg mit evangelischen Dankfesten gefeiert. Der evangelische Theil der Bevölkerung schloß sich an und gelangte zu den Rechten, die ihm entzogen oder doch verkümmert worden waren. Den Katholischen wurde Toleranz verheißen: denn die Besitznahme war nicht darauf berechnet, den alten religiösen Streit wieder zu erneuern. Friedrich II. wollte das ganze Gebiet, wie es vor ihm lag, unterworfen halten. Die Toleranz, die seiner Gesinnung entsprach, war hier zugleich von der Politik geboten. Nur so viel ist klar, daß das katholische Element das Uebergewicht verlor, das es seit dem dreißigjährigen Kriege in dieser Provinz behalten hatte. Die Idee des Staates, der doch ein protestantischer war, förderte die Gleichberechtigung der Bekenntnisse.
Eigentlich war das Ziel schon erreicht, ehe noch der wahre Kampf begann. Eine Zeit lang hoffte Friedrich II., seine Erwerbung, wenn nicht vollständig, doch in großem Umfang mit der Einwilligung des Wiener Hofes zu behaupten. Auch wären die alten Minister, welche in der Erinnerung an die große Allianz lebten, nicht abgeneigt gewesen, auf die Anträge des Königs von Preußen einzugehen. Ihr jüngster College jedoch, Bartenstein, widerstrebte ihren Ansichten; er rechnete darauf, daß Frankreich für Oesterreich sein werde, so daß es der Allianz mit England nicht bedürfen würde. Und dem nun schloß sich die junge Königin an; sie war von Natur mit allen Gaben einer Regentin ausgerüstet, sie vereinigte die Tugenden einer Hausfrau und Mutter mit der Entschlossenheit einer großen Fürstin; sie war fähig, die Deliberationen ihrer Minister zu leiten, nicht jedoch, ohne daß sie bei ihren Entscheidungen persönlichen Impulsen Raum gegeben hätte. Sie scheute nicht vor extremen Entschlüssen zurück; von dem Selbstgefühl ihrer Stellung nahm sie die Norm ihrer Handlungen. Ihr Erbrecht hielt sie für erhaben über allen Zweifel, jeden Angriff auf dasselbe zugleich für ein moralisches Verbrechen. In ihr wallte welfisches und habsburgisches Blut. Das Kaiserthum, das sie für ihren Gemahl zu erwerben hoffte, nahm sie gleichsam zum Voraus in Besitz. Die stolze Haltung ihres Hauses, das sich für das erste aller regierenden Häuser hielt, repräsentirte sich in ihr, noch verstärkt durch ihre Vermählung mit einem Fürsten aus dem Hause Lothringen, das seine Herkunft von →Karl dem Großen ableitete. So traten einander der junge König von Preußen und die junge Königin von Ungarn und Böhmen in entgegengesetzten Stellungen gegenüber; beide in der Blüthe ihrer Jahre, der König von seinen Ansprüchen, die Königin von ihren Rechten durchdrungen, der König seinem Bekenntniß nach Protestant und seiner Ueberzeugung nach Deist, mit der Bewegung der Geister nach unbekannten Zielen hin einverstanden; die Königin, katholisch gläubig den ererbten Ideen des österreichischen Hauses gemäß und entschlossen, die Einheit der Religion in ihren Landen mit aller Macht aufrecht zu erhalten, so daß sie doch auf den Spuren Ferdinands II. einherging, während sich Friedrich II. von den Spuren seiner streng protestantischen Ahnherren entfernte. In diesem Augenblick stand Friedrich II. mit siegreichen Waffen bereits in Oberschlesien. Der russische General Münnich hat ihm wohl einen Vorwurf daraus gemacht, daß er nicht sogleich bis nach Wien vorgedrungen sei und dem ganzen Streit auf einmal ein Ende gemacht habe; diese Art von Ehrgeiz aber lag nicht in Friedrich II. Er wollte nur eben den Anspruch durchführen, den er von seinen Altvordern überkommen hatte, wobei er denn auch der von dem Hause Oesterreich aus dem Lande, das ihm nicht gehört habe, unrechtmäßig bezogenen Einkünfte gedachte, und so mächtig genug werden, um eine unbedingte Selbständigkeit zu behaupten; Oesterreich zu stürzen, war er nicht gesonnen. Aber ein beschränkter Anspruch|ist zuweilen noch schwerer durchzuführen, als ein unbeschränkter. Friedrich II. hatte den schwersten Kampf zu bestehen.
Die erste Armee, welche Oesterreich ins Feld brachte, um ihn aus dem ergriffenen Besitz wieder zu vertreiben, wurde dem König Friedrich II. doch sehr gefährlich. Die geschickte Strategie des Generals Neipperg brachte die preußischen Stellungen in Unordnung, so daß diese mit der Stirne gegen Berlin gewandt vorrücken mußten, und unbezweifelt war die Ueberlegenheit der nationalen Reiterschaaren, die Neipperg ins Feld führte. Bei Mollwitz am 10. April 1741, wo die Heere zusammenstießen, war der Vortheil eine Zeit lang auf österreichischer Seite, so daß der König von seinen Generalen genöthigt wurde, sich aus dem Getümmel des Schlachtfeldes zu entfernen, um seine Person, an der Alles liege, zu retten. Aber die eigentliche Waffe der Preußen war die Infanterie, wie sie in der Schule des alten Dessauers eingeübt worden war. Vor ihrem Kleingewehrfeuer prallte der Angriff der Oesterreicher zurück; das vordringende mörderische Rollen desselben trieb sie dann in die Flucht.
Seitdem waren die Preußen Meister des Schlachtfeldes. Es war der Kampf eines in seiner Bildung begriffenen neuen Militärwesens, man möchte sagen, der militärischen Cultur, mit dem herkömmlichen der österreichischen Armee, welches den Sieg davontrug und die Besitznahme von Schlesien bestätigte. Der König war hierauf in seinem Feldlager unablässig beschäftigt, von seinem Zelt aus seine Armee fortzubilden, Herr und Meister bis in das geringste Detail des Dienstes, vor Allem beflissen, sich eine Reiterei zu schaffen, was für den weiteren Kampf unerläßlich war. Nothwendig gewann aber dieser Kampf bei seiner Fortsetzung eine unmittelbare Beziehung zu den andern, nunmehr in offenen Streit gerathenen Weltmächten. Maria Theresia hatte sich eine Zeit lang dadurch, daß die Haltung von Frankreich sehr zweideutig wurde, nicht irre machen lassen, auf die Fortdauer eines guten Verhältnisses zu dieser Macht zu trauen; endlich aber konnte sie sich darüber nicht mehr täuschen, daß der französische Hof die pragmatische Sanction nur unter einem Vorbehalte, der sie zerstören mußte, nämlich dem der Rechte Dritter, angenommen zu haben erklärte; er nahm sich der Prätensionen Baierns unumwunden an. Bei dem Zwiespalt, der eben zwischen den bourbonischen Mächten und England ausbrach, konnte sie nun allerdings auf England zählen, wo man ihr eine sehr lebhafte Theilnahme zu erkennen gab. Aber dadurch gerieth Friedrich II. wieder in die Nothwendigkeit, sich mit Frankreich zu verständigen, was er anfangs vermieden hatte; überzeugt, daß eine Verbindung der Engländer mit Oesterreich ihn in seinem Dasein bedrohen werde, schlug er sich auf die Seite der Franzosen. Eben in dieser Verbindung faßte er seine Forderungen in einer über die dynastischen Anrechte hinausgehenden Form zusammen.
Im Juni 1741 trat er mit Frankreich in ein Bündniß auf 15 Jahre, dessen vornehmste Bedingung dahin lautete, daß es ihm Niederschlesien und Breslau gegen Jedermann, wer es auch sei, garantire. So eben trat die in den Dingen liegende Tendenz vollständig zu Tage. Frankreich wendete Alles an, um die Rechte des Kurfürsten von Baiern auf die österreichischen Gebiete durchzuführen und diesen selbst zum Kaiserthum zu befördern.
Auch Bartenstein erblickte jetzt das Heil von Oesterreich in einer Erneuerung der alten großen Allianz gegen Frankreich; in diesem Gedanken selbst aber lag ein Rückhalt für Preußen. Eine große Allianz gegen Frankreich war unmöglich, weil Preußen, das ihr in einer früheren Periode zugehörte, die Waffen gegen Oesterreich ergriffen hatte. Das einzige Mittel der Vertheidigung gegen Frankreich lag nun doch darin, daß man die in den ersten unbestimmten Formen, in denen sie auftraten, verworfenen Ansprüche Preußens nunmehr in den bestimmteren. in denen sie gemacht wurden, anerkannte; dem doppelten Anfalle Preußens und der bourbonischen Bundesgenossenschaft zu widerstehen, war Oesterreich unfähig. Darin lag nun auch das große Interesse von England. Unter dem Andringen des englischen Botschafters fand sich Maria Theresia in diese Nothwendigkeit; sie verlangte nur ihrerseits, daß Preußen ihr zu Hülfe komme oder doch wenigstens neutral bleibe. Dazu aber hatte der König nunmehr wenig Neigung, denn Maria Theresia zeigte ihm einen tiefen und heftigen Widerwillen, den er für unversöhnlich hielt. Aber für ihn erhob sich jetzt eine andere Gefahr. Bei seiner Verbindung mit Frankreich hatte er die deutsche Idee, den Gedanken nämlich der fortdauernden Unabhängigkeit des Reiches nicht aufgegeben, denn so viel schien nicht daran zu liegen, ob die habsburgische oder die wittelsbachsche Dynastie im deutschen Reiche vorwalte. Einer französischen Uebermacht, die man einstweilen dulden müsse, meinte er sich in kurzer Zeit wieder entledigen zu können. Das war aber nicht der Sinn der französischen Regierung. Der umsichtige Cardinal Fleury, dem so Vieles gelungen war, indem er die verschiedenartigen Interessen gegen einander abwog, war nicht gewillt, Baiern so groß zu machen, daß ihm etwa eine neue Macht, wie die des Hauses Oesterreich in dem zum Kaiser erhobenen Kurfürsten hätte entgegentreten können. Allem Anschein nach hätte es nur bei den Franzosen gestanden, die Stammlande von Oesterreich und die Hauptstadt selbst in diesem Augenblicke zu erobern; aber indem die Dinge diesen Zug nahmen, standen die Franzosen von einem solchen Unternehmen ab.
Die Franzosen waren in demselben Falle wie Friedrich II.; sie hatten nur beschränkte Absichten, auch sie wollten Oesterreich nicht vernichten. Nicht sowohl das Haus Habsburg-Oesterreich war ihnen zuwider, als überhaupt eine centrale Macht in Deutschland, die sich ihnen entgegensetzen konnte. Ihr Gedanke ging dahin: drei oder vier ziemlich gleich starke Staaten in Deutschland zu errichten, von denen ihnen keiner für sich selbst jemals Widerstand zu leisten fähig gewesen wäre. Es war nicht sowohl eine Eröffnung geheimer Pläne, als das vor Augen liegende Verhalten Frankreichs, was dem König von Preußen diese Gefahr ins Bewußtsein brachte; er wollte, wie er sagt, nicht die Uebermacht von Oesterreich in Deutschland brechen, um französische Ketten zu schmieden. Aus diesen Betrachtungen und Gegensätzen ist der Vertrag zu Klein-Schnellendorf am 9. October 1741 entsprungen. Dem König wurde darin von Seiten Oesterreichs Niederschlesien und Breslau abgetreten; selbst Neiße, welches zur Vollendung seiner Eroberungen unentbehrlich war, wurde ihm überlassen. Dafür aber versprach er, gegen General Neipperg einstweilen keine Feindseligkeiten auszuüben; er ließ ihm vollkommen freie Hand gegen die Franzosen. Und war das nun nicht dasselbe, was Maria Theresia von ihm gefordert hatte, nämlich die Neutralität? Nicht ganz und gar; Friedrich II. behielt sich das tiefste Stillschweigen über das geschlossene Abkommen vor, eine in diesem Falle sehr wesentliche Bedingung; denn wenn es bekannt wurde, mußte er die Feindseligkeiten der Franzosen erwarten, während er sich doch auf die Freundschaft von Oesterreich nicht verlassen konnte. Eben darin liegt das Eigenthümliche seiner Stellung. Er durfte zwar die Franzosen über Oesterreich nicht Herr werden lassen, noch weniger aber zugeben, daß Oesterreich die Angriffe, die es erfuhr, siegreich abwehrte; denn die Königin würde dann ihre Waffen gegen ihn gewendet haben.
Die Abkunft von Klein-Schnellendorf hat für Oesterreich die glücklichsten Erfolge herbeigeführt; es konnte nun seine Macht ungetheilt gegen die Franzosen und Baiern wenden, denen es sich auch sofort gewachsen erwies. Seine Kräfte aber wurden dadurch verdoppelt, daß sich die Königin entschloß, zugleich|eine Vereinbarung mit den Ungarn zu treffen, welche zwar den monarchischen Rechten Abbruch that, aber den Enthusiasmus der Nation für die Königin erweckte und deren Streitkraft ihr dienstbar machte. Maria Theresia gelangte in den Stand, die Angriffe der Franzosen und ihrer Verbündeten mit Erfolg zurückzuweisen. Ein so vollkommener Sieg des Hauses Oesterreich aber, wie sich nach den Verhältnissen erwarten ließ, lag doch, wie berührt, wieder nicht in dem Sinne des Königs Friedrich. Gewiß, der Uebermacht der Franzosen wollte er ein Ziel setzen, aber die österreichische Uebermacht doch auch nicht herstellen; auch er faßte in dem Augenblicke den Gedanken, Sachsen und Baiern durch alte österreichische Gebiete zu verstärken; sie würden dann, da es durch seine Hülfe geschehen, allezeit von ihm abhängig geblieben sein; er dachte dabei zugleich seinen schlesischen Besitz auf immer zu befestigen, die Bedingung zur Vergrößerung seiner Nachbarn sollte ihre Einwilligung in die Verstärkung Niederschlesiens durch die Grafschaft Glatz und einen Theil von Oberschlesien bilden, ohne welche das erste gegen Oesterreich selbst nicht zu halten sein werde. In dieser Absicht ergriff er im Februar 1742 auf's Neue die Waffen und drang in Mähren ein; er fühlte sich dazu berechtigt, weil das ihm versprochene Stillschweigen keinen Augenblick beobachtet worden war, was dann nicht verfehlen konnte, ihn in Mißverständniß mit Frankreich zu bringen, so daß er der Besorgniß Raum gab, Frankreich könnte, durch ein eigenes großes Bündniß in dem nordischen Europa verstärkt, sich endlich sogar mit Oesterreich gegen ihn alliiren. Immer in der Anschauung der von allen Seiten drohenden Gefahr bewegt sich seine Politik. Mit Baiern und Sachsen vereinigt, würde er eine haltbare Stellung gegen Frankreich sowohl wie gegen Oesterreich haben behaupten können; allein so sicher waren diese Verbündeten nicht; es zeigte sich bald, daß die Baiern ohne die Hülfe der Franzosen schlechterdings sich nicht vertheidigen konnten. Die große Position, die Friedrich in Mähren einnahm, konnte er nicht behaupten, ohne sich selbst zu gefährden; wenn ihm aber Oesterreich jetzt anbot, ihm Niederschlesien durch einen förmlichen Friedensschluß abzutreten, so war ihm das doch in seiner Lage noch nicht genügend; er forderte nun von der Königin auch Oberschlesien und Glatz. Dagegen aber sträubte sich die Königin; sie machte nochmals einen Versuch, die preußische Armee zurückzuwerfen, der aber vollkommen mißlang. Die Schlacht von Chotusitz 17. Mai 1742 gewann Friedrich ohne seine beiden Feldmarschälle, mit einem schon von ihm umgeformten Heere, das er mit einer Genialität anführte, die sein angebornes strategisches Talent zuerst zur Erscheinung brachte. Maria Theresia wurde inne, daß sie den doppelten Feindseligkeiten von Frankreich und Preußen nicht widerstehen könne, und allmählich schwiegen ihre Bedenken. Auf den Rath der Engländer, die ihr in der entscheidenden Stunde nicht ohne große pekuniäre Aufwendungen zu Hülfe gekommen waren, fügte sie sich in die Abtretung von Schlesien in den Grenzen, welche Friedrich forderte, mit Glatz, dem Theil von Oberschlesien bis an die Oppa, so daß das vielbestrittene Jägerndorf ihr zuletzt doch verblieb. Darauf ging dann Friedrich unverzüglich ein; er ermächtigte seinen Minister in Breslau, auf diese Grundlage abzuschließen; es ist der Friede von Breslau (11. Juni 1742), der das Verhältniß der beiden deutschen Mächte auf immer bestimmt hat. Aus den dynastischen Ansprüchen hat sich der politische Gedanke herausgebildet. Niemals war eine Erwerbung für irgend einen Staat opportuner und wichtiger als für den preußischen die Eroberung Schlesiens, welches eine gleichartige Bevölkerung in Bezug auf Herkunft, Landesart, Religion in sich schloß und der preußischen Krone erst die Kräfte verschaffte, durch die sie sich anderen Kronen ebenbürtig zu einer europäischen Macht erhob, in der Mitte von Polen und Sachsen, die dadurch immer aus einander gehalten wurden, in der Mitte auch der Machtbezirke von Rußland und von Oesterreich. Soviel|Oesterreich an Ausdehnung verlor, so kann man doch sagen, daß die österreichische Monarchie in diesem Conflikte zu einer näheren Identificirung mit den Nationalitäten der Landschaften und Völker, aus denen sie sich zusammensetzte, gelangte. Von größtem Werth war für sie die erwachende Hingebung der Ungarn; in Böhmen und Oesterreich regten sich die katholischen Sympathien für das Erzhaus aufs Neue. Hier behauptete sich doch das im Laufe des dreißigjährigen Krieges gegründete System. Es ist die vornehmste Handlung Friedrichs II., daß er Schlesien diesem System entrissen und es mit seiner Krone verbunden hat; Action und Reaction hiegegen haben die Geschicke der beiden Mächte bestimmt. Und so war es wohl erlaubt, auch in einem kurzen Artikel von diesem Ereigniß eingehender zu handeln. Daran darf heut zu Tage Niemand zweifeln, daß die Unternehmung mit gutem Gewissen gewagt werden konnte; in der Natur der Sache liegt, daß ihr Widerstand geleistet war; Angriff und Vertheidigung waren beide gerechtfertigt. Doch liegt es auch in der Natur der menschlichen Verhältnisse, daß die große Frage durch Einen Frieden noch nicht definitiv entschieden wurde. Unentschieden blieb vor allem das Schicksal des deutschen Reiches; Oesterreich konnte und wollte nicht ertragen, von dem deutschen Kaiserthum ausgeschlossen zu sein, es ließ den bairischen Nebenbuhler das volle Uebergewicht seiner Waffen empfinden, und da nun der König von England, Kurfürst von Hannover, weit entfernt den Wittelsbachschen Kaiser anzuerkennen, vielmehr die Hülfsmacht, auf die derselbe sich stützte, aus allen Kräften bekämpfte und den Franzosen mitten in Deutschland eine Niederlage beibrachte, so gerieth nach einiger Zeit die Existenz des neuen Kaiserthums in die größte Gefahr. Friedrich, der an der Bildung dieses nicht-österreichischen Kaisertums durch die Erhebung des Kurfürsten von Baiern zum Kaiser den wesentlichsten Antheil hatte und daran mannichfaltige Entwürfe für die Umwandlung Deutschlands knüpfte, zog im Jahre 1744 nochmals das Schwert; vor allem, um seinen Kaiser — Karl VII. — zu retten; er dachte dabei zugleich Absichten durchzuführen, die er bei dem Frieden von Breslau nicht hatte erreichen können. Die Unternehmung hatte nicht den Beifall seiner Minister; man kann anderweit lesen, wie viel sich dagegen einwenden ließ, und was auf diese Einwendungen erwidert wurde. Historisch liegt das Hauptmoment darin, daß ein Kaiserthum, welches auf französischer Unterstützung beruhte, zugleich aber der Waffen des Königs von Preußen bedurfte, nicht zu behaupten war; hätte der König den Kaiser aufrecht erhalten, hätte er zu demselben in ein Verhältniß treten können, wie etwa der Kurfürst von Hannover zu Oesterreich, so würde sich ein Wittelsbachsches deutsches Kaiserthum haben denken lassen. Aber Karl VII. war viel zu schwach zu einer einfachen Bundesgenossenschaft, er würde allezeit von Frankreich abhängig geblieben sein. Das Unternehmen war großartig, aber doch in der That unausführbar; denn Friedrich mußte dabei auf die energische Unterstützung von Frankreich zählen; Frankreich und Preußen hatten zwar gemeinschaftliche, jedoch auch entgegengesetzte Interessen. Unter allen Umständen hatte der König zuletzt doch daran denken müssen, das Kaiserthum wieder von Frankreich zu emancipiren, und Frankreich konnte an einer Bundesgenossenschaft, welche Tendenzen der Selbständigkeit hervorkehrte, keinen Gefallen finden. Wie einst der König seine erste Abkunft geschlossen hatte, um der österreichischen Macht Zeit zu lassen, sich gegen Frankreich zu wenden, so hatten nun ihrerseits, den ausdrücklichen Verpflichtungen des Tractats zum Trotz, die Franzosen keine Neigung, mit den Oesterreichern im Elsaß zu schlagen und den König von Preußen in den Stand zu setzen, sich einiger Kreise in Böhmen zu bemächtigen, wiewohl sie dies Land noch als Eigenthum des Kaisers betrachteten, dem sie zur Krone desselben geholfen hatten. Denn neben den Interessen, die man nicht allein vorgiebt zu haben, sondern wirklich hat, wenn auch erst in zweiter Linie, machen sich auch immer andere|wesentlichere geltend, die jenen vorangehen. Ich weiß nicht, ob man viel daran gedacht hat, aber augenscheinlich ist es doch, daß eine weitere Bekämpfung von Oesterreich, durch welche die Franzosen das neue Kaiserthum behauptet hätten, vornehmlich dem König von Preußen zu Statten gekommen wäre, der sich nochmals vergrößert und an der Central-Verwaltung in Deutschland überwiegenden Antheil erlangt haben würde. Die Franzosen hatten überhaupt den Impuls nicht mehr, der sie in den Krieg gezogen hatte; überdies aber, es war ihnen eben recht, daß die Oesterreicher durch den König von Preußen beschäftigt wurden und ihnen freie Hand zu einem Angriff auf die Niederlande ließen. So geschah es, daß die gewaltige Kriegsmacht der Königin, die gegen Frankreich im Felde gestanden und die Waffen führen gelernt hatte, sich gegen den König von Preußen wandte und ihm in Böhmen entgegenrückte. Der König hätte nichts mehr gewünscht, als mit derselben sich zu schlagen; aber die Oesterreicher nahmen bei Marschowitz eine so starke Position, daß er doch Bedenken trug, sie daselbst anzugreifen; er sah sich genöthigt, Böhmen zu verlassen, zumal da er Sachsen gegen sich hatte. Kurz darauf starb der Kaiser, dessen Sache er führte, eines unerwarteten Todes (20. Jan. 1745). Einen Nachfolger für ihn zu finden, der von Oesterreich unabhängig gewesen wäre, war eine Sache der Unmöglichkeit; diese ganze das Kaiserthum betreffende Combination zerfiel in Nichts. Der Sohn Carl Alberts schloß seine Abkunft mit Oesterreich (April 1745): allenthalben im Reiche überwog der Einfluß der Königin, die nun nicht allein ihren Gemahl zum Kaiserthum erhoben zu sehen hoffte, sondern den Gedanken faßte, Schlesien wieder zu erobern. Hier aber war Friedrich unüberwindlich; es ist eine seiner glänzendsten und glücklichsten Waffenthaten, daß er ein großes österreichisch-sächsisches Heer bei Hohenfriedberg am 4. Juni 1745 auf das Haupt schlug. Auch ohne mitwirkende Bundesgenossen war er stark genug, Schlesien zu behaupten. Zwischen Oesterreich und Sachsen wurde der Plan verabredet, ihm durch einen Angriff auf die Mark Brandenburg beizukommen und ihn daselbst doch noch zu überwältigen. Noch zur rechten Zeit aber wurde Friedrich das inne und begegnete dem Angriff mit einer energischen Abwehr, die ihn zum Meister von Sachsen machte. Hierauf wurde Maria Theresia bewogen, den erneuerten Rathschlägen des englischen Gesandten, der den Frieden forderte, Gehör zu geben. Wenn die Franzosen erwartet hatten, daß Friedrich zugleich auf eine allgemeine Pacification Bedacht nehmen würde, in welcher auch sie inbegriffen worden wären, so lag ihm das ferne; denn auf seinen Antrag auf Unterstützung in dieser gefährlichen Krisis hatte er lauter ausweichende Antworten bekommen; er begnügte sich in dem Frieden zu Dresden (25. Dec. 1745) mit der Herstellung der Abkunft von Breslau, die das enthielt, was ihm am Nothwendigsten war. Dagegen behielt Maria Theresia in Deutschland die Oberhand, ihr Gemahl wurde zum deutschen Kaiser gekrönt, Friedrich selbst mußte ihn anerkennen. Ein mächtiges Oesterreich, dem das Uebergewicht in Deutschland zufiel, trat nun der neugebildeten preußischen Macht, die auf sich selbst angewiesen war, entgegen. Alles war in heftigem, blutigem Kampfe geschehen, und zu ihrem letzten Ziele war doch keine der beiden Mächte gelangt, der König von Preußen nicht in Bezug auf das deutsche Reich, noch bei weitem weniger Oesterreich in Bezug auf Schlesien. Maria Theresia war wohl eigentlich niemals gesonnen, sich in den Verlust, den sie erlitten hatte, zu finden. Aber im Widerspruch mit ihr erreichte Friedrich in dem Frieden von Aachen (18. October 1748), daß Schlesien und Glatz ihm von allen betheiligten Mächten auf's Neue garantirt wurden und zwar ohne eine Klausel, welche diesen Besitz bisher immer noch zweifelhaft hätte erscheinen lassen. Für Friedrich ein höchst vortheilhaftes Resultat. Wenn er es bisher unerträglich gefunden, daß man ihm so oft „Schach dem|König“ bieten konnte, so war er dieser Besorgnisse fürs erste, so lange nämlich keine große Veränderung in Europa eintrat, entledigt.
Die landesväterlichen Sorgen traten bei ihm bereits den militärischen ebenbürtig zur Seite.
Friedrich II. bemühte sich, die Beschränkungen, die ihm Grund und Boden seines Gebietes auferlegten, zu überwinden und sich auch in dieser Beziehung von den Nachbarn möglichst unabhängig zu machen. In die innere Verfassung seiner Landschaften vermied er willkürlich einzugreifen; er suchte den Bauer bei seinem Eigenthum zu schützen und von den drückendsten Lasten zu befreien ohne doch die Edelleute zu verletzen, deren Degen er brauchte; sie bildeten die Officiere seiner Armee. Eine neue Aufgabe erwuchs ihm aus der Vermehrung seiner katholischen Unterthanen; von dem Papst forderte er die nämlichen Rechte, die derselbe katholischen Fürsten gewährte, er wußte mit den kirchlichen Behörden in den Provinzen in ein gutes Verhältniß zu treten; denn der Geist des Jahrhunderts war überhaupt nicht mehr auf das strenge Festhalten, sondern auf die Beseitigung der religiösen Differenzen gerichtet. Die Idee des Staates kam insofern empor, als man dieser Differenz allen Einfluß auf die gegenseitigen politischen Beziehungen zu entreißen suchte. Was Friedrich darunter verstand, wenn er sagte, er setze Religion der Religion entgegen, sieht man unter Anderem aus seinem Verfahren in Schlesien. Den österreichischen Jesuiten, die einen großen Einfluß auf die Verwaltung und die Erziehung ausübten, setzte er eine Schule französischer Jesuiten entgegen, ebensogut katholisch wie die anderen, jedoch frei von österreichischen Sympathien. Auf diesem Wege konnte er die religiöse Toleranz aufrecht erhalten und sie zum Grundprinzip seines Staates machen. Den schlesischen Evangelischen hatte er Sicherheit verschafft, die Regierung des Landes aber wollte er nicht in ihre Hände legen. In allen seinen Gebieten hat er im Anfange seiner Regierung viele Kirchen bauen lassen. Den beiden protestantischen Parteien der Lutherischen und der Reformirten ließ er gleichmäßigen Schutz angedeihen; denn ihr Hader hätte Beunruhigungen veranlassen können, und für die einander schroff gegenüber stehenden Meinungen hatte er überhaupt keinen Sinn. Von gesundem Urtheil zeugt der Rath, den er den Geistlichen gab: die Welt zu nehmen, wie sie ist, übrigens aber die heilige Schrift zu studiren. Obwohl er sich hütete, in die innere Verfassung der Landeskirche einzugreifen, so gab doch die allgemeine Tendenz, die er verfolgte, seiner Regierung in geistlicher Beziehung einen anderen Charakter, als die seiner Vorgänger gehabt hatte. Er brauchte nicht mehr die Reformirten gegen die in den Provinzen herrschende Uebermacht der Lutheraner in Schutz zu nehmen, wie etwa der große Kurfürst; noch auch die confessionellen Institute zu verstärken, wie seine älteren Vorgänger, um einer katholischen Propaganda entgegenzutreten. Dem entsprach es nun, wenn Friedrich II. in sich selbst von aller religiösen Ueberlieferungen abstrahirte. Er schloß sich den Anschauungen der Philosophen des Jahrhunderts an, ohne ihnen in die neuen Systeme zu folgen, mit denen sie nach und nach zum Vorschein kamen. Voltaire mit seiner Opposition gegen die positiven Kirchenlehren, die aber nicht über den Deismus hinausging, war nicht allein sein Freund, oft sein Gesellschafter, sondern selbst sein Verbündeter. Wenn er die „Akademie der Wissenschaften“ erneuerte oder erst recht begründete, so übten die religiösen oder vielleicht der positiven Religion entgegengesetzten Gesinnungen Friedrich's auf ihre Zusammensetzung keinen Einfluß aus. Der Präsident der Gesellschaft, Maupertuis, war von religiöser Gesinnung und ging in die Messe. Die bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten wurden von deutschen Gelehrten abgefaßt und nur darum in's Französische übersetzt, um allgemein bekannt zu werden. Denn die französische Sprache|war die allgemeine des gebildeten Europa; Friedrich selbst bediente sich ihrer bei seinen Productionen. Die Akademie, der er mehrere seiner Arbeiten zuerst vorlesen ließ, bildete gewissermaßen sein erstes Publikum. Die Anwesenheit Voltaire's in Potsdam hat eine litteraturgeschichtliche Bedeutung durch zwei Werke, die in der Zeit des vertrauten Umganges des Königs und des größten Litteraten des Jahrhunderts entstanden sind: Voltaire's Siècle de Louis XIV., vorlängst entworfen, in Potsdam vollendet, in einer Atmosphäre jedoch, die keine rein französische war, und der erste Entwurf einer Darstellung der letzten Kriegsereignisse durch Friedrich selbst, der sich ebenfalls mehr in europäischen, als localen Anschauungen bewegt. Von Friedrich's poetischen Werken vielleicht das beste, das Lehrgedicht über die Kriegskunst, datirt aus derselben Epoche; es wurde von Voltaire stylistisch durchgesehen, die Arbeit ist auch kriegswissenschaftlich bedeutend; sie beruht auf den Principien über den Krieg, die der König als das Resultat seiner Erfahrungen damals überhaupt theoretisch zusammenfaßte.
Was nun aber König Friedrich vor Allem beschäftigte, war die Sorge für seine Armee, die er auf 133,000 Mann brachte, alles wohlgeübte, wohlgeschulte Truppen, und die Herbeischaffung der Mittel, um ein paar Feldzüge mit denselben auszuhalten; denn daß es noch einmal zum Kampfe kommen würde, war ihm bei der engen Verbindung zwischen Oesterreich, Rußland und Sachsen und der Schwäche von Frankreich nicht zweifelhaft; davon aber, daß Frankreich, mit dem er zwar nicht einverstanden, aber doch verbündet gewesen war, den ihm entgegengesetzten Mächten beitreten könne, hatte er doch keinen Begriff. Dieses Ereigniß, in welchem eine Umkehr der bisherigen Politik lag, trat dennoch ein aus Gründen, welche eine durchgreifende Aenderung aller Verhältnisse in sich schlossen. Die Streitigkeiten zwischen Frankreich und England, welche die Welt umfaßten, brachen wieder zu offenem Kriege aus; wohl aber wußten die Franzosen, daß ihre Seemacht, die damals die Unterstützung der übrigen bourbonischen Höfe nicht hatte, der englischen bei Weitem nicht gewachsen sei; sie meinten, diesen Mangel durch die Superiorität ihrer Landmacht zu ergänzen und ihre amerikanischen Colonien, wie vordem, durch einen Krieg in Europa zu behaupten.
Der französische Gesandte selbst hat dem König Friedrich gesagt, Frankreich würde sich in Hannover schadlos halten. Damit aber trat eine Differenz zwischen den beiden Mächten ein, die ihrem bisherigen Einverständniß ein Ende machte und den großen Kampf hervorrief, der unter dem Namen des siebenjährigen Krieges unvergeßlich geworden ist. Zu einer Besetzung Hannovers durch die Franzosen wollte Friedrich es nicht kommen lassen, er wäre dadurch selbst bedroht worden; denn schon hatten die Russen einen Vertrag mit dem König von England geschlossen, kraft dessen sie in Deutschland vorgedrungen wären, um Hannover für denselben zu behaupten. Unmöglich aber konnte Friedrich das nördliche Deutschland zu einem Kriegsschauplatz zwischen Russen und Franzosen werden lassen. Der König von England, Kurfürst von Hannover, hätte es vielleicht geduldet, nicht jedoch die englische Nation; denn jeder Mann wußte, daß die russische Kaiserin Elisabeth, die den König von Preußen haßte, vor Allem diesen Fürsten niederzuwerfen suchen würde; der König von Preußen aber war für die englische Nation ein Gegenstand der Verehrung und Bewunderung. Und überdies, die Engländer wünschten vollkommen freie Hand für den maritimen Krieg zu behalten; wenn ihnen Friedrich die Neutralität zusicherte und den Schutz von Hannover selbst in die Hand nahm, so war Alles geschehen, was sie wünschen konnten. Sehr ernstlich ging Friedrich mit sich über diese Frage zu Rathe; er zog in Betracht, daß er sich unmöglich den drei Mächten Oesterreich, Rußland und England-Hannover zugleich widersetzen könne, was ihn zu einem Defensivkriege nöthigen|würde, den er auszuhalten nicht im Stande sei. Sollte er nun aber dagegen mit Frankreich brechen, mit welchem verbunden zu sein bisher den Angelpunkt seiner Politik ausgemacht hatte? Er erwog, daß er doch keinerlei Verpflichtung habe, die amerikanischen Besitzungen der Franzosen zu vertheidigen, zugleich aber, daß die französische Hülfe ihn gegen die Angriffe der anderen Mächte nicht sicher stellen könne. Aus diesen Gründen entschloß er sich, einen Neutralitätsvertrag mit England einzugehen (17. Jan. 1756) durch welchen die Ruhe in Deutschland erhalten werden und keiner fremden Macht gestattet sein sollte, in Deutschland einzurücken. Es war ein Vertrag, der ebensowohl seinem eigenen Interesse als der Stellung der damaligen englischen Verwaltung entsprach; Friedrich meinte selbst, daß die Franzosen sich in denselben finden würden. Und wie viel besser hätten diese daran gethan, alle ihre Kräfte ebenfalls auf die Seerüstungen zu wenden, als die alten Eingriffe in Deutschland zu wiederholen. Das lag nun aber gänzlich außerhalb des französischen Gesichtskreises; die Franzosen wollten einmal in deutschen Angelegenheiten fortwährende Einwirkungen ausüben und hielten es selbst für besser, sich zu diesem Zwecke mit der kaiserlichen Macht zu verbünden, als mit der Opposition gegen dieselbe; von Hannover abzustehen konnten sie nicht über sich gewinnen, da England selbst dadurch eine neue verstärkte Sicherheit erlangen würde, wenn es dieses Besitzthum seines Königs nicht zu vertheidigen brauche. Schon immer hat darin der Gegensatz der französischen und preußischen Politik gelegen; Preußen wollte die Einwirkung Frankreichs auf das deutsche Reich nicht anwachsen noch sich befestigen lassen, es wollte sich seiner Verbindungen mit Frankreich zu seiner eigenen Sicherheit bedienen, nicht weiter. Daß nun der alte Verbündete, dessen Emporkommen sie sich selber zuschrieben, ihnen in einem großen Kampfe, welcher bevorstand, ein Kriegstheater verschließen wollte, auf welchem sie Erfolge davon zu tragen hofften, erfüllte den König Ludwig XV. und seinen Hof mit einer Art von Ingrimm. Unter dem Beirath der Marquise von Pompadour, seiner früheren Maitresse, die jetzt gleichsam sein erster Minister war, wendete sich Ludwig XV. den österreichischen Anträgen zu, welche auf eine Wiedereroberung von Schlesien gerichtet waren, zumal da ihm diese dagegen versprachen, auch ihm freie Hand gegen den König von England, Kurfürsten von Hannover, zu lassen. König Friedrich hätte nie erwartet, daß die Antipathien der Franzosen so weit gehen würden; aber mit einem Schlage sah er sich jetzt von der Gefahr, die er hatte vermeiden wollen, im verdoppelten Umfang bedroht; Oesterreich, Rußland, Sachsen blieben immer gegen ihn vereinigt, nunmehr gesellten sich, da England zurückwich, vielmehr die Franzosen den alten Feinden bei. Aber das war nun einmal das Schicksal Friedrichs: in der Mitte der europäischen Conflicte mußte er seine Eroberung bald gegen die eine, bald gegen die andere Combination vertheidigen. Durch den Wechsel der Politik wurde seine Lage insofern verbessert, als er in eine natürliche Verbindung mit England und mit Hannover trat, von denen er wenigstens für seine Unabhängigkeit nichts zu fürchten hatte, was bei einer Allianz mit Frankreich immer der Fall war. Aber Hülfe durfte er auch von England her sich zunächst nicht versprechen. Den Sturm, der ihn bedrohte und über dessen Richtung er sich keinen Illusionen hingeben konnte, mußte er allein bestehen; Preußen mußte, wenn es bleiben wollte, was es nunmehr war, den Kampf gegen Rußland, Frankreich, Oesterreich, Sachsen und Polen zugleich bestehen.
Friedrich hatte, als er mit England abschloß, sich der Nothwendigkeit entziehen wollen, sich nach allen Seiten hin vertheidigen zu müssen; es war von ihm nicht zu erwarten, daß er sich in eine so unhaltbare Stellung drängen lassen werde, da die Gefahr noch größer geworden war. Um nicht angegriffen zu werden, faßte er den Gedanken, selbst anzugreifen. Noch waren die Feinde nicht vorbereitet, noch war es möglich, daß sie bei der Aussicht auf einen unmittelbaren Krieg zurückscheuten; darauf beruhte es, wenn er der Kaiserin Maria Theresia, von der alle Feindseligkeiten ihren Impuls bekamen, die Frage vorlegte: ob sie in diesem und im nächsten Jahre ihm Frieden zusichern wolle oder nicht; denn nach einigen Jahren hätten sich Wohl die Combinationen anders gestalten können. Aber in Wien herrschte damals die Tendenz der Feindseligkeit vor; die Kaiserin gab eine ausweichende Antwort, und Friedrich beschloß nun, seinen Angriff keinen Augenblick zu verzögern.
Man hat oft behauptet, der Krieg hätte sich noch vermeiden lassen und nicht selten ist die Meinung aufgetaucht, Friedrich habe bei seinem Unternehmen nur die Absicht gehabt, Sachsen zu erobern. Für das letztere ist eine spätere Aeußerung Friedrichs angeführt worden, die sich aber auf ganz andere Verhältnisse bezieht; allerdings nahm seine Armee zum größten Theil ihren Weg durch Sachsen, wie das auch schon im Jahre 1744 geschehen war; im Jahre 1756 hatte Friedrich die nämliche Absicht, durch Sachsen nach Böhmen vorzudringen; denn er wollte dem ihm drohenden Angriff dadurch zuvorkommen, daß er Oesterreich selbst in Böhmen angriff, ehe es seine Vorbereitungen getroffen hatte. Noch bei seinem Vordringen in Sachsen würde er zurückgewichen sein, wenn er aus Oesterreich auf eine letzte dringende Anfrage eine genügende Antwort erhalten hätte; allein man wiederholte in Wien nur, was man zuvor gesagt, und war über den Einbruch des Königs in Sachsen nichts weniger als erschrocken; denn nun erst konnte man auf die Erfüllung der Zusicherungen von Frankreich 'und Rußland mit Sicherheit rechnen. Die Besetzung Sachsens war eine Handlung, welche die ingewohnten friedlichen Verhältnisse plötzlich durchbrach und die halbe Welt in Aufregung setzte.
Sachsen war im Jahre 1744 unentschieden gewesen, es hatte seine Position erst nach der Hand genommen, im Jahr 1756 war es in voller Rüstung begriffen und vermochte sich zwar nicht eigentlich zur Wehr zu setzen, aber doch den König Friedrich auf seinem Wege aufzuhalten; militairisch nahm der König Sachsen in Besitz. Im Frühjahr 1757 drang er in Böhmen vor und gewann die Oberhand in einer mörderischen Bataille vor den Mauern von Prag (6. Mai). Diese Stadt aber behauptete sich und indem er dem österreichischen Heer entgegenging, das zum Entsatz derselben bestimmt war, erlitt er seine erste große Niederlage (bei Collin 18. Juni); er mußte nun doch zur Defensive schreiten, in die er nur Sachsen einschließen zu können den Vortheil hatte. Man sah doch das große Schicksal sich erfüllen; Preußen war angewiesen, in der Mitte der zwei großen continentalen Mächte seine Selbstständigkeit zu vertheidigen.
Die Eroberung von Schlesien war durch Talent und ein glückliches Ergreifen des geeigneten Augenblickes, um alte Ansprüche geltend zu machen, vollbracht worden; die Vertheidigung erforderte lange Anstrengungen und den unerschöpflichen Muth der Ausdauer. Die Sache Friedrichs hatte insofern eine nationale Bedeutung, als die Franzosen im Bunde mit Oesterreich das ganze westliche und nördliche Deutschland überflutheten. Friedrich brach ihren Anlauf, als sie nach Thüringen vordrangen, durch die Schlacht bei Roßbach (5. November), die ihren Ehrgeiz tief verwundete, aber er konnte sie nicht systematisch bekämpfen, er überließ das seinem Neffen, Ferdinand von Braunschweig; er selbst eilte nach Schlesien, wo die Herstellung der österreichischen Autorität bereits begonnen hatte. Die protestantischen Sympathien kamen ihm dabei nochmals zu Hülfe, wie denn dem Bündniß zwischen Frankreich und Oesterreich eine katholische Tendenz zu Grunde lag.
Die Schlacht bei Leuthen (5. December 1757) ist wohl die letzte, in welcher diese religiösen Gegensätze entscheidend eingewirkt haben, eigentlich noch eine|Antwort auf die Schlacht am weißen Berge, welche die Grundlage der katholischen Action bildete, der Schlesien damals unterlag. Die Oesterreicher mußten aufs Neue Schlesien verlassen, die protestantische und die deutsche Idee gaben den Waffen Friedrichs eine allgemeine Beziehung von großer Tragweite. Nun aber erschien erst die russische Armee im Felde, welche von Osten her noch gefährlicher wurde als die französische im Westen. Der König warf sie bei Zorndorf (25. August 1758) zurück, aber bei Kunersdorf (12. August 1759) ist er ihr erlegen. In einem Leben voll großer Unternehmungen müssen auch große Mißgeschicke eintreten, Momente, in denen Alles verloren scheint. Einen solchen hat Friedrich damals erlebt; er verzweifelte an seinem Succeß und an seiner Sache, war aber entschlossen den Ruin von Preußen nicht zu überleben. Mehr als einmal ist ihm dieser Gedanke wieder gekommen; denn wiewohl heute überwunden, erneuerten sich doch die Bedrängnisse den andern Tag. Der erste Schimmer einer Hoffnung der Rettung kam ihm aus dem Lager seiner erbittertsten Feinde.
Das Bündniß zwischen Oesterreich und Frankreich war nicht so enge, daß die Franzosen, wiewohl sie an demselben festhielten, doch nicht der Kaiserin den Rath gegeben hätten, auf die Wiedererwerbung von Schlesien Verzicht zu leisten; denn ihr Krieg mit England führte so große Verluste herbei, daß sie zu dieser Eroberung mitzuwirken nicht im Stande waren; ihre Bestrebungen waren nur darauf gerichtet, dem tapfern Prinzen von Braunschweig gegenüber sich im westlichen Deutschland zu behaupten. Aber um so enger war das Einverständniß des russischen Hofes mit der Kaiserin, die demselben die größten Concessionen machte; sie willigte ein, daß das von den Russen eingenommene Ostpreußen denselben verbleiben solle, wenn dagegen Schlesien an Oesterreich zurückkomme.
Was diese Verbindung in jenem Moment zu bedeuten hatte, sieht man daraus, daß Friedrich im Jahre 1760 nur 70000 Mann in's Feld stellen konnte, während das russische und österreichische Heer, das gegen ihn zusammenzuwirken bestimmt war, 300,000 Mann zählte. Er erfocht die glänzenden Siege bei Liegnitz (15. August 1760) und bei Torgau (3. November 1760), aber sie gaben ihm keine Genugthuung; denn er fühlte alle Zeit die Unzulänglichkeit seiner Streitkräfte den feindseligen Elementen, die auf ihn eindrangen, gegenüber; er hat seinem Bruder Heinrich zu Gemüthe geführt, daß man dem Vaterlande dienen müsse, auch wenn die Sache schlecht gehe; sein ursprünglich dynastischer Gedanke hatte sich zu der Idee des Vaterlandes erhoben. Die Idee des Staates und seiner Unabhängigkeit schwebte ihm unaufhörlich vor Augen; er wollte eher sterben als sie fallen lassen.
Wie nun aber die Gefahr durch Combination von Umständen, die keine innere Nothwendigkeit hatten, herbeigeführt worden war, so trat im Laufe der Zeit eine andere Combination ein, welche sie wieder Zerstreute. Das vornehmste Ereigniß war, daß die Kaiserin von Rußland im Januar 1762 starb; ihre persönliche Animosität hatte dem Kriege seine verderblichste Wendung gegen Friedrich gegeben. Ihr Nachfolger, Peter III., war gerade von der entgegengesetzten Stimmung beseelt; er verehrte den König Friedrich in demselben Maße, als seine Vorgängerin ihn verabscheut hatte. Hierdurch verschwanden alle Gefahren im Norden; denn wiewohl die Gewaltsamkeiten Peters eine Bewegung hervorriefen, die seiner Laufbahn in Kurzem ein Ziel setzte, so war doch von der neuen Gebieterin, seiner Gemahlin, die durch seine Katastrophe emporkam, kein Rückfall in das alte System zu erwarten. Es erhellt nicht gerade, daß Katharina II. aus Dankbarkeit gegen Friedrich, dem sie ihre Vermählung nach Rußland verdankte, gehandelt habe; ihre Idee war einzig, die russischen Interessen in's Auge zu fassen; sie sagte wohl in einem großen Augenblick, sie sei hier im Namen des Volkes, um das Interesse desselben immer vor Augen zu behalten. Dies aber gebot weder die|Vernichtung Preußens noch eine unbedingte Allianz mit Oesterreich. Und indem Maria Theresia, die ohnehin viel schwächer geworden, die Unterstützung der Russen verlor, entging ihr auch die andere, die in der Verbindung mit Frankreich lag.
Endlich war es der französischen Nation zum Bewußtsein gekommen, daß sie durch den maritimen Krieg unberechenbare Verluste erlitt; wohl kam ihr für denselben eine Thronveränderung in Spanien zu Statten, und es schien, als ob der frühere Kampf der bourbonischen Mächte gegen England sich im vollen Umfang wiederum erneuern sollte. In England sahen die Männer, welche bisher den Krieg geführt hatten, darin mehr eine Aussicht zu neuen großen Erfolgen als eine wirkliche Bedrohung; sie fühlten sich stark genug, um die spanische und französische Seemacht zugleich niederzuwerfen; aber auch die englische Nation, deren vornehmster Zweck als erreicht betrachtet werden konnte, war des Krieges bereits müde. Auch hier trat eine Regierungsveränderung von entscheidendem Charakter ein. Der junge König Georg III. glaubte erst in den vollen Besitz seiner Krone zu gelangen, wenn er sich der Partei entledigte, die bisher am Ruder gewesen war.
So begegneten sich die Regierungen von England und von Frankreich in friedlichen Intentionen.
Friedrich empfand es auf das Bitterste, daß er von den Engländern, denen er unermeßliche Dienste geleistet hatte, in seiner Bedrängniß verlassen wurde; aber der Vertrag, den er mit ihnen geschlossen, wurde doch in der That nicht ganz aus den Augen gesetzt: sie hielten an der Garantie von Schlesien, die sie ihm gegeben hatten, fest. Und von der Idee, ihm Schlesien zu entreißen, waren auch die Franzosen bereits zurückgekommen; aber diese fürchteten, durch eine Abkunft mit England, in welcher diese Garantie anerkannt würde, sich von Oesterreich zu entfremden, wozu sich König Ludwig XV. um so weniger entschließen wollte, da er sich mit Preußen so entschieden verfeindet hatte. Wenn nun die Frage war, wie der Friede mit England und die Allianz mit Oesterreich zugleich aufrecht erhalten werden könnte, so kam ihnen Maria Theresia auf halbem Wege entgegen. Erschreckt durch die Gefahr (es war noch zu Lebzeiten Peters III), daß die Russen jetzt zu Gunsten Preußens an dem Kriege theilnehmen und vielleicht nach Hannover vordringen würden, was dann auf England zurückwirken und dort die Freunde Friedrichs wieder an's Ruder bringen müsse, entschloß sie sich, die Absicht, Schlesien zu erobern, was ihr ohne den Beistand von Frankreich und von Rußland unmöglich war, endlich aufzugeben; die vornehmste aller Nothwendigkeiten lag für sie in der Pacification von England und Frankreich, die mit der Absicht auf Schlesien nicht zu combiniren war. Es kam dazu, daß auch die Zeit des Friedens mit den Türken ablief, so daß das orientalische Verhältniß anderweite Kriegsgefahren zu vermeiden gebot.
Aus dieser Verflechtung der Dinge entsprang der Friede, der zuletzt zu Hubertsburg zu Stande kam (15. Februar 1763).
Von dem Wiener Hof selbst ging der Antrag dazu aus; er wurde durch Sachsen vermittelt. Die Grundbedingung von Allem war, daß Friedrich zu keiner Abtretung irgend einer Art verpflichtet sein sollte; was er unter dem mannigfaltigsten Wechsel von Glück und Unglück und unter den größten Anstrengungen auf Leben und Tod vertheidigt hatte, das wollte er auch behaupten.
In dieser Haltung beruht der Anspruch Friedrichs auf den Beinamen des Großen, an den er selbst nicht gedacht, den ihm aber die Nachwelt zuerkannt hat; sie hat damit nicht etwa Alles sanctioniren wollen, was von ihm ausging, denn nicht eben Alles ist groß, was ein großer Mann thut und an Manchem,|was von ihm ausging, hat nicht bloß der Neid und die Mißgunst etwas auszusetzen gefunden, aber groß ist in Friedrich ein militairisches Talent, welches das Einzelne umfaßt und sich zur genialen Heerführung erhebt; am glänzendsten in den Momenten der größten Gefahr; nicht minder der gesunde zum Ziel treffende politische Blick, der sich über den Zustand der Dinge keinen Täuschungen hingibt; der Geist, der ihn zu den gewagtesten Unternehmungen antreibt, wenn sie in den Kreis seines politischen Daseins gehören und dann doch abhält, über denselben hinauszugehen; endlich die moralische Entschlossenheit, die auch in der äußersten Gefahr aushält und in der Hauptsache niemals einen Schritt breit zurückweicht. Auf diese Weise hat er sein Preußen als europäische Macht, allen andern ebenbürtig begründet und behauptet. Wohl fühlte man dies in der Nation. Nicht allein mit Bewunderung, sondern mit Verehrung wurde er empfangen, als er, nicht mehr jugendfrisch wie einst, sondern mit den Spuren des Alters, d. h. der Kämpfe, die er bestanden, nach Berlin zurückkam.
Aber eine neue, nicht minder schwere Arbeit stand dann vor ihm: er mußte die Landschaften, die er behauptet hatte, in ihren alten Wohlstand wieder herstellen und sie zu einem Ganzen vereinigen, das für ein ander Mal widerstandsfähig wäre. Denn an die Dauer des Friedens glaubte man eigentlich nicht. Von den Provinzen waren einige vom Feinde besetzt gewesen, andere hatten zum Kriegstheater gedient, alle waren ruinirt. Friedrich II. wurde an den Zustand derselben, wie er nach dem dreißigjährigen Krieg gewesen war, erinnert, wo es denn fast ein Jahrhundert gedauert hatte, ehe eine Herstellung vollbracht worden war. Dahin aber sollte es dies Mal nicht kommen; der Unterschied gegen früher lag darin, daß damals der Fürst und die Völker zu Grunde gerichtet waren: jetzt aber ging Friedrich aus dem Kriege mit den Mitteln, die zu einem neuen Feldzug erforderlich gewesen wären, hervor und zögerte nicht, dieselben zur Herstellung des Landes zu verwenden. Die Pferde, mit denen er die Artillerie hatte bespannen wollen, wurden dazu verwandt, um den Pflug zu ziehen; aus den Magazinen, welche für die Soldaten bestimmt gewesen waren, wurde nun das Volk genährt. Von den Provinzen hatten sich einige nicht ganz zu seiner Zufriedenheit verhalten, namentlich nicht der Adel in Ostpreußen, anderen, z. B. den Bauern im Minden’schen, schlug er es sehr hoch an, daß sie sich selbst zum Kriegsdienst gestellt hatten; allein darauf hat er keine weitere Rücksicht genommen, namentlich den Ostpreußen Alles vergessen; er sah alle Landschaften eben als Theile des Ganzen an, das nun zu einem haltbaren Zustand gebracht werden sollte. Von allen Seiten umgaben ihn bei Weitem mächtigere und doch zugleich eifersüchtige Potenzen, denen er Widerstand zu leisten fähig sein mußte. Eine große Schwierigkeit machte ihm selbst die Nothwendigkeit, die Armee in gutem Stande zu erhalten. Es wäre ganz unverhältnißmäßig gewesen, ein stehendes Heer von 160,000 Mann, wie er es bedurfte, aus den Einwohnern auszuheben. Alles, was möglich war, bestand darin, daß er 70,000 Mann aus den Eingeborenen unter die Waffen stellte. Er blieb bei dem Cantonsystem, das sein Vater eingerichtet hatte, dessen Nutzen, selbst im Kriege, er sehr hoch anschlug. Daran also, eine eigentlich nationale Armee aufzustellen, konnte er nicht denken, doch hat er bereits den Entwurf gehabt, in dringenden Fällen zur allgemeinen Dienstpflicht heranzuziehen. In Ostpreußen dachte er in einem solchen Falle 20,000 Mann aus den Cantons aufzubringen und sie mit den regulären Truppen zu vereinigen. Schwere Besorgnisse erregte ihm allezeit die geographische Lage der Provinzen, die, von einander getrennt, nur zu leicht in die Hände der Feinde gerathen konnten. Er sah voraus, daß er das nicht würde verhindern können; jene Landesbewaffnung|in Ostpreußen sollte nicht sowohl dazu dienen, das Land selbst zu vertheidigen, als die Weichselübergänge zu besetzen und so die Vertheidigung der Hauptprovinzen im Nothfalle möglich zu machen. Zunächst erforderten die Marken die größte Sorgfalt, namentlich die von dem letzten Kriege besonders betroffenen neumärkischen Gebiete, von denen man berechnete, daß sie 57,000 Menschen weniger zählten, als vor dem Kriege. Er ruhte nicht, bis er es etwa nach zwölf Jahren dahin gebracht hatte, daß dieser Mangel nicht allein ersetzt war, sondern noch 30,000 Einwohner mehr gezählt wurden; denn vor Allem davon hatte er sich in seinen Studien überzeugt, daß die Macht eines Staates auf der Menge der Bevölkerung beruhe. Es machte ihm Eindruck, daß das kleine Holland im sechszehnten Jahrhundert den Krieg gegen den damals mächtigsten König der Welt glücklich bestanden hatte. In der Menge der Einwohner sah er den Vorzug Englands vor Schweden, Deutschlands vor Polen. Daher schrieb sich sein Eifer für Urbarmachungen und Colonisationen überhaupt, zu denen er schon früher den Anfang gemacht und die er mit wachsendem, vielleicht übertriebenem Eifer fortsetzte. Ein anderes Motiv der Macht erblickte er in dem Betriebe der Manufactur, wozu er dann besonders die Wollarbeiten zu organisiren Bedacht nahm, die für Städte und Land gleich wichtig seien. Er hielt es für nothwendig. jeder Einfuhr durch hohe Hölle entgegen zu treten. Er fühlte Wohl selbst, daß seine Zölle das gewöhnliche Maaß überschritten, und von dem Merkantilsystem war er nicht so durchdrungen, daß er für die Vortheile eines freien Handels schlechterdings kein Ohr gehabt hätte. Allein er glaubte mit gutem Gewissen dazu schreiten zu können, da es für die Erhaltung des Staates unbedingt nothwendig sei. Dabei aber faßte er noch einen moralischen Gesichtspunkt in's Auge. Er sagt: der Landadel sei in der Regel arm und doch zur Verschwendung sehr geneigt, alle Luxusartikel müsse man daher aus dem Lande entfernt halten; der Adel würde sonst sich in seinen Hülfsquellen ruiniren und zugleich verweichlichen; in Preußen müsse man streben, die alten germanischen Tugenden aufrecht zu halten; zu dem Kriege sei Ehrgefühl, Ruhmbegierde, Vaterlandsliebe erforderlich; diese Tugenden aber werde man durch Verweichlichung untergraben, und doch beruhe sein ganzer Staat darauf; denn aus dem Adel, wie bereits bemerkt, nahm er seine Offiziere. Hat man es nicht vor Kurzem in Frankreich selbst beklagenswerth gefunden, daß die Pflanzschule von Offizieren, die in einem wenig begüterten Adel liege, daselbst nicht mehr vorhanden sei? Friedrich II. betrachtete es als eine seiner Hauptaufgaben, den Adel, dem er alle mögliche Rücksicht erwies, aufrecht zu halten. Aus diesem Grunde hielt er über die Prärogative desselben, die Rittergüter allein zu besitzen. Er war nicht ohne Empfänglichkeit dafür, daß der Zustand der Unterthänigkeit der Bauern unter die Gutsherren aufgehoben werden sollte. Der Leibeigenschaft gedenkt er mit Abscheu, aber die Frohnden abzuschaffen erschien ihm doch als ein so schädlicher Eingriff in den Besitzstand der Edelleute, daß er davon abstand. Nur einem Mißbrauche setzte er sich mit Nachdruck entgegen, nämlich dem Ankaufe bäuerlicher Grundstücke durch die Gutsherren, denn dadurch werde die Population vermindert, wie das in vielen anderen Ländern geschehe. Dem aber zuvor zu kommen, dazu wurde er auch durch das Princip seines Staates überhaupt bewogen; denn vor Allem bedurfte er der Bauern in dem angegebenen Maße für die Armee, zugleich aber auch durch eine besondere kriegsmännische Betrachtung. In dem Zusammenstehen der Verwandten aus einem einzigen Canton sah er ein Moment zur Kriegführung; denn Einer fechte für den Anderen und dabei sei doch ein Wetteifer unter ihnen bemerkbar. Die drei Stände, Adel, Bauern und Bürger, standen als große Corporationen vor seinen Augen. Den Bürgern war Handel und Verkehr überlassen. Er wollte nicht, daß der dritte Stand|sein Geld anders, als zum Zwecke des Verkehrs verwende, durchaus nicht zu dem Ankaufe von Rittergütern, die in den Händen des Adels bleiben müßten, der dagegen auch am Handelsverkehr nicht theilnehme; es sei seine einzige Ressource. Man sieht wohl, er ließ noch Etwas zu thun für das Jahr 1807. Dem König Friedrich II. verbot das Gefühl von seiner Lage, über den Kreis, den er um sich gezogen, hinaus zu gehen. Die Einheit des Ganzen aber sah er allein in seiner eigenen Person, in der Person des Fürsten. Er hat wohl einmal von einem Urvertrag geredet, aber auf die populären Anwendungen dieser Doctrin ging er nicht ein; denn die Pflicht der Vertheidigung sei dabei auf den Fürsten übergegangen; diese aber lag eben in seinem Princip der Staatsverwaltung, wie er es faßte. Es gebe keinen Unterschied, sagte er, zwischen dem Wohl des Fürsten und dem Wohl des Staates; der Unterthan müsse allerdings mehr leisten, als gerade der Augenblick erheische, aber dafür habe der Fürst die Verpflichtung zur Sparsamkeit, namentlich zur Ansammlung eines Schatzes, um immer im Stande zu sein, die Vertheidigung zu führen; vor Allem müsse er eine stattliche Kriegsmacht erhalten; denn unter dem Schutze der Krieger pflüge der Bauer sein Feld, entscheiden die Tribunale die Rechtsfragen, bleibe jede Thätigkeit in ihrem Gange und werde der Handel erhalten. Die Dienste des Volkes und des Fürsten schlägt er gleich hoch an, „eine Hand“, sagt er, „wäscht die andere.“ Es entgeht ihm nicht, daß seine Anordnungen zuweilen hart erscheinen, man sage Wohl, er setze dem Volke das Messer an die Kehle, aber man solle sich erinnern, daß er nie etwas Anderes, als dessen Wohlfahrt im Auge gehabt habe; er verlasse sich auf die Geradheit. seiner Absichten, sein gutes Gewissen und die bessere Einsicht, die er sich erworben habe. Es würde verwerflich sein, wenn er etwa die Hälfte des Einkommens für den Staat fordern wolle. Jeder müsse im Stande sein, sein Eigenthum im Großen und Ganzen zu genießen, aber einen Theil desselben müsse er abgeben. Es genügt nicht, daß die Regierung reich sei, das Volk muß glücklich sein.
Von der Nothwendigkeit der Monarchie ist Friedrich II. besonders für den preußischen Staat durchdrungen; in ihrer Handhabung sieht er selbst eine Pflicht. Der fleißigste, in seinem Berufe eifrigste, standhafteste Fürst habe einen Vorteil vor den anderen, die sich im Nichtsthun gefallen. Der Fürst muß an der Spitze aller Departements stehen; denn jeder Minister versieht nur sein eigenes. Der Fürst muß der Centralpunkt für Alle sein. Vermag ein Fürst nicht selbst zu regieren, so muß er sich allerdings einen ersten Minister wählen. Friedrich II. geht die Reihe der ersten Minister durch, die er aus der Geschichte kennt. Er ist mit Keinem ganz zufrieden, selbst nicht mit Richelieu, den er sonst am höchsten stellt, noch auch mit Mazarin. Den Glanz der früheren Epoche Ludwigs XIV. leitet er daher ab, daß er selbst sein erster Minister gewesen sei. Sein eigenes Verhalten identificirt Friedrich so ganz mit der Natur des Staates, den er regiert, daß er eine andere Art und Weise, denselben zu regieren, als die seine, verwirft. Er erkennt an, daß seine Regierung eine militärische sei, aber eben dies ist sein Princip. Wenn der Krieg allerdings mißbraucht werden könne, so gebe es doch auch einen guten Gebrauch desselben; zuweilen sei er unentbehrlich. Er verzeichnet die Fälle, in welchen der Krieg nicht vermieden werden dürfe; nothwendig sei er vor Allem zur Erhaltung des Ansehens und der Sicherheit des Staates, Unterstützung der Freunde und zum Widerstande gegen die, welche neue Unternehmungen, die dem Staate schädlich sein können, im Schilde führen. In diesem Falle hat er sich eben selbst bei dem Ausbruche des letzten Krieges befunden. Auf die strategische Führung und die Einsicht des Feldherrn legt er dabei den größten Werth. Gar nicht auszulernen, sagt er, sei die Kunst des Krieges; jede Campagne habe|ihm neue Erfahrungen geboten und neue Grundsätze an die Hand gegeben; er zweifle nicht, daß es noch viele Erfahrungen gebe, die er nicht gemacht habe und die eine Erweiterung der Kunst nöthig machen. Die Regeln, wie sie jetzt gefaßt werden müssen, habe er in den Anordnungen an seine Generale bekannt gemacht. Dabei aber sei doch das größte Unglück für das Bestehen des Staates zu erwarten, wenn der Fürst nicht mehr an der Spitze seiner Truppen stehen könne. Gegen alle diese Sätze kann man zum Theil aus der Theorie, die sich an der Hand der Thatsachen immer weiter entwickelt, zum Theil aus den späteren Ereignissen mancherlei Einwendungen machen. Sie enthalten Abstractionen von dem damaligen Zustande, der damaligen Praxis. Aber von diesem Standpunkte aus angesehen hat Alles einen großartigen Zusammenhang und eine innere Nothwendigkeit, die eben aus dem Moment der Zeit hervorgeht. Auffallend ist es, daß man anderweit dem König Friedrich die weitaussehendsten Absichten auf neue Erwerbungen zuschrieb, während doch die Schriftstücke, die er für seinen Nachfolger niederschrieb, obwohl sie einige flüchtige Andeutungen dieser Art enthalten, doch im Großen und Ganzen nur auf die Erhaltung und Entwicklung des bestehenden Zustandes gerichtet sind. Man hat damals in Wien Anstoß daran genommen, daß der König sich Frankreich nähere. Er hat in der That einen Handelsvertrag mit Frankreich abgeschlossen, allein seine eigene wahrheitsgetreue Versicherung ist, daß dieser einzig für Handelszwecke bestimmt war, namentlich Absatz für Manufacturwaaren und Herbeiziehung baaren Geldes; weiter erstreckte sich seine Absicht dabei nicht. War aber, so dürfte man fragen, nicht seine Allianz mit Rußland auf einen solchen Zweck berechnet? Man kann mit völliger Gewißheit sagen, daß sie es nicht war. Der König setzt genau auseinander, was ihn zu derselben bewogen habe. Es war ganz allein die aus den Erfahrungen des letzten Krieges hervorgegangene Nothwendigkeit unter den großen Potenzen von Europa einen Verbündeten zu haben, von dem man keinen Bruch des Friedens zu erwarten brauchte. Rußland, welches sich zuerst von Allen von dem großen antipreußischen Bündniß zurückgezogen hatte, erschien allein geeignet dazu: denn das Verfahren, das die englische Regierung unter Georg III. gegen ihn beobachtete, erfüllte ihn mit Indignation und an Abscheu grenzendem Widerwillen. Auch gegen das Bündniß mit Rußland ließ sich Manches einwenden, namentlich war die Verpflichtung zur Bezahlung von Subsidien im Falle eines Krieges sehr anstößig. Darüber war aber nicht hinweg zu kommen. Daß der König mit der Politik Rußlands in Bezug auf Polen einverstanden gewesen sei, darf man nicht glauben. Er mißbilligte die Mittel und Wege, die zur Wahl Poniatowsky's (es ist König Stanislaus) führten, sowie die Veränderungen in der Form der Regierung, welche Kaiserin Katharina vornahm. Die Prätentionen in Bezug auf die Dissidenten, welche sie erhob, waren ihm unangenehm, aber auch dem mußte er sich fügen, um den Hauptzweck zu erreichen. Wie so ganz verkannte der österreichische Staatskanzler, Fürst Kaunitz, die Lage des Königs, wenn er einmal den Gedanken faßte, Schlesien durch eine große Combination, zu welcher die Türken mitwirken sollten, dem König wieder zu entwinden; man wollte ihn durch größere Gebiete in Polen schadlos halten; die Pforte sollte Oesterreich unterstützen, um Schlesien wieder einnehmen zu können, selbst mit Einwilligung des Königs. Mit Recht machte Kaiser Joseph darauf aufmerksam, daß dazu eine Auflösung des Bündnisses zwischen Rußland und Preußen gehören würde, woran der König nicht denken werde. Ganz ohne alle weitere Absicht war aber das Bündniß Friedrich's mit Rußland nicht. In den von ihm hinterlassenen Aufzeichnungen, welche unseren Mittheilungen an dieser Stelle zu Grunde liegen, werden mancherlei Absichten kundgegeben, deren Durchführung für das Wohl des Staates wünschenswerth sei. Die meisten jedoch sind sehr eventueller Natur; die Voraussetzung ist dabei allemal, daß große allgemeine|Veränderungen eintreten. Eine Absicht tritt dabei aber hervor, welche sehr ernstlich gemeint war und mit der er sich fortwährend trug; sie bezog sich auf den Heimfall der alten Besitzungen des brandenburgischen Hauses, Ansbach und Baireuth, welcher nahe bevor zu stehen schien und welcher eine Umwandlung in den deutschen Angelegenheiten in sich schloß. Der König wünschte im Jahre 1768 sein Bündniß mit Rußland noch auf zehn weitere Jahre verlängert zu sehen, um diesen Heimfall, welchem sich Oesterreich entgegen setzen würde, wirklich realisiren zu können.
Da trat nun aber eine Verwickelung der großen Angelegenheiten ein, welche seiner Politik eine Richtung auf neue Erwerbungen gab. Die große Frage, welche das östliche Europa schon bisher beschäftigt hatte und noch mehr beschäftigen sollte, über das Verhältniß von Rußland und der Türkei, erhob sich plötzlich in ihrer ganzen, den Orient umfassenden, auf den Occident zurückwirkenden Tragweite. So lange die Osmanen mächtig und gefährlich waren, standen Rußland und Oesterreich gegen sie zusammen; seitdem aber die Pforte aufhörte, furchtbar zu sein, zeigte sich über die Bestimmung der türkischen Grenzgebiete ein schneidendes Mißverständniß zwischen den beiden Mächten. Um keinen Preis wollte der Hof zu Wien die Moldau und Wallachei, auf welche die Russen ihr Augenmerk richteten, in die Hände derselben gerathen lassen.
Was hat diese Tendenz der Russen im Laufe der Zeiten nicht Alles veranlaßt? Der große Krieg Napoleons gegen Rußland, die letzten Entscheidungen des Krimkrieges sind durch dieselbe herbeigeführt worden und ohne unmittelbare Betheiligung mußte Preußen von derselben allezeit nahe berührt werden. Meistentheils hat die Frage auch auf die polnischen Angelegenheiten eine sehr nahe Beziehung gehabt. Damals lag sie darin, daß Stanislaus, der durch Rußland auf den Thron gekommen, von einer mächtigen Conföderation bekämpft wurde, die ihrerseits ihren Rückhalt an der Türkei hatte. Die Frage knüpfte mit anderen zusammen, welche Europa beschäftigten, namentlich den Irrungen zwischen Frankreich und England, die wieder einen allgemeinen Krieg hervorzurufen drohten; Frankreich aber war mit Oesterreich verbündet und neigte zu den Türken, England näherte sich den Russen. Ursprünglich war es der Wunsch Friedrich's, sich aller Theilnahme an diesen weit aussehenden Irrungen zu enthalten; denn „wir sind Deutsche“, sagt er einmal einem österreichischen Bevollmächtigten; „was geht es uns an, wenn Engländer und Franzosen sich um Canada schlagen oder Russen und Polen zugleich mit den Türken sich herumbalgen? Auch Oesterreich wünschte damals eine Annäherung an Preußen, schon darum, weil es von den französischen Minstern besser behandelt wurde, sobald es mit Preußen gut stand; es wäre geneigt gewesen, ein System der Neutralität in Deutschland aufzurichten, wie Friedrich II. selbst. Der junge Kaiser Joseph, zugleich durch persönliche Bewunderung und Neugierde angetrieben, besuchte den König im Jahre 1769 in Neiße, der König den Kaiser im Jahre 1770 in Mährisch-Neustadt. Bei der Zusammenkunft in Neustadt, bei welcher auch Kaunitz erschien, kam es zwischen dem Staatskanzler, welcher die österreichische Politik repräsentirte, und dem König von Preußen zu gegenseitigen Erklärungen, welche beide Theile befriedigten. Man kam überein, eine Mediation zwischen Russen und Türken zu versuchen. Die beiden Mächte hatten aber doch ganz verschiedene Stellungen zu dieser Frage. Auch Friedrich II. sah den Anwachs der russischen Macht sehr ungern; Oesterreich aber wurde von den orientalischen Ereignissen geradezu bedroht. Jeder Fortschritt der Russen erschien in Wien als eine Niederlage und Gefährdung, und wenn man den Forderungen nachfragte, welche Rußland stellte, so waren diese so beschaffen, daß das türkische Reich dabei|schwerlich hätte bestehen können. Oesterreich aber erklärte, es wolle keine anderen Nachbarn, als die Türken und werde mit Waffengewalt einschreiten, um den gegenwärtigen Zustand aufrecht zu erhalten. Die damalige Annäherung von England an Rußland erschien in so fern höchst gefährlich, als dadurch die Russen zur Herrschaft über das schwarze Meer gelangt und die verbündete Seemacht von England und Rußland alle Küsten des Continents umspannt haben würde.
Die Bedingungen, welche Katharina II. dem König für ihren Frieden mit den Türken zugehen ließ, bewogen diesen das Mediationsgeschäft vollkommen aufzugeben; er glaubte nichts weiter, als den unmittelbaren Ausbruch des Kampfes zwischen Rußland und Oesterreich voraussehen zu können. Ihn selbst berührte das nur in sofern, als die Entzweiung zwischen den Russen und Oesterreichern auch auf Polen zurückwirkte. Stanislaus, den er aufrecht zu halten verpflichtet war, wurde von Frankreich und den Conföderirten bedroht, Oesterreich war mehr auf Seite der Conföderirten. Und schon hatte Oesterreich einen Theil des polnischen Gebietes, den es als einen alten Bestandtheil von Ungarn betrachtete, in Besitz genommen: auch auf der russischen Seite aber hatte man sich überzeugt, daß der Zustand in Polen nicht haltbar sei und daß die zu Gunsten der Dissidenten übernommenen Verpflichtungen von Stanislaus nicht würden erfüllt werden können. Schon im März 1770 war der Gedanke von russischer Seite geäußert worden, daß wie Oesterreich so auch jede der beiden andern Mächte einen ihr zunächst gelegenen Theil von Polen in Besitz nehmen solle. In dieser Absicht mag man den ersten Anfang einer Theilung von Polen sehen; der Grund wäre dann die Ueberzeugung gewesen, daß die von der Kaiserin von Rußland getroffenen Einrichtungen sich nicht würden behaupten lassen, wenn Polen im bisherigen Zustand bliebe. Friedrich II. war jedoch nicht darauf eingegangen. Schon hatte man auch von österreichischer Seite den Entwurf gemacht, den König durch das Anerbieten einer Acquisition auf Kosten von Polen für sich zu gewinnen; man dachte daran, ihm Curland und Semgallen anzubieten, doch ist dies Anerbieten ihm eigentlich nicht gemacht worden; denn man sah voraus, daß er nicht darauf eingehen werde. Ohne sein Zuthun kam er in eine Lage, in welcher er zwischen Rußland und Oesterreich zu entscheiden hatte; denn weder die eine noch die andere dieser Mächte hätte sich der Feindseligkeit von Preußen aussetzen dürfen. Und wenn Oesterreich Preußen nicht für sich hatte, so durfte es nicht wagen, den Türken mit Gewalt der Waffen zu Hülfe zu kommen. Ueberdies aber, was konnte die Türkei den Oesterreichern bieten? Sie hätten gewünscht, Belgrad und Widdin, d. h. Serbien zu erwerben. Bei der ersten Erwähnung eines solchen Vorhabens aber flehte der türkische Bevollmächtigte den Kaiser Joseph an, diese Saite nicht zu berühren, es könnte dem Großherrn den Kopf kosten, wenn er darauf einginge. Die Türken haben vielmehr auch ihrerseits damals den Wiener Hof auf eine Entschädigung in Polen verwiesen; sie haben eigentlich eine Theilung des polnischen Reiches in Vorschlag gebracht zunächst zwischen Oesterreich und der Pforte. Unmöglich aber war eine solche Verbindung. Oesterreich hätte zugleich Rußland und Preußen gegen sich gehabt, und nur wenig hatte die Hülfe der Türken in ihrem damaligen Zustand zu bedeuten! In dieser Verwickelung der Dinge nun ist es gewesen, daß Friedrich II. den Plan einer partiellen Theilung von Polen wirklich gefaßt hat. Er wollte sich weder mit Rußland noch mit Oesterreich entzweien, und brachte in Erfahrung, daß Rußland diejenige seiner Bedingungen für die Herstellung des Friedens, die für Oesterreich die unangenehmste war, die Besitznahme der Moldau und Walachei, fallen lassen werde. Ihm schien es, als ob der Friede sich werde herstellen lassen, wenn nur sonst die drei Mächte zu einem Verständniß in der polnischen Angelegenheit gelangten. Unleugbar ist nun, daß|die Besitznahme der Zips und einiger angrenzenden Starosteien durch die Oesterreicher, welche bereits eine Administration der incorporirten Provinzen einsetzten, den nächsten Anlaß gab, die Idee einer Theilung ernstlich zu ergreifen. Catharina ließ vernehmen, was Oesterreich sich erlaube, müsse auch Andern gestattet sein, und wer habe nicht ähnliche Prätensionen wie Oesterreich? Friedrich II. schlug den Zuwachs an Gebiet, den Oesterreich durch jene Reunionen erlange, sehr hoch an und sah darin eine Alterirung des gegenseitigen Machtverhältnisses der beiden Monarchien; er nahm der Verstärkung von Oesterreich gegenüber auch eine Verstärkung von Preußen in Anspruch. Nicht Ausgleichung des Territorialbesitzes aber, sondern eine wesentliche Erweiterung seiner Macht faßte er dabei ins Auge. Der Augenblick schien ihm gekommen zu sein, um eine Erwerbung durchzuführen, welche ihm durch die unhaltbare geographische Position, in der er sich befand, höchst wünschenswerth gemacht wurde. Er nahm die Idee auf, die schon im 14. Jahrhundert von den Gebietigern des deutschen Ordens gefaßt worden war: Das Ordensland d. i. Ostpreußen mit Schlesien durch die Erwerbung polnischer Landesstriche in unmittelbare Verbindung zu setzen, ein Vorhaben, dessen Ausführung in jener Epoche für das Vordringen des deutschen Elementes gegen das reine Polenthum von großer Wichtigkeit gewesen wäre. Es war damals vollkommen mißlungen; durch die Verbindung mit Litthauen waren vielmehr die Polen Meister über den deutschen Orden geworden und hatten das deutsche Element zurück gedrängt. Ohne an jene alten Entwürfe anzuknüpfen, welche überhaupt in Vergessenheit begraben waren, sah Friedrich II. als Souverän von Preußen und nun auch von Schlesien in der Verbindung von Beiden durch die Erwerbungen polnischer Landstriche eine Art von geographischer Nothwendigkeit.
Schon als Kronprinz hatte er vom brandenburg-preußischen Standpunkte aus die Erwerbung von Westpreußen, welches schon früher allenthalben unter deutschem Einfluß gestanden, für höchst wünschenswerth erklärt; es war einer von den Gedanken, die dem Prinzen Eugen, der davon Kunde bekam, als ein bedeutungsvolles Zeichen des aufstrebenden Geistes des jungen Fürsten erschien. Aber an diesen Plan hatte Friedrich II. seitdem doch nicht ernstlich gedacht. Er machte sich keine Hoffnung, denselben durchzuführen, er scheute sich, einen allgemeinen Sturm heraufzubeschwören. In dem politischen Testament von 1768 bezeichnet er diese Absicht als einen Gesichtspunkt für seine Nachfolger. Nun aber traten ganz im Gegentheil europäische Verwickelungen ein, die ihn einluden, seine Hand nach diesem Besitz auszustrecken.
Sehr präcis waren die Aeußerungen der Kaiserin Katharina bei dem erwähnten Anlaß; warum wolle, sagte sie zu dem Prinzen Heinrich von Preußen, der ihr eben in Petersburg einen Besuch machte, der König von Preußen nicht auch seinerseits etwa sich das Gebiet von Ermeland aneignen? Bei dieser Eröffnung erwachte in dem Könige sein alter geographisch-politischer Gedanke; Ermeland, das die Kaiserin ihm anbot, war ihm zu unbedeutend, um sich darüber mit der öffentlichen Meinung zu entzweien, aber eine große Provinz einzunehmen, durch welche Ostpreußen mit Brandenburg und Schlesien in Verbindung gesetzt wurde, darauf ging er ein.
Von dynastischen Ansprüchen war hierbei nicht die Rede und nicht sehr weit reichte das angeregte Argument. Der Act war ein lediglich politischer, die Rechtfertigung desselben hat Friedrich nur immer darin gesucht, daß es das einzige Mittel gewesen sei, einen Krieg zwischen Rußland und Oesterreich, an dem er sich hätte betheiligen müssen und der ein allgemeiner hätte werden können, zumal da zwischen Frankreich und England ein neues Zerwürfniß auszubrechen drohte, zu vermeiden. Für sich selbst nahm er jene Gebiete in Anspruch, welche der deutsche Orden und das deutsche Reich an die Polen verloren hatten; ein Ereigniß, dessen|Fortgang entgegen getreten zu sein das vornehmste Verdienst der alten Kurfürsten aus dem Stamme der Burggrafen ausmachte. König Friedrich war jetzt im Stande, einer entgegengesetzten Strömung Bahn zu machen; er wollte zugleich Grenzen gewinnen, die er möglicherweise auch gegen Rußland in Vertheidigungsstand setzen könne, und der Gefahr vorbeugen, von einem polnischen Reiche in seiner jetzigen großen Ausdehnung, das doch künftig einmal an einen thatkräftigen König gelangen konnte, überwältigt zu werden.
Ein polnisches Reich von mäßigem Umfange hätte er geduldet. Wenn ihm aber die beiden großen Mächte das Gebiet überwiesen, welches er als unentbehrlich zu einer Consolidation seines Landes betrachtete, so hatte er Nichts dagegen, daß sich Rußland ein fünffach, Oesterreich ein dreifach größeres Territorium ausbedang. Ihm kam Alles darauf an, seinen Staat geographisch zu befestigen und in sich selbst zu consolidiren. Er wußte wohl, daß ihm auch Das schwere Ungelegenheit und Mühe zuziehen werde, aber er hatte den Grundsatz: daß der Mensch zur Arbeit geboren sei und es keine bessere geben könne, als eine solche, die zum Nutzen des Vaterlandes gereiche.
Für den preußischen Staat war die Erwerbung von Westpreußen, die im September 1772 eine vollendete Thatsache wurde, eine Bedingung seines künftigen politischen Bestehens.
Noch eine andere Bedingung aber gab es, die in Beziehungen zum deutschen Reiche lag und die nun nochmals in den Vordergrund trat.
In Folge der schlesischen Kriege war Friedrich von allem Einfluß auf Deutschland, der seiner Macht entsprochen hätte, ausgeschlossen. Oesterreich besaß das volle Uebergewicht im Reiche; es beherrschte die Reichsinstitution, es hatte die geistlichen Fürsten auf seiner Seite, und zugleich stützte es sich auf seine Allianz mit Frankreich, welches in Deutschland immer einen großen Einfluß auszuüben fortfuhr. An und für sich eine unangenehme Lage für den König, der ein Mitglied des von Oesterreich abhängigen Reichskörpers war; er hatte sich aber in dieselbe gefunden, nur durfte Oesterreich nicht noch mächtiger im Reiche werden. Aber eben dahin schienen dessen Absichten zu gehen; wie es sich denn damals durch einen einseitigen Vertrag mit den Türken ohne Rücksprache mit Rußland und Preußen der Bukowina bemächtigte, so regte sich die Besorgniß, daß es auch im deutschen Reiche durch einseitige Verträge oder Austauschungen um sich greifen werde. Friedrich war entschlossen, das nicht zu dulden. Als bei dem Abgang der wilhelminischen Linie des Hauses Wittelsbach die Oesterreicher auf Grund von alten Verträgen, deren Rechtsbeständigkeit doch sehr bezweifelt war, Niederbaiern in Besitz nahmen, rückte der König ohne Bedenken in's Feld, um sein Schwert für die Integrität von Baiern und der bisherigen Machtverhältnisse im deutschen Reich zu ziehen, nicht einmal mit dem nächsten Erben dieses Landes, der es sich vielmehr gefallen ließ, einverstanden, wohl aber mit dessen präsumtivem Nachfolger, in welchem sich die dynastischen Rechte des Hauses concentrirten.
Der Wiener Hof hatte das doch nicht erwartet.
Das Unternehmen Friedrichs hätte leicht einen allgemeinen Krieg herbeiführen können, wenn Frankreich auf die Seite von Oesterreich getreten wäre, aber die Politik Ludwigs XVI. unterschied sich auch darin von der früherer oder späterer französischer Regierungen, daß er sich einer thätigen Einmischung in deutsche Angelegenheiten enthielt. Noch wirkten die Erinnerungen an Roßbach und der große Name des tapferen Königs, der als Held des Jahrhunderts erschien.
Den Krieg aber mit Preußen allein auszufechten, war wenigstens Maria Theresia nicht gesonnen. Sie ließ dem Könige noch bei Zeiten friedliche Eröffnungen machen; hierauf kam es zu Unterhandlungen, nicht ohne die Einwirkung|von Rußland, welches auf der Seite von Preußen stand, und zum Abschluß des Friedens von Teschen, in dessen Folge die österreichischen Truppen die eingenommenen bairischen Bezirke wieder verließen und Baiern seine Stellung in Deutschland behauptete (13. Mai 1779). Für sich selbst hatte der König den Vortheil, daß seine an sich unzweifelhaften Anrechte auf die fränkischen Markgrafschaften anerkannt wurden; Maria Theresia versprach einer dereinstigen Vereinigung dieser Fürstenthümer mit den brandenburgischen Hauptlanden nicht entgegentreten zu wollen. Aber bei weitem größer war der Vortheil in Bezug auf die allgemeinen deutschen Angelegenheiten, der dem König aus dem baierischen Erbfolgekrieg erwuchs. Seine Autorität nahm unbeschreiblich zu. Die deutschen Fürsten hatten ihn bisher gefürchtet, sie fanden jetzt ihre Stütze an ihm. Grade durch diese Haltung sind die bedeutendsten Staatsmänner der späteren Zeit, Stein und Hardenberg, bewogen worden, den preußischen Dienst zu suchen; denn Preußen trete für das gute Recht ein. Die unruhige Beweglichkeit des Kaiser Joseph, der nun seiner Mutter gefolgt war, aber die alte rücksichtsvolle und conservative Politik des Hauses Habsburg verleugnete, ließ es als eine moralische Nothwendigkeit erscheinen, einen Rückhalt gegen ihn zu haben.
Das große Ereigniß der Epoche, die Emancipation der amerikanischen Colonien blieb nicht ohne Einfluß auf dies Verhältniß. Friedrich nahm für die Amerikaner von ganzem Herzen Partei. Wenn der König von England, Kurfürst von Hannover, seine Stellung in Deutschland dazu brauchte, deutsche Kriegsvölker in englischen Sold zu nehmen, um in Amerika für das englische Parlament zu fechten, so sprach Friedrich den lebhaftesten Widerwillen gegen dieses Verfahren aus, was dem deutschen National-Gefühl doch einen unerwarteten Ausdruck gewährte. Die Fürsten und die Nation faßten Vertrauen zu ihm. Und in Kurzem sollte die kaum überwundene Gefahr in etwas anderer Gestalt sich wieder erneuern. Um sich freie Hand zu verschaffen, ohne Rücksicht auf die Opposition von Preußen, gegen welches Frankreich trotz der Allianz von 1756 Nichts mehr that, noch thun konnte, hielt es der Wiener Hof für geboten, ein Einverständniß mit Rußland zu suchen.
Dazu gehörte, daß man der Kaiserin Katharina und dem Günstling derselben Potemkin in ihren orientalischen Absichten nicht mehr widerstrebte. Man kehrte zu der alten Combination, in welcher Rußland und Oesterreich gegen die Osmanen verbündet gewesen waren, zurück. Kaiser Joseph selbst unternahm schon im Jahre 1780 eine Reise an das Hoflager der Kaiserin Katharina, das er zu Mohilew antraf, um ein Verständniß mit ihr einzuleiten. Ursprünglich war zwischen ihnen nur von einer Garantie der beiderseitigen Besitzungen die Rede, aber wenn die Kaiserin fragte, ob dieselbe auch die Erwerbungen begreifen solle, die sie noch machen werde, so wies das der Kaiser nicht von der Hand, wofern nur auch Oesterreich Erwerbungen von gleichem Umfang machen könne. Gewiß war der Ehrgeiz des Kaisers auch nach dem Orient hin gerichtet, aber noch mehr lag ihm am Herzen, Rußland von Preußen zu trennen: denn nur deshalb, sagte er, sei Oesterreich den Unternehmungen Rußlands in der Türkei entgegen gewesen, weil dieses mit dem Feinde Oesterreichs, dem Könige von Preußen, in Verbindung gestanden habe.
Katharina dachte nicht, den König von Preußen fallen zu lassen. Bei den Vorschlägen über einen gemeinschaftlichen Krieg ging sie auf die Punkte nicht ein, welche für Preußen hätten gefährlich werden können; auch über die weiteren gegen die Türken selbst gerichteten Pläne hat man sich damals nicht eigentlich einverstanden; es waren Entwürfe des hochgespannten russischen und österreichischen Ehrgeizes. Allein eine andere Frage von unmittelbar praktischer Natur trat ein: Katharina II. nahm nicht allein die Unabhängigkeit der Tartaren von der|Pforte, sondern die Abhängigkeit derselben von Rußland, ohne welche sie niemals Frieden haben werde, in Anspruch; sie ergriff Besitz von der Krim.
Ganz Europa merkte auf. Alles war dagegen, ausgenommen Kaiser Joseph, der nicht gerade ein Unglück darin sah, wenn die Türken schwächer wurden. Doch geschah das nicht ohne eine entsprechende Verpflichtung von Seiten Rußlands; die Kaiserin erklärte, wenn sie die Krim, Kuban und Taman in Besitz nehme, so würde sie das dem Kaiser Joseph verdanken und dagegen dessen Interessen, die sie kenne (Brief Katharinas vom 8. Juni 1783), mit besten Kräften unterstützen. Diese Interessen aber lagen nicht im Orient. Joseph II. leistete auf die Besitznahme einer türkischen Provinz, den früheren Verabredungen gemäß, Verzicht, weil dadurch ganz Europa in Bewegung gerathen werde; es waren die Interessen Oesterreichs in Bezug auf Italien oder auf Deutschland.
Nun ist es aber hauptsächlich die Einwirkung des österreichischen Internuntius Herbert auf die Pforte gewesen, durch welche der Großherr vermocht wurde, selbst die bestehenden Verträge mit Rußland auf eine Weise zu modificiren, daß die Besitznahme Katharinas II., ohne dieselbe ausdrücklich zu erwähnen, doch durch den Wortlaut gut geheißen wurde. Das Verdienst, das sich Oesterreich um Rußland erwarb, war unleugbar und höchst umfassend.
Was war es nun aber, was Oesterreich dagegen verlangte? Das große Vorhaben auf Baiern war zuletzt gescheitert, jedoch mit nichten aufgegeben; Kaunitz und der Kaiser erneuerten es in der Form eines Austausches der österreichischen Niederlande gegen das gesammte Baiern, sie hatten dabei den doppelten Zweck im Auge, sich der unangenehmen europäischen Verwickelungen, die aus dem Besitz der Niederlande entstanden, zu entledigen und ein benachbartes Reichsgebiet zu erwerben, durch welches die eigene Macht verstärkt und der Einfluß auf das innere Deutschland unendlich vergrößert worden wäre. Für diesen großen Plan nahm der Hof von Wien die Unterstützung der Kaiserin Katharina im Mai 1784 in aller Form in Anspruch; die Kaiserin billigte denselben, indem sie zugleich auf die ihr geleisteten Dienste Bezug nahm. Das also war die große Combination. Indem Rußland die Oberhand über die Türkei erlangte, sollte für Oesterreich das Uebergewicht im deutschen Reiche auf immer begründet werden. Man hatte Grund zu hoffen, daß der Kurfürst von Baiern, Karl Theodor, dessen Trachten und Sinnen hauptsächlich nur auf äußeren Glanz gerichtet war, den Austausch billigen werde.
Es war ihm eben recht, Baiern wieder verlassen zu können; den größten Reiz hatte für ihn die Aussicht, als König von Burgund in Brüssel einzuziehen und eine europäische Rolle zu spielen.
Aber mit der Erwerbung von Baiern war Kaiser Joseph noch nicht befriedigt, er machte wegen des höheren Werthes der Niederlande Vorbehalte, durch welche es ihm möglich wurde, auch Salzburg und Berchtesgaden, gegen Entschädigungen in den Niederlanden an sich zu bringen. Auch die Oberpfalz und Neuburg wollte er sich nicht entgehen lassen, und alles ließ sich dazu an, als würde er bei dem Kurfürsten den Einwendungen, die derselbe erhob, zum Trotz, seine Absicht doch durchführen. Noch immer gab es aber dann eine noch zu erledigende Vorfrage; sie betraf die Einwilligung des nächsten erbberechtigten Agnaten, des Herzogs von Zweibrücken.
Der Kurfürst wollte mit demselben nicht unterhandeln, und der Wiener Hof stand mit ihm auf gespanntem Fuße; der erste Dienst, den nun Katharina II. dem Kaiser Joseph in dieser Sache leistete, bestand darin, daß sie ihren Gesandten Romanzow mit Unterhandlungen mit dem Herzog von Zweibrücken beauftragte, der dann dem Herzog gegenüber die ganze Sache als abgemacht bezeichnete und denselben in gebieterischen Ausdrücken aufforderte, der Abkunft über den Austausch beizutreten.
Von alle dem war nun dem König Friedrich in seinem Sanssouci keine Ahnung beigekommen. Einen sehr unangenehmen Eindruck hatten ihm die gegenseitigen Annäherungen zwischen Rußland und Oesterreich gemacht; die Uebergriffe, die sich Kaiser Joseph im Reiche erlaubte, erregten seinen Unmuth und Widerwillen, er hatte davon gesprochen, daß man sich ihnen entgegensetzen müsse, aber die Verhandlungen der beiden Kaiserhöfe waren doch in ein geheimnißvolles Dunkel gehüllt geblieben, das er nicht zu durchdringen vermochte. Wohl kam ihm ein Gerücht von einem neuen Vorhaben zu, doch schenkte er demselben keinen Glauben. Es traf ihn wie ein Blitzstrahl, als ihm der Herzog von Zweibrücken Mittheilung von den Anträgen machte, die ihm zugegangen waren, so daß an der Wahrheit der Thatsache kein Zweifel übrig blieb. Von einer heftigen Aufregung ergriffen, hat Friedrich wohl den Cäsar Joseph als einen von wilden Dämonen Besessenen bezeichnet. Nur allzu wohl aber schien derselbe sein Vorhaben combinirt zu haben. Friedrich meinte, Joseph, der in seinen Irrungen mit Holland ein Truppencorps dahinzuschicken im Begriff war, werde Baiern dabei in Besitz nehmen und ihn von Westen her bedrohen; von Osten her geschehe dasselbe durch Aufstellung der Russen in Livland; unter diesen Bedrohungen könne er nicht abermals nach Böhmen vordringen. Der französische Gesandte ließ bemerken, daß sein Hof sich dem Kaiser zuneige. Und welches Recht hatte Friedrich, dem Kaiser bei einem freiwilligen Austausch sich zu widersetzen? Nur in der Gefährdung der deutschen Reichsverfassung war ein solches zu finden, zumal da der Friede von Teschen die Hausverträge von Baiern ausdrücklich garantirte, die auch dann nicht gebrochen werden konnten, wenn der jeweilige Inhaber derselben dazu seine Einwilligung gebe.
Sein Entschluß war gefaßt, das Reich in seiner Gesammtheit zum Widerspruch gegen die Unternehmungen des Kaisers aufzurufen; schon in früherer Zeit hatte er daran gedacht, den Uebergriffen von Oesterreich durch eine Association der Reichsfürsten entgegen zu treten und auch in den letzten Jahren von einem Bunde gesprochen, wie der schmalkaldische gewesen war; diesen Gedanken ergriff er jetzt als den einzigen, der das Reich retten und ihn in seiner Stellung befestigen könne. Wenn nun aber am Tage lag, daß das ein Bündniß der Reichsstände sein müsse, so zeigte sich eine große Schwierigkeit darin, daß Friedrich mit Georg III., König von England, in mannigfaltigem Hader begriffen war, dieser aber als Kurfürst von Hannover schon an und für sich sowie durch seine Verbindung mit Hessen und Mecklenburg und durch seine Stellung überhaupt das größte Ansehen besaß. Ohne ihn wäre nichts auszurichten gewesen. Die Uebergriffe von Oesterreich hatten in der eigenen Familie des Königs Georg, sowie allenthalben in Deutschland Widerwillen erweckt, doch würde dies noch nicht zum Ziele geführt haben, wäre nicht ein englisches Interesse soeben durch Joseph verletzt gewesen.
In seinen Irrungen mit Holland hatte der Kaiser die alten europäischen Verträge, durch welche den Holländern einige feste Plätze in den österreichischen Niederlanden als Barriere gegen Frankreich zugestanden waren, eigenmächtig gebrochen, indem er diese selbst in Besitz nahm; insofern hatten dieselben allerdings keinen Werth mehr, als sie dazu dienen sollten, die österreichischen Niederlande gegen Frankreich zu schützen, diese aber keines Schutzes weiter bedurften, da zwischen Oesterreich und Frankreich das intimste Verhältniß bestand und auf immer befestigt zu sein schien Eben dies Verhältniß aber machte auf der andern Seite die Behauptung der Festungen nicht allein für Holland, sondern auch für England wünschenswerth.
Die Engländer waren nicht gemeint, diese Eigenmächtigkeit ruhig hinzunehmen;|und man erlebte, daß die Verbindung Hannovers mit England Deutschland doch wieder einmal zu statten kam; der König von England trat als Kurfürst von Hannover unter der doppelten Rücksicht auf sein Erbland und im allgemeinen Interesse den Intentionen Friedrich's bei. Es war ein hannoverischer Staatsmann, der die Acte des Bundes, mit welchen Friedrich II. umging, in den Formen, die denselben allgemein annehmbar machten, verfaßte.
Sachsen gesellte sich ohne Schwierigkeit zu; die drei Kurfürsten vereinigten sich zum Schutze der Stände des Reiches, um sie bei ihrem Besitz sowie bei ihren Hausverträgen zu schützen und jede Verletzung derselben zuerst in der Reichsversammlung zur Sprache zu bringen und, wenn dies nichts fruchte, weitere und kräftigere Mittel zu verabreden. Allenthalben im Reiche hatte man Furcht unter das Joch von Oesterreich zu gerathen. Die Erklärung der drei Kurfürsten erschien als eine Protection für Alle und zwar nicht allein für die weltlichen Fürsten, sondern auch für die geistlichen; auch der Kurfürst von Mainz, als Kurerzkanzler vor den Uebrigen angesehen, gesellte sich dem Bunde bei. Dem Reichsoberhaupte, welches von Allen gefürchtet wurde, trat ein reichsständischer Bund entgegen, als dessen Oberhaupt der König von Preußen erschien, der Einzige unter ihnen, der eine selbständige Macht besaß. Ein Moment für die Geschichte und Nation liegt doch darin, daß dadurch die Entzweiungen der beiden Confessionen, die bisher Deutschland gleichsam in zwei verschiedene Körper getrennt hatten, factisch beseitigt wurden. Der nationalen Einheit wurde weitere Bahn gemacht, und die Herrschaft dieses Gedankens in künftigen Zeiten vorbereitet. Die Absicht des Austausches fiel in Kurzem in sich selbst zusammen; der Löwe hatte nur seine Mähnen zu schütteln gebraucht, um die Anschläge der Gegner zu vernichten.
Ueberhaupt dienten die letzten Jahre Friedrich's nur dazu, der Welt den Frieden zu erhalten. Er stand in freundschaftlichem Vernehmen mit allen großen Potenzen; die Gefahr eines orientalischen Krieges kümmerte ihn nicht, da der Kaiser dadurch gehindert werden würde, sich in andere Angelegenheiten zu mischen. Am 15. August 1786 hat er noch seinen Geschäftsträger in Petersburg ermahnt, sich nicht zu viel um die kleinen Zerwürfnisse um dortigen Hofe zu bekümmern, denn auf dergleichen Dinge komme es bei den großen Angelegenheiten nicht an. Immer mit der Politik beschäftigt, aber doch erhaben über die momentanen Kundgebungen ist er am 17. August 1786 auf seinem Lehnstuhl verstorben; zwischen seiner Thätigkeit und seinem Tod trat nur das Intervall eines krankhaften Schlummers ein.
Ein Heldenleben, wie es im 18. Jahrhundert möglich war, von großen Gedanken durchzogen, voll von Waffenstreit, Anstrengungen und schicksalsvollem Wechsel der Ereignisse, unsterblich durch das, was es erreichte, die Erhebung des preußischen Staates zu einer Macht, unschätzbar durch das, was es begründete für die deutsche Nation und die Welt.
Litterarische Note.
Von alle dem, was nach Friedrich's Tod in Deutschland über ihn erschienen ist, hat Nichts einen besonderen wissenschaftlichen Werth. Man sammelte Anekdoten und Charakterzüge und suchte sich „den Einzigen“, wie man ihn nannte, in seinem Thun und Lassen zu vergegenwärtigen. Allgemeinere Gesichtspunkte faßte das Ausland. Der Engländer Gillies unterbrach seine Studien über die griechische Geschichte, um den Beweis zu führen, daß auch in neuerer Zeit Männer leben|könnten, denen es gelinge, etwas Außerordentliches zu vollbringen. In Frankreich, welches noch die allgemeine Litteratur beherrschte, traten Lob und Tadel einander scharf entgegen. Das erste stammt von dem kriegskundigen Guibert, der unter allen Kriegführern nur Einen zu finden meinte, Cäsar, der mit Friedrich verglichen werden könne; das andere von Mirabeau, der ein weitschichtiges Werk über die preußische Monarchie schrieb, in dem er die Verwaltung Friedrich's von einem den Grundsätzen desselben entgegengesetzten Standpunkte darstellte und verwarf. Indem man zu urtheilen begann, erhielt man erst authentische Kunde. Die posthumen Werke des Königs erschienen, die sich über Politik und Krieg der Epoche mit möglichster Objectivität, d. h. Wahrhaftigkeit verbreiteten und ein unvergängliches Monument für sein Leben und seine Gesinnung bilden. Die Mangelhaftigkeit des ersten Druckes gab den nächsten Anlaß zu der Gesammtausgabe der litterarischen und militärischen Werke Friedrich's, die durch die Munificenz des Königs Friedrich Wilhelms IV. unter den Auspicien der Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1846—57 in 30 Bänden erschienen ist. Sie hat für die Studien der ganzen Epoche eine hohe Bedeutung. Alle neueren Forschungen und Darstellungen beruhen auf derselben. Um zu einer Geschichte des Königs zu gelangen, durfte man aber nicht versäumen, die in den Archiven des Staates bisher verborgen gebliebenen Aktenstücke zu benutzen. Aber auch dabei konnte man nicht stehen bleiben; man mußte die französischen und englischen Archive durchforschen. Von größtem Werthe war, daß auch die österreichischen eröffnet wurden. Es würde zu weit führen die verschiedenen Arbeiten, die auf diesen Grundlagen entstanden sind, einzeln aufzuführen; schon ist auf eine vollständige Catalogisirung aller über Friedrich erschienenen Schriften Bedacht genommen. Aber noch ein wichtiges Unternehmen ist im Werke. Auch die politischen Aufsätze und Correspondenzen Friedrich's des Großen sollen, und zwar abermals unter den Auspicien der königlichen Akademie der Wissenschaften gesammelt und dem Publikum mitgetheilt werden. Allmählich muß sich die zufällige und sporadische individuelle Kenntnißnahme zu wirklicher Wissenschaft ausgestalten.
-
Author
L. v. Ranke. -
Citation
Ranke, Leopold von, "Friedrich der Große" in: Allgemeine Deutsche Biographie 7 (1878), S. 656-685 [online version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118535749.html#adbcontent