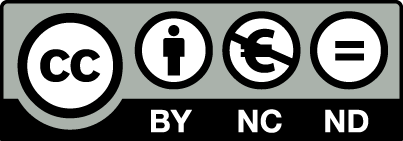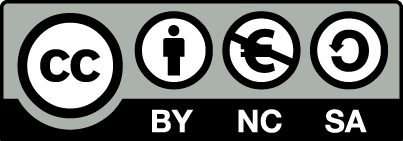Liebig, Justus Freiherr von( seit 1845)
- Lebensdaten
- 1803 – 1873
- Geburtsort
- Darmstadt
- Sterbeort
- München
- Beruf/Funktion
- Chemiker ; Professor in Gießen und München
- Konfession
- evangelisch
- Normdaten
- GND: 118572741 | OGND | VIAF: 51763678
- Namensvarianten
-
- Liebig, Justus von
- Liebig, Justus (bis 1845)
- Liebig, Justus Freiherr von( seit 1845)
- liebig, justus freiherr von
- Liebig, Justus von
- Liebig, Justus (bis 1845)
- liebig, justus
- Liebig, Justus, Freiherr von
- Liebig, J. von
- Liebig, Johann Justus
- Liebig, Giusto de
- Liebig, G.
- Liebig-Mohr
- Libich, Justus
- Libikh, I︠ustus
- Von Liebig, Justus
Vernetzte Angebote
- LeMO - Lebendiges Museum Online [1998]
- National Academy of Science: biographical Memoirs [1877-]
- * Wissenschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert zwischen Deutschland und Russland auf den Gebieten Chemie, Pharmazie und Medizin [2007-]
- Essays and Resources on the Experimentalization of Life [1993-2007]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Das Königreich Bayern - Biographien [2006]
- * Hessische Biografie [2004-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1985] Autor/in: Priesner, Claus (1985)
- Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste [1975-]
- Biographien der Entomologen der Welt (SDEI) [1974-]
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Ladenburg, Albert (1883)
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Les Membres de l'Académie des sciences depuis sa création en 1666 [2017]
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Historische Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) [2005-]
- Mitglieder der Leopoldina [2006-]
- * Wissenschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert zwischen Deutschland und Russland auf den Gebieten Chemie, Pharmazie und Medizin [2007-]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Behring-Nachlass digital
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- * Ernst Haeckel Online Briefedition
- * Die wissenschaftliche Korrespondenz des Historikers Karl Hegel
- Alfred Escher-Briefedition (via metagrid.ch)
- EGO European History Online
- * Mitglieder der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW)
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- Carl Friedrich Gauss Briefwechsel - Onlineverzeichnis
- Universitätssammlungen
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Nachlass Sommerfeld beim Deutschen Museum
- * Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Archivportal - D
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Personen in Bavarikon [2013-]
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- Personen der wissenschaftsgeschichtlichen Sammlung des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Biodiversity Heritage Library (BHL)
- * Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014]
- National Portrait Gallery
- Porträtsammlung des Münchner Stadtmuseums
- * Porträts der Mitglieder der BAdW
- Digiporta - Digitales Porträtarchiv
- LeMO - Lebendiges Museum Online [1998]
- Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste [1975-]
- * Porträtnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Bildarchiv im Bundesarchiv
- * Digitaler Portraitindex
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
Personen im NDB Artikel
Personen in der GND - familiäre Beziehungen
- NDB 2 (1955), S. 20* (Beilstein, Konrad Friedrich)
- NDB 2 (1955), S. 706 (Buchner, Ludwig Andreas)
- NDB 3 (1957), S. 8*
- NDB 3 (1957), S. 158*
- NDB 3 (1957), S. 577*
- NDB 3 (1957), S. 158 (Carriere, Philipp Moriz)
- NDB 3 (1957), S. 631 (Diamant, Moritz)
- NDB 3 (1957), S. 670 (Dieterich, Gustav Heinrich Wilhelm Eugen)
- NDB 4 (1959), S. 24 (Döllinger, Johann Joseph Ignaz von)
- NDB 4 (1959), S. 248 (Ebermayer, Wilhelm Ferdinand Ernst)
- NDB 5 (1961), S. 237 (Fleitmann, Franz Friedrich Theodor)
- NDB 7 (1966), S. 688* (Harnack, Karl Gustav Adolf von)
- NDB 9 (1972), S. 447* (Hofmann, August Wilhelm von)
- NDB 9 (1972), S. 447 (Hofmann, August Wilhelm von)
- NDB 10 (1974), S. 40 (Humboldt, Alexander von)
- NDB 10 (1974), S. 588 (Jolly, Friedrich)
- NDB 11 (1977), S. 424 (Kekulé, August)
- NDB 12 (1980), S. 151* (Knapp, Friedrich)
- NDB 12 (1980), S. 151 (Knapp, Friedrich)
- NDB 12 (1980), S. 343 (König, Joseph)
- NDB 15 (1987), S. 72 (Loew, Oscar)
- NDB 16 (1990), S. 312 (Martius, Carl Alexander von)
- NDB 16 (1990), S. 493 (Maximilian II.)
- NDB 17 (1994), S. 116 (Merck)
- NDB 19 (1999), S. 80 (Nestlé, Henri)
- NDB 19 (1999), S. 510 (Oldenbourg, Rudolf)
- NDB 20 (2001), S. 272 in Artikel Pettenkofer (Pettenkofer, Max Josef von)
- NDB 20 (2001), S. 509 in Familienartikel Platen-Hallermund
- NDB 20 (2001), S. 580 in Artikel Poggendorff (Poggendorff, Johann Christian)
- NDB 20 (2001), S. 302 (Pfaundler, Leopold)
- NDB 20 (2001), S. 510 (Platen-Hallermund, Karl August Georg Maximilian Graf)
- NDB 21 (2003), S. 143 in Artikel Ranke (Ranke, Johannes)
- NDB 21 (2003), S. 166* (Rassow, Peter)
- NDB 22 (2005), S. 437 in Artikel Sarg (Sarg, Johann Heinrich Karl)
- NDB 22 (2005), S. 691 in Artikel Scherer (Scherer, Johann Jakob Joseph von)
- NDB 23 (2007), S. 100 in Artikel Schlossberger (Schlossberger, Julius Eugen)
- NDB 23 (2007), S. 189 in Artikel Schmidt (Schmidt, Georg Gottlieb)
- NDB 23 (2007), S. 200 in Artikel Schmidt (Schmidt, Ernst Carl Heinrich)
- NDB 23 (2007), S. 239 in Artikel Schmitt
- NDB 24 (2010), S. 751 in Artikel Sprengel
- NDB 25 (2013), S. 196 in Artikel Steinheil
- NDB 25 (2013), S. 381 in Artikel Stöckhardt
- NDB 26 (2016), S. 73 in Artikel Thaer (Thaer, Albrecht Daniel)
- NDB 26 (2016), S. 135* (Thiersch, Carl)
- NDB 26 (2016), S. 207 in Artikel Thudichum (Thudichum, Johann Ludwig Wilhelm (John Louis)
- NDB 26 (2016), S. 36 in Artikel Traube
- NDB 26 (2016), S. 373 in Artikel Trautschold (Trautschold, Gustav Heinrich Ludwig Hermann von)
- NDB 26 (2016), S. 444 in Artikel Trommsdorff (Trommsdorff, Johann Bartholomäus)
- NDB 26 (2016), S. 720 in Artikel Varrentrapp (Varrentrapp, Franz)
- NDB 27 (2020), S. 55 in Artikel Vogt (Vogt, Carl August Christoph)
- NDB 27 (2020), S. 76 in Artikel Voit (Voit, Karl Michael von)
- NDB 27 (2020), S. 87 in Artikel Volhard ( Volhard, Jacob)
- NDB 27 (2020), S. ( Volhard, Jacob)
- NDB 27 (2020), S. 247 (Wagner, Paul Christoph)
- NDB 27 (2020), S. 897 ( Westermann, George)
- NDB 28 (2024), S. 120 in Artikel Wilbrand (Wilbrand, Johann Bernhard)
- NDB 28 (2024), S. 175-176 in Artikel Will
- NDB 28 (2024), S. 375 in Artikel Wöhler (Wöhler, Friedrich)
- NDB 28 (2024), S. 437 in Artikel Wolff (Wolff, Emil Theodor von)
- NDB 28 (2024), S. 488 in Artikel Wollny (Wollny, Martin Ewald)
- NDB 28 (2024), S. 575 in Artikel Zachariä von Lingenthal (Zachariä von Lingenthal, Karl Eduard)
- NDB 28 (2024), S. 589* (Zahn-Harnack, Agnes von, geborene Harnack)
- NDB 28 (2024), S. 175 (Will, Heinrich)
- NDB 28 (2024), S. (Will, Heinrich)
- NDB 28 (2024), S. 697 (Zillig, Wolfram)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Liebig, Justus Freiherr von (hessischer Freiherr 1845)
Chemiker, * 12.5.1803 Darmstadt, † 18.4.1873 München. (evangelisch)
-
Genealogie
V Joh. Georg L. (1775-1850), Drogeriewaren- u. Farbenhändler, Beigeordneter in D., S d. Schuhmachers Joh. Ludwig in D. (aus Bauernfam. im Odenwald) u. d. Maria Catharina Abel;
M Maria Caroline adopt. Möser (1781–1855), T d. Christoph Einselin, aus Kirchheim/Teck, Schneidergeselle in D., u. d. Elisabeth Fuchs;
⚭ Darmstadt 1826 Henriette (1807–81), T d. hess. Hofkammerrats Wilhelm Moldenhauer u. d. Lisette Antoinette Schirmer;
2 S, 3 T, u. a. →Georg (1827–1903), Dr. med., Privatdozent, Bez.- u. Badearzt in Reichenhall (s. BJ VIII; Pogg. III, IV, VI), →Hermann (1831–94), Agrikulturchemiker (s. Hess. Biogr. III, 1934, S. 377-80, W), Agnes (⚭ →Moriz Carrière, † 1895, Philosoph, s. NDB III), Johanna (⚭ →Karl Thiersch, † 1895, Prof. d. Chirurgie);
E →Eugen (1868–1925), Dr. iur., Prof., Dir. im Aufsichtsamt f. Privatversicherung, →Hans (1874–1931), Prof. d. Chemie in Gießen, Schriftsteller (s. Pogg. V, VI), Amalie Thiersch (⚭ →Adolf v. Harnack, † 1930, ev. Theologe, s. NDB VII), Lina Thiersch (⚭ →Hans Delbrück, † 1929, Historiker u. Politiker, s. NDB III). -
Biographie
L. brach 1818 seine Gymnasialausbildung in Darmstadt ab und wurde für zehn Monate Apothekerlehrling in Heppenheim. Ende 1819 begann er in Bonn mit dem Studium der Chemie bei →K. W. G. Kastner, dem er 1821 nach Erlangen folgte. Als Burschenschafter nahm er hier an Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Bürgern teil und mußte im Frühjahr 1822 die Stadt fluchtartig verlassen. In Darmstadt erhielt L. ein staatliches Stipendium für ein Studium in Paris. Hier wiesen Michel Chevreul mit seinen Untersuchungen der Fette und →Joseph-Louis Gay-Lussac mit seinen Blausäure-Arbeiten der noch in den Anfängen steckenden organischen Chemie den Weg. L. konnte seine in Erlangen begonnenen Untersuchungen des Knallsilbers bzw. des Quecksilberfulminats fortsetzen. →Gay-Lussac referierte L.s Fulminatuntersuchungen am 28.7.1823 in einer Sitzung der Pariser Akademie, wo seine Ausführungen auf Interesse stießen und Zustimmung fanden. Gemeinsam setzten sie die Arbeiten fort. Es gelang, die Knallsäure zu isolieren, als Säure zu identifizieren und sie wieder in ihr Silber- bzw. Quecksilbersalz zu überführen. Am 22.5.1824 konnte L. seine Resultate persönlich in einer Sitzung der Akademie vortragen. Dieser Vortrag wurde bestimmend für seinen weiteren Lebensweg. →Alexander v. Humboldt hatte der Sitzung beigewohnt und regte beim Ghzg. →Ludwig I. von Hessen an, L. mit einer Professur auszustatten. Dieser war inzwischen in absentia von →Kastner in Erlangen promoviert worden. Am 26.5.1824 wurde er Extraordinarius an der Univ. Gießen, 1825 Ordinarius.
Mit L., der das Modell des systematischen Studienaufbaus einführte, brach in Deutschland eine neue Ära des chemischen Universitätsunterrichts an: Von entsprechenden Vorlesungen begleitete Praktika, die einem festgelegten Programm folgten, sowie regelmäßige Prüfungen führten den Studenten Schritt für Schritt in die Chemie ein. Erst ganz am Ende dieses Weges stand die gemeinsame Forschungsarbeit mit dem Professor. Das Studium begann mit der qualitativen anorganischen Analyse, für die L. erst einen systematischen Trennungsgang konzipieren mußte. L. kam es keineswegs nur auf eine Rationalisierung oder Effektivitätssteigerung an. Der von ihm eingerichtete Studiengang sollte auch ein Verstehen der geistigen Grundlagen der „Naturwissenschaft“ ermöglichen, nicht zuletzt im Hinblick auf eine Abgrenzung zur Naturphilosophie. 1826 lernte er →Friedrich Wöhler kennen. Die beiden kongenialen jugendlichen Forscher fanden alsbald zu einer tiefen Freundschaft, die lebenslang hielt und sich in ca. 1 500 wissenschaftshistorisch bedeutsamen Briefen dokumentierte.
L.s Ruf als Lehrer und Forscher drang bald über die Grenzen des Großherzogtums hinaus. Viele Ehrungen wurden ihm zuteil, bei den Auslandsreisen nach Frankreich (1828, 1837) und England (1837, 1842, 1844, 1845, 1851) zeigte sich sein internationales Ansehen. Trotzdem wurde ihm von seiten des Großherzogs keineswegs die Unterstützung zuteil, die seinem Schaffen angemessen gewesen wäre. Als L. nach Gießen kam, existierte kein Laboratorium. Um überhaupt arbeiten zu können, war L. genötigt, einen erheblichen Teil seines Gehalts für Chemikalien, Geräte und die Bezahlung von Hilfskräften auszugeben. In einem Gartenhaus richtete er sich ein privates Laboratorium ein. Nach Übernahme des Ordinariats wurde ihm ein Kasernengebäude als Laboratorium zugewiesen, und es wurden neun Arbeitsplätze eingerichtet. Erst 1839 wurde der Bau erweitert und ein Hörsaal mit 60 Plätzen angegliedert. Trotz der wenig zufriedenstellenden Arbeitsbedingungen in Gießen lehnte L. Berufungen nach Petersburg (1837), Wien (1839) und Heidelberg (1851) ab. Der Wechsel nach München 1852 wurde von →Max Pettenkofer initiiert, der 1844 einige Monate bei L. gearbeitet hatte.
Die wichtigste und am schwersten zu erfüllende Forderung L.s in München war sein Wunsch nach Freistellung von der Leitung eines Unterrichtslabors. Eben jene wesentliche Neuerung in der Gestaltung des Studiums, die er in Gießen eingeführt hatte, wollte er in München nicht mehr weiterführen. Der Grund lag in der außerordentlichen Arbeitsbelastung, die sich L. durch Forschungsvorhaben, Vorlesungen und Publikationen aufgebürdet hatte. Seine großartige, schon in Gießen entwickelte Experimentalvorlesung, über deren Aufbau und Inhalt wir durch ein erhalten gebliebenes Vorlesungsbuch informiert sind, wurde durch öffentliche Abendvorlesungen ergänzt. Seine Vorträge waren ungemein beliebt und erhielten durch die Teilnahme von Angehörigen des Königshauses den Rang gesellschaftlicher Ereignisse.
Diese Bemühungen zur Verbreitung von Kenntnissen über die Chemie wurden ergänzt durch die „Chemischen Briefe“ und seine Vorträge vor der Akademie der Wissenschaften. Die „Chemischen Briefe“ erschienen seit 1841 in der literarischen Beilage der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“ und erlangten ungewöhnliche Publizität. L. befaßt sich darin mit der Erläuterung chemischer Problome und mit der Bedeutung der Chemie für den Wohlstand des Staates und der Gesellschaft. Sie waren in allgemeinverständlicher Form verfaßt, zeichneten sich durch Prägnanz und Klarheit aus und erreichten im Stil literarisches Niveau. 1844 erschienen die ersten 26 Briefe als Buch, das ins Englische und Französische übersetzt wurde. Die Briefsammlung erlebte bis 1878 sechs Auflagen, die Zahl der Briefe erhöhte sich auf 50. Auch mit diesem Unternehmen betrat L. Neuland; die Chemischen Briefe sind wohl der erste geglückte Versuch, chemische Kenntnisse breiten Kreisen zu vermitteln. 1838 schon war L. korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften geworden. 1859 ernannte ihn →König Max II. zum Akademiepräsidenten; dieses Amt übte L. bis zu seinem Tod aus. Als Präsident hielt er zweimal jährlich einen Vortrag vor der Akademie. 1861 sprach er über das Thema „Wissenschaft und Landwirtschaft“. Er stellte einen umfassenden Bezug zwischen der Aufgabe der Akademie, der Ausbreitung der Wissenschaft zu dienen, dem schwierigen Problem des Wissenschaftlers, dieses Wissen zu vermehren, und der sinnvollen Anwendung dieser Kenntnisse her, wobei die Landwirtschaft als Modell herangezogen wurde. Sein Anliegen, die Landwirtschaft auf wissenschaftlicher Grundlage weiterzuentwickeln, war auch das Motiv für seine ausgedehnten agrikulturchemischen Forschungen. 1863 sprach L. über „Francis Bacon von Verulam und die Geschichte der Naturwissenschaften“. Seine kritische Behandlung Bacons löste eine weitere Kontroverse in L.s an wissenschaftlichen Disputen keineswegs armen Leben aus. In München verlagerte sich der Schwerpunkt von L.s Arbeiten von der reinen zur angewandten Forschung; die Vortragstätigkeit erhielt immer mehr Gewicht. Damit trug L. entscheidend zur Popularisierung der Chemie als Wissenschaft und Beruf bei und gab dringend nötige Anstöße zur Verbesserung der Situation in Lehre und Forschung – Voraussetzungen für das Aufblühen der chemischen Industrie in Deutschland.
L.s überragende Bedeutung für die Chemie des 19. Jh. liegt in der Entwicklung der organisch-chemischen Elementaranalyse, der Radikaltheorie und der Agrikulturchemie. Die begriffliche Unterscheidung zwischen Atom und Molekül existierte noch nicht, es bestand auch noch keine Klarheit über das reale Vorhandensein von Atomen. Daraus ergaben sich erhebliche Probleme beim Verständnis und der Formulierung chemischer, insbesondere organisch-chemischer Umsetzungen. Die qualitative Zusammensetzung organischer Stoffe war leicht zu klären. Zur Aufklärung von Reaktionen bzw. Strukturen kam indessen der Ermittlung der quantitativen Zusammensetzung von Substanzen eine entscheidende Rolle zu, die mit der heutigen relativ geringen Bedeutung der Elementaranalyse nicht zu vergleichen ist. Die Grundidee, die Zusammensetzung einer Substanz aus ihren gasförmigen Verbrennungsprodukten zu ermitteln, war schon lange bekannt, nicht aber ein einfaches und zuverlässiges Verfahren hierfür. Problematisch waren die Bestimmung der Verbrennungsgase auf volumetrischem Weg und die Reaktion von Stickstoff zu Stickoxiden bei der Verbrennung. Auf L. gehen zwei scheinbar einfache Verfahrensänderungen zurück, die die Elementaranalyse von einer langwierigen und nur von sehr geübten Chemikern durchführbaren Prozedur zu einer Standardmethode machten. Es handelt sich um die Separierung der Stickstoffbestimmung von der C/H-Analyse und um die Einführung des Fünf-Kugel-Apparates.
Durch die Erkenntnis der Notwendigkeit einer eigenen Stickstoffbestimmung und die Angabe eines geeigneten, wenn auch umständlichen Verfahrens wurde der Weg für die später allgemein befolgte Methode von Dumas geebnet und eine prinzipielle Fehlerquelle ausgeschaltet. L.s Fünf-Kugel-Apparat war ein kleines, zu einem Dreieck gebogenes Glasrohr mit fünf Ausbauchungen. Das Gerät wurde mit Kalilauge gefüllt und absorbierte das gebildete Kohlendioxid, das nunmehr durch Wägung bestimmt werden konnte, ebenso wie das von Calciumchlorid aufgenommene Wasser. Die leicht abbrechbare Spitze des Verbrennungsrohres gestattete es, die Verbrennungsgase durch Durchsaugen von Luft vollständig zu absorbieren. Somit traten präzise Wägungen an die Stelle ungenauer und mit vielen Systemfehlern verbundener Volumenmessungen. Erst dadurch wurde es möglich, zuverlässiges Datenmaterial zu gewinnen und dies in vertretbaren Zeiträumen und deshalb in größerer Menge.
In den 1820er Jahren waren bereits mehrere hundert organische Einzelsubstanzen bekannt, und ständig kamen neue hinzu. Da nur der Kohlenstoff eine solche Vielzahl von Verbindungen hervorbrachte und sich hierin von den übrigen Elementen deutlich unterschied, ergab sich die Frage, wie dies zu erklären sei. Hier setzt die von L. und Wöhler entwickelte Radikaltheorie an. Schon bei Lavoisier war der Grundgedanke ausgesprochen, daß die Vielfalt der organischen Verbindungen dadurch zu erklären sei, daß diese gewisse Basisstrukturen bilden, die den Elementen der anorganischen Chemie vergleichbar seien, eben die Radikale. Zunächst wurde dieser Gedanke nicht weiter verfolgt, bis 1832 die von L. und Wöhler gemeinsam verfaßte Arbeit „Über das Radikal der Benzoesäure“ erschien. Die Untersuchung des Bittermandelöls hatte ergeben, daß dieses zu Benzoesäure oxidiert werden konnte und zwar unabhängig von seinem Blausäuregehalt lediglich durch Sauerstoffaufnahme. Die Umsetzung des Bittermandelöls mit alkoholischer Kalilauge ergab neben Kaliumbenzoat ein öliges Reaktionsprodukt, das in seinen Eigenschaften nicht mit dem Bittermandelöl übereinstimmte. Die Autoren zogen aus diesen Befunden den Schluß, daß es ein aus Kohlenstoff und Wasserstoff aufgebautes Radikal geben müsse, das sie als „Benzoyl“ bezeichneten. Das Benzoyl ergebe bei der Oxidation Benzoyloxid (d. h. Benzoesäure), bei der Reduktion Benzoylwasserstoff (Benzylalkohol).
Diese Abhandlung lenkte das Interesse vieler Fachkollegen auf die Radikale. L. untersuchte in der Folge die Konstitution von Alkohol und die Reaktionen bei der Etherbildung. Gerade die bei der Entstehung von Diethylether durch Umsetzung von Alkohol mit Schwefelsäure ablaufenden Reaktionen erschienen sehr rätselhaft, da sich die Schwefelsäure offenkundig dabei nicht verbrauchte. Zu diesem Thema erschienen viele Arbeiten, u. a. von J. B. Dumas, G. S. Sérullas und →Magnus. L. trachtete danach, ein Radikal des Ethanols oder des Ethers zu finden, und wurde deswegen zeitweilig in eine Kontroverse mit Dumas verwickelt. 1834 bemerkte L. in einer Anmerkung zu einer in den „Annalen“ abgedruckten Arbeit von Dumas, man habe den Ether „als Oxyd eines zusammengesetzten Radikals zu betrachten, entsprechend der Formel C4H10 + O“. Das Radikal war also der Körper C4H10, sein Oxid der Ether. Später schloß sich Dumas der Auffassung L.s weitgehend an, und 1837 erschien eine gemeinsame Veröffentlichung „Über den gegenwärtigen Stand der organischen Chemie“ (in franz. Sprache), in der die Hauptaussagen der Radikaltheorie zusammengefaßt sind. Die Radikale sind demnach quasi die Elemente (im heutigen Sprachgebrauch) der organischen Chemie; jedes derselben kann eine Vielzahl von Reaktionen eingehen, ohne selbst in seinem Aufbau verändert zu werden. Die Radikale waren somit zum Ordnungsprinzip der Organik geworden und zugleich zum Erklärungsmuster für den Ablauf von Umsetzungen. Ausgehend von der Radikaltheorie, gelangte Dumas später zu einer „Typentheorie“, die die organischen Stoffe nach ihrem Bauprinzip einfachen organischen Verbindungen zuordnet, z. B. Ethanol dem Typus „Wasser“.
Die Radikaltheorie war L.s bedeutendster Beitrag zur Entwicklung der chemischen Theorie, doch liegen von ihm auch andere bemerkenswerte Äußerungen zu theoretischen Fragen vor. So setzt sich L. im fünften seiner „Chemischen Briefe“ mit der Frage nach der Existenz von Atomen auseinander. Er weist darauf hin, daß es sehr wohl sein könne, daß jene irgendwie zusammengesetzt seien und fährt fort:„ … ein physikalisches Atom würde in diesem Sinne eine Gruppe von viel kleinern Theilchen sein, die durch|eine Kraft oder durch Kräfte zu einem Ganzen zusammengehalten werden, stärker wie alle auf dem Erdkörper zu ihrer weiteren Spaltung uns zu Gebote stehenden Kräfte.“
Gegen Ende der 1830er Jahre verlagerte sich der Schwerpunkt der Forschungen L.s auf die physiologische Chemie. 1840 erschien das epochemachende Werk „Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie“ (⁵1846). Darin unternimmt L. den großangelegten Versuch, das Wachstum der Pflanzen zu erklären, insbesondere die Frage, woher die Pflanze die zu ihrer Existenz notwendige Materie bezieht. Er widerspricht der gängigen Ansicht, die Pflanze decke ihren Kohlenstoffbedarf aus dem Humus; dieser sei nichts weiter als ein Zersetzungsprodukt von Pflanzenteilen, aber niemals deren Kohlenstoffquelle, denn zum einen gedeihen manche Pflanzen auch in sehr humusarmen Böden, zum anderen nehme der Humusgehalt des Bodens über längere Zeiträume betrachtet nicht ab, sondern zu, obwohl von den Feldern beträchtliche Mengen pflanzlichen Kohlenstoffs abgeerntet würden. Da die Pflanze ihren Kohlenstoffbedarf nicht aus dem Boden deckt, muß sie ihn aus der Luft decken – durch Aufnahme von Kohlendioxid. Der Boden stellt nach L. lediglich die von der Pflanze benötigten anorganischen Substanzen zur Verfügung. Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff entnimmt die Pflanze der Atmosphäre. Die Versorgung mit Stickstoff glaubte L. über in der Luft enthaltene Ammoniakspuren erklären zu können, erkannte aber gleichwohl die Bedeutung stickstoffhaltigen Düngers. Gleichzeitig stellte L. einen Wirkungszusammenhang zwischen der Tier- und der Pflanzenwelt fest: Die Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab, die Tiere veratmen Sauerstoff und emittieren Kohlendioxid. Das von ihm so bezeichnete „Gesetz des Minimums“ besagt, daß die Fruchtbarkeit eines Bodens für eine bestimmte Pflanzenart von seinem Gehalt an jenem Nährstoff abhängt, dessen Konzentration am niedrigsten ist. Der Mangel an einer Substanz kann nicht durch ein Mehrangebot eines oder mehrerer anderer Nährstoffe ausgeglichen werden.
L. hatte neben dem Studium des Verhaltens lebender Pflanzen auch umfangreiche Analysen verschiedener Planzenaschen vorgenommen. Ausgehend von der plausiblen Annahme, daß das Verhältnis der (anorganischen) Aschenbestandteile einer Pflanzensorte Aufschlüsse über das Mischungsverhältnis der von dieser Pflanze benötigten Mineralstoffe gebe, hatte er eine Reihe von Spezialdüngern für Weizen, Kartoffel, Gras usw. entwickelt. Hierbei beging er einen folgenschweren Fehler. Um nämlich zu verhindern, daß der ausgestreute Dünger von Regen und Grundwasser gelöst und rasch weggeführt wurde, setzte er schwerlösliche Substanzen ein. Er hatte entdeckt, daß Pottasche beim Zusammenschmelzen mit Kalk eine in kaltem Wasser kaum lösliche Verbindung ergibt. Auf dieser Substanz basierte der von ihm in Zusammenarbeit mit der Firma Muspratt & Co. in Liverpool hergestellte Patentdünger. Die praktische Erprobung dieses Düngers zeigte verheerende Ergebnisse. Die Erträge stiegen gar nicht oder kaum und standen jedenfalls in keinem Verhältnis zum Preis des Düngers. Dieser Mißerfolg bewirkte auch die Ablehnung der meisten anderen Ansichten L.s zur Pflanzenernährung und zum Pflanzenstoffwechsel. Man wandte sich wieder der schon im 18. Jh. entwickelten Methode der Düngung mit Stickstoffverbindungen zu. Die Gründe für das Versagen seines Düngers blieben L., der gleichwohl von der Richtigkeit seiner Thesen überzeugt blieb, lange Zeit rätselhaft. Die Lösung fand er schließlich in der Fähigkeit der Bodenkrume, wasserlösliche Stoffe durch Resorption zu binden und an die Wurzeln weiterzugeben. Die von L. in seiner „Agrikulturchemie“ formulierten Thesen erwiesen sich am Ende als zutreffend, und somit hat L.s Werk seine grundlegende Bedeutung bis heute nicht verloren.
Neben der Agrikulturchemie suchte L. seine chemischen Erkenntnisse auch anders für die Praxis zu nutzen: durch die Herstellung von Säuglingssuppe und von Fleischextrakt. Schon zur Beschäftigung mit der Pflanzenchemie war er nicht zuletzt aufgrund der im 19. Jh. in Europa vielfach prekären Ernährungslage gekommen. Arbeiten zur Verbesserung der Brotherstellung führten zu Untersuchungen, die die Erzeugung einer die Muttermilch ersetzenden Babynahrung zum Ziel hatten. L. ging davon aus, daß das Surrogat der Zusammensetzung der Muttermilch möglichst ähneln solle. Zwei Substanzen erschienen ihm von Bedeutung zu sein, die „Blutbildner“ und die „Wärmeerzeuger“ (Die heute übliche Einteilung der Nahrungsbestandteile in Proteine, Fette und Kohlenhydrate war noch unbekannt). Nach L.s Ansicht eignete sich eine Mischung aus Kuhmilch und Weizenmehl, der er Kaliumhydrogencarbonat hinzufügte, als Ersatz. Allerdings war diese Mischung etwas saurer als die Muttermilch, und zudem mußte die im|Mehl enthaltene Stärke erst durch Verdauungssäfte (Enzyme) in Zucker umgewandelt werden, was den Organismus belastete und den Nährwert der Nahrung minderte. Da er wußte, daß Muttermilch als Alkali hauptsächlich Kalium enthält, sah L. einen geringen Zusatz von Kaliumcarbonat vor. Die Umwandlung der Mehlstärke in Zucker wurde durch Beigabe von Malz erreicht, das die Stärke bei leicht erhöhter Temperatur rasch spaltet. Trotz ihrer vielversprechenden Eigenschaften setzte sich die Suppe nicht durch, da ihre Zubereitung für die Hausfrauen zu umständlich war.
Anders lagen die Dinge bei L.s Fleischextrakt. Obwohl dessen Nutzen und Nährwert gering sind, fand er weiteste Verbreitung und wird noch heute hergestellt. Ursprünglich wollte L. die in Südamerika und Australien vorhandenen enormen Rinderbestände besser für die Ernährung der Europäer nutzen. Wegen der großen Entfernungen konnte das Fleisch der Tiere nicht nach Europa gebracht werden. Die Zucht erfolgte – was den Export betraf – lediglich der Häute und des Talgs wegen. L. schlug vor, das Fleisch mit Wasser gründlich auszukochen und die entstehende Brühe einzudikken. Der dabei anfallende Rückstand war der „Fleischextrakt“. Seine Herstellung erfolgte bald in industriellem Maßstab und verschaffte L. beachtliche Einkünfte. Ursprünglich vertrat er die Ansicht, der Fleischextrakt sei ein echtes Nahrungsmittel und könne gewissermaßen „Brot in Fleisch verwandeln“. Mit Pettenkofer geriet er hierüber in eine Auseinandersetzung, die schließlich mit der Einsicht endete, der Extrakt sei zwar kein Nahrungs-, wohl aber ein hochwertiges, verdauungsförderndes und geschmacksverbesserndes Genußmittel.
Seit 1831 war L. Mitherausgeber von Lorenz Geigers „Magazin für Pharmazie und die dahin einschlagenden Wissenschaften“. Es wurde unter dem Namen „Annalen“ – nach L.s Tod in „Liebig's Annalen“ umbenannt – zum wichtigsten Periodikum der deutschen Chemie. L. betonte immer die Vorrangstellung empirisch-experimenteller Arbeiten gegenüber spekulativ-theoretischen Betrachtungen. Er selbst entschied über die Aufnahme jedes einzelnen Artikels und nahm so Einfluß auf Stil und Richtung der deutschen Chemie. Eine Trennung zwischen seiner Funktion als Redakteur und der des Kritikers hielt er für undurchführbar. Er begriff seine Tätigkeit bei den „Annalen“ als eine Art Wächteramt. – L.s immer rückhaltlose, sich nicht selten zu polemischer Schärfe steigernde Kritik hat ihm viele Feinde geschaffen, ebenso wie seine Fähigkeit, zu loben und eigene Fehler einzuräumen, ihm Freunde machte.
L. zählt zu den bedeutendsten Chemikern des 19. Jh. Seine Leistungen für die Gestaltung des chemischen Studiums, seine Beiträge zur Theorie der Organischen Chemie und die vielfachen praktischen Anwendungen der Chemie, insbesondere auf dem Gebiet der Landwirtschaft, begründen seine auch international herausragende Stellung. Der Aufstieg Deutschlands zur führenden Nation im Bereich der Chemie wie der chemischen Industrie, der im letzten Jahrhundert begann und sich bis zum 2. Weltkrieg fortsetzte, ist mit seinem Namen untrennbar verbunden.|
-
Auszeichnungen
Mitgl. d. Ak. d. Wiss. München (1838), Wien (1848) u. Berlin (1855);
Pour le mérite f. Wiss. u. Künste (1851), Maximilians-Orden f. Wiss. u. Kunst (1853, Vorstand d. Ordenskap. 1853–73). -
Werke
S. C. Paoloni, J. v. L., Eine Bibliogr. sämtl. Veröff., 1968. |
-
Nachlass
Nachlaß: München, Bayer. Staatsbibl. u. Bibl. d. Dt. Mus.; Gießen, Univ.bibl.
-
Literatur
ADB 18;
A. R. v. Schrötter, in: Alm. d. Ak. d. Wiss. Wien 23, 1873, S. 127-44;
M. v. Pettenkofer, Dr. J. Frhr. v. L. z. Gedächtnis, 1874 (Rede in d. Ak. d. Wiss.);
Aus J. L.s u. F. Wöhlers Briefwechsel in d. J. 1829–73, hrsg. v. A. W. Hofmann, 1888;
J. Volhard, J. v. L., 2 Bde., 1909;
R. Kuhn, Das Vermächtnis J. v. L.s, Festrede, 1953;
C. Wurster, in: Die Gr. Deutschen III, 1957, S. 313-26 (P);
R. Pummerer, in: Geist u. Gestalt, Biogr. Btrr. z. Gesch. d. Bayer. Ak. d. Wiss., II, 1959, S. 133-53 (L);
O. P. Krätz u. C. Priesner, L.s Experimentalvorlesung, 1983 (P);
Pogg. I, IV, VI, VII a Suppl.;
Dict. of Scientific Biogr. VIII, 1973. - Zur Geneal.:
O. Praetorius, in: Ahnentafeln berühmter Deutscher I, 1919 ff.;
Fam. u. Volk 4, 1955, S. 1-6. -
Porträts
Gem. v. W. Trautschold, 1842 (Gießen, Univ.), Abb. in: Die Gr. Deutschen im Bild, 1937;
Gem. v. L. Thiersch (München, Bayer. Ak. d. Wiss.), Abb. in: Jb. d. Bayer. Ak. d. Wiss. 1953;
Denkmal v. M. Wagmüller, 1883 (ebd., Maximiliansplatz). -
Autor/in
Claus Priesner -
Zitierweise
Priesner, Claus, "Liebig, Justus Freiherr von (hessischer Freiherr 1845)" in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 497-501 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118572741.html#ndbcontent
-
Liebig, Justus von
-
Biographie
Liebig: Justus v. L., geb. den 12. Mai 1803 zu Darmstadt, † den 18. April 1873 zu München. Unter den Männern der Wissenschaft, die nicht allein auf ihrem Gebiete zu Reformatoren geworden, sondern mit genialem Blick hinübergriffen in benachbarte Fächer und diese in ihrer Wechselwirkung zu einem|großen Ganzen vereinten, steht der Name „Liebig“ in erster Reihe. Stets waren es vornehme Geister, die sich mit der Ergründung und dem Studium der Natur beschäftigten, sei es in abstrakter, philosophischer Speculation, sei es im praktischen Experimentiren. Beides vereint macht den großen Naturforscher; er lauscht der Natur ihre allgemeinen Gesetze ab, begründet und beweist sie durch Versuche und verwerthet die so gewonnenen Erfahrungen für das praktische Leben. Ein solch bevorzugter Geist ist L. gewesen. In seiner Wissenschaft steht er neben den Ersten aller Zeiten gleichberechtigt da, der Landwirth erkennt in ihm seinen Meister und auch die Physiologie räumt ihm einen Ehrenplatz ein — die Menschheit im Allgemeinen nennt täglich seinen Namen und zehrt von seinen Schöpfungen.
L. war keines jener Glückskinder, denen leicht und spielend alles in den Schoß fällt, die genial und verwöhnt durchs Leben gehen. Ernst und schwer hat er sich von Anfang an schon sein Studium und später auch alles andere, was er erstrebte, erkämpfen müssen. Aber ideale Begeisterung für die Lebensaufgabe, die er sich gestellt, volle Hingabe an dieselbe in strenger, unermüdlicher Arbeit, und die feste Ueberzeugung von der Richtigkeit seines Strebens und von dem bleibenden Nutzen, den er seiner Mitwelt damit zu erringen hoffte, halfen ihm über alle Klippen hinweg. Seine äußere Erscheinung hat günstig für ihn gewirkt, denn wenn es auch wol zum Theil dichterische Begeisterung ist, die seinen Jugendfreund Platen von ihm sagen läßt: „Liebig ist immer schön. Eine schlanke Gestalt, ein freundlicher Ernst in seinen regelmäßigen Gesichtszügen, große, braune Augen mit dunkeln, schattigen Brauen nehmen auf den ersten Blick für ihn ein“, so hat er doch selbst noch in seinem Alter auf jeden, der ihn sah, einen unvergeßlichen Eindruck gemacht. Man fühlte sich sogleich gefesselt von seinen Adleraugen, erkannte in ihm den hervorragenden Geist, imponirend in Blick und Wesen. Herausfordernd kühn und kampfbereit im Sprechen und Schreiben, war sein persönlicher Verkehr von bestrickender Liebenswürdigkeit. Noch heute schwärmen alle für ihn, die je ihn gekannt. Auf seine Schüler wirkte er mit dämonischer Macht, Freunde erwarb er sich für's Leben aus allen Berufsklassen. Mit Begeisterung gedenkt Dingelstedt seiner in seinen Münchner Erinnerungen und Paul Heyse spricht von dem unauslöschlichen Eindruck, den Liebig's Persönlichkeit auf ihn gemacht. A. W. Hofmann, sein Schüler und warmer Verehrer, hebt neben der stetigen geistigen Anregung zum Selbstschaffen, die er seinen Schülern angedeihen ließ, vor Allem seine unbestechliche Wahrheitsliebe hervor, die ihn jeden begangenen Irrthum auf das Bereitwilligste anerkennen ließ. In diesem Streben nach Wahrheit, in dem Kampfe für dieselbe ist auch der Hauptgrund seiner weitverzweigten Polemik zu suchen: er bekämpfte eben das, was ihm falsch erschien, in jeder Gestalt und gegen jeden, den er im Irrthum glaubte.
L. ist im J. 1803 am 12. Mai zu Darmstadt geboren. Sein Vater besaß hier ein kleines Material- und Farbwaarengeschäft und dies blieb nicht ohne Einfluß auf die Richtung, die der Geist des früh entwickelten Knaben einschlug. Schon früh hatte er hier Gelegenheit ein wenig zu experimentiren und während er die Gelehrtenschule seiner Vaterstadt besuchte, las er nach und nach alle ihm erreichbaren chemischen Werke und Zeitschriften der sehr reichhaltigen Hofbibliothek durch und wiederholte die darin beschriebenen Versuche. Hierbei kam ihm sein großes Talent, mit einfachen Mitteln Apparate zusammenzustellen, sehr zu statten, und war es auch die Vertrautheit mit der Beschäftigung seines Vaters, die ihm diese Versuche erleichterten, so war es jedenfalls schon der Drang des Forschers, der ihn unbewußt dazu trieb. Auch während der Schulstunden war er mit seinen Gedanken mehr bei seinem Lieblingsstudium. Daher galt er im Gymnasium für einen nur sehr mittelmäßig begabten Schüler. Er zog sich vielen Tadel zu und erregte das Staunen und Gelächter der ganzen Klasse, als er auf die ungeduldige Frage des Lehrers: „was denn eigentlich aus ihm werden solle?“ ohne sich zu besinnen antwortete: „ein Chemiker“. Dies war in damaliger Zeit etwas ganz Unerhörtes, denn alles das, was jetzt das Studium der Chemie als Wissenschaft wie für die Praxis zu einem der gesuchtesten macht, dem sich Hunderte und Tausende der fähigsten Jünglinge widmen, hat eigentlich L. erst geschaffen. Die einzige Möglichkeit, um damals wirklich Chemie experimentell zu betreiben, war Apotheker zu werden, und so entschloß sich denn auch der Vater, den jungen L., dessen Leidenschaft nur allzuklar zu Tage trat, nach Heppenheim zu einem Apotheker in die Lehre zu geben. Hatte der Knabe nun aber zu Hause schon auf eigne Faust Experimente gemacht, besonders Versuche mit Knallsilber, wobei er das ganze Haus durch Explosionen in Aufregung versetzte, so fuhr er dort mit mehr Mitteln nun erst recht fort, sein Knallsilber zu untersuchen und knallte damit so nachdrücklich, daß es seinem Meister unheimlich wurde und er ihn nach zehn Monaten wieder nach Hause schickte. L. hatte Vielleicht auch erkannt, daß dort nichts mehr für ihn zu lernen war und die Lösung des Verhältnisses auf diese Weise herbeigeführt. Zu Hause widmete er noch einige Monate den Sprachstudien und dann ermöglichte ihm ein Stipendium Ludwigs I. von Hessen, der sich von seiner Kindheit auf für ihn interessirt und auch die Benutzung der Hofbibliothek ihm damals gestattet hatte, im J. 1819 nach Bonn zu gehen, wo er chemische Vorlesungen bei Kastner (Bd. XV S. 439) hörte. Diesem folgte er auch nach Erlangen. Hier machte er die Bekanntschaft Platen's, die zu einem überschwänglichen Freundschaftsbund der beiden Jünglinge führte, welcher, wenn schon durch kleine Mißverständnisse manchmal getrübt, bis an das Lebensende Platen's dauerte. Platen besang seinen Freund und ihre Freundschaft in vielen seiner formenschönen Ghaselen und Sonetten, von denen hier das folgende seinen Platz finden mag:
„An Justus Liebig!“ „Den Freund ersehnend, welcher treu dem Bunde Mich reich ergänzen kann, in Sein und Wissen, Fühlt ich mein Herz durch manchen Wahn zerrissen. Und eitle Täuschung schlug mir manche Wunde. Da bringt Dein Auge mir die schöne Kunde, Da find ich Dich, um weiter nichts zu missen; Wir fühlen beide schnell uns hingerissen, Zu Freunden macht uns eine kurze Stunde. Und kaum genießen wir des neuen Dranges, Als schon die Trennung unser Glück vermindert Beschieden uns vom prüfenden Geschicke. Doch ihres innigen Zusammenhanges Erfreu'n die Geister sich noch ungehindert. Es ruh'n auf goldner, künft'ger Zeit die Blicke.“
Platen, Frühjahr 1822.
Die Trennung, von der das Sonett spricht, trat auch bald gewaltsam ein und nie sahen sie sich wieder, doch wechselten sie Jahre lang die ausführlichsten Briefe und nahmen den innigsten Antheil an ihrer gegenseitigen Entwickelung. Ihm zeigte L. auch später mit beredten Worten seine Verlobung an.
Erlangen ist für L. überhaupt die Zeit der geistigen Gährung, des Suchens nach dem festen Grund seines späteren Lebens. Zwei Jahre verlor er, indem er sich ganz dem Eindruck der Schelling’schen Vorlesungen und seiner Metaphysik hingab; erst nach und nach machte er sich davon frei, erkannte, daß der Naturforscher zuerst die Aufgabe habe, Thatsachen zu erkennen, bevor er philosophische Schlüsse ziehen dürfe, und ernüchtert und entmuthigt kehrte er 1822 Erlangen den Rücken, nachdem er, wie er selbst sagt, „von jenem Taumel erwacht war“. Sein Doctorexamen hatte er dort noch bestanden und auch seine erste wissenschaftliche Untersuchung „Ueber Brugnatelli's und Howard's Knallsilber“ veröffentlicht.
Nun lenkte L. seine Schritte nach Paris, wo damals in der Chemie die hervorragendsten Männer wirkten und lehrten. Besonders zogen ihn Gay-Lussac, Thenard und Dulong an, in ihnen erkannte er die Hauptträger wissenschaftlichen Fortschritts und es gelang ihm, im Laboratorium von Thenard Eingang zu finden. Hier setzte er seine Untersuchungen über das Knallsilber fort und diese verschafften ihm die für seine ganze Zukunft bedeutungsvolle Bekanntschaft Humboldt's, dessen herzliche Freundschaft er sich mit der Zeit erwarb. —
Es war in der französischen Akademie, der er seine Arbeit vortragen durfte, wo der unbekannte deutsche Student zum ersten Mal dem berühmtesten deutschen Forscher gegenüberstand. L. erzählt diese Begegnung in der an Alexander v. Humboldt gerichteten Dedication seines im J. 1840 erschienenen Werkes „Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie": „Zu Ende der Sitzung vom 28. Juli 1823 mit dem Zusammenpacken meiner Präparate beschäftigt, näherte sich mir aus der Reihe der Mitglieder der Akademie ein Mann und knüpfte mit mir eine Unterhaltung an; mit der gewinnendsten Freundlichkeit wußte er den Gegenstand meiner Studien und alle meine Beschäftigungen und Pläne von mir zu erfahren; wir trennten uns, ohne daß ich aus Unwissenheit und Scheu zu fragen wagte, wessen Güte an mir theilgenommen habe. Diese Unterhaltung ist der Grundstein meiner Zukunft gewesen, ich hatte den für meine wissenschaftlichen Zwecke mächtigsten und liebevollsten Freund und Gönner gewonnen“ etc. Dem war wirklich so — durch Humboldt's Einfluß öffneten sich ihm alle Thüren und ebneten sich ihm alle Wege, die ihm zu seinem Studium in der französischen Hauptstadt nothwendig waren. Vor Allem das sonst kaum zugängliche Laboratorium Gay-Lussac's. Humboldt war ein intimer Freund dieses genialen Forschers, hatte mit ihm 17 Jahre früher gemeinschaftliche Versuche über die Volumzusammensetzung des Wassers ausgeführt, und ihm gelang es seinen Freund zur Aufnahme des jungen, vielversprechenden Deutschen zu bestimmen und somit dessen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. So wurde L. der Schüler eines der bedeutendsten Experimentatoren seiner Zeit und nicht hoch genug ist der Nutzen, den er aus diesem Verhältniß zog, anzuschlagen. Der Lehrer, der damals in der Blüthe der Jahre stand, scheint den jungen Mann bald liebgewonnen, ihn eingeweiht zu haben in den reichen Schatz seiner schöpferischen Phantasie, während er ihm andererseits als ein damals kaum erreichtes Vorbild an Genauigkeit und Schärfe der experimentellen Methoden voranging. Wie nahe diese Beiden bald sich kamen, zeigt der Umstand, den L. später häufig erzählte, daß ihn Gay-Lussac, wenn sie ein neues interessantes Resultat gefunden hatten, bei den Schultern packte und mit ihm um den Laboratoriumstisch tanzte. L. hat sich denn auch immer mit großer Liebe jener Zeit erinnert und sie eine der schönsten Perioden seines Lebens genannt. Daß er Gay-Lussac Treue und Dankbarkeit sein Leben hindurch bewahrte, brauche ich kaum zu erwähnen — nicht unerwähnt darf es aber bleiben, daß er sich durch die politische Strömung des Jahres 1870—71 nicht verleiten ließ in die chauvinistische Kriegstrompete zu blasen, sondern daß er damals, die Aufgabe des Gelehrten in solcher Zeit richtig erkennend, in einer ausführlichen Rede vor der bairischen Akademie alles hervorhob, was die gelösten Bande internationalen Verkehrs wieder anknüpfen konnte und gerade da besonders betonte, wie viel wir Deutsche überhaupt, und er im Speciellen, von den Franzosen gelernt haben.|Hier in Gay-Lussac's Arbeitsstätte ist wol auch in ihm der Gedanke entstanden, es als eine Hauptaufgabe seines Lebens zu betrachten, die Vortheile, die er selbst genießend erkannte, seinen deutschen Landsleuten im eignen Vaterlande zu schaffen: der Gedanke, das erste deutsche chemische Laboratorium zu gründen und damit aus der todten philosophischen Disciplin in Deutschland die Chemie zu einer lebenden Naturwissenschaft umzuwandeln, die als solche bis heute schon großartige unabsehbare Resultate aufzuweisen hat. Dadurch übernahm Deutschland die Leitung in dieser Wissenschaft auf lange Jahre hinaus.
Sehr bald bot sich L. die Gelegenheit seine Pläne zu verwirklichen. Wieder hatte er es Humboldt zu danken, auf dessen Empfehlung der Großherzog Ludwig I. ihn im J. 1824 zum außerordentlichen Professor der Chemie in Gießen ernannte und ihn nach zwei Jahren ebendaselbst zum Ordinarius beförderte.
Trotz seiner hohen Gönner hatte der junge 21jährige Docent einen harten Stand und Schritt für Schritt mußte er sich alles erkämpfen. Zuerst begegnete er der Mißachtung seiner Collegen, die in der Anstellung des „Ausländers“ — da L. weder in Gießen promovirt noch dort studirt hatte — und in der Gründung einer neuen Professur für ihn nichts als Favoritenwirthschaft sahen. Die Chemie erkannten sie nicht als Wissenschaft an, den Lehrer nicht als zu ihrer Zunft gehörig, da war es schwer, fast undenkbar, mehr erreichen zu wollen. Und doch trat L. seine Stellung mit dem festen Vorsatz an, nicht nur Chemie zu dociren, sondern ein Laboratorium zu gründen. Kümmerlich richtete er sich mit eignen Mitteln ein, ließ aber keine Gelegenheit vorübergehen, auf das Nachdrücklichste in Darmstadt zu werben, um die nothwendigsten Gelder bewilligt zu erhalten — immer vergebens. Er scheiterte an der Gleichgültigkeit der Minister, an dem Argwohn der Collegen, die eine solche Aufopferung für die Wissenschaft nicht verstehen konnten, und welche darin, daß L. alle erforderlichen Kosten selbst bestritt, versteckte Privatinteressen witterten.
Schließlich, als nach 10jähriger Wirksamkeit, die ihm schon europäischen Ruf verschafft hatte, er immer nichts erreichen konnte, als er durch Nahrungssorgen und Ueberanstrengung geschwächt in Baden-Baden Heilung suchte, übermannte ihn die Entrüstung. Er schrieb einen Brief an den Kanzler Linde in Darmstadt, der zuerst von seinem Schwiegersohn Carrière veröffentlicht, schon vielfach citirt wurde und auch hier stellenweise seinen Platz finden mag, da er einen tiefen Blick gestattet in Liebig's Gemüthsverfassung und zugleich all' die Leiden und Kämpfe der vergangenen 10 Jahre erkennen läßt. — Er hatte den Bau eines Auditoriums verlangt, um dadurch für das längst zu klein gewordene Laboratorium Raum zu gewinnen. Man hatte darunter nur „seine Privatinteressen“ gesehen und dem Antrag keine Folge gegeben. „Ich hätte freilich an Annehmlichkeit dadurch gewonnen, aber alle diese Einrichtungen bezogen sich nicht auf meine Person, sondern wären für die Universität bleibend gewesen und hätten dem chemischen Lehrstuhle einen Vorzug vor allen in Deutschland gesichert. Für die Anstalten einer Universität darf man die größten Summen verwenden, denn das steigert die Achtung und Anhänglichkeit an sie; aber die strengste Controle muß über die Zweckmäßigkeit der Verwendung geführt werden! Man hat diese Summen, aber verwendet sie auf eine unerträglich lächerliche Art! Mir ist Gewißheit nöthig, was ich in Gießen zu erwarten habe. Auf das Aeußerste getrieben, werde ich diesen Winter nicht mehr dahin gehen, gleichviel ob ich Urlaub erhalte oder nicht. Ich werde diesen Schritt zu rechtfertigen wissen, denn es ist wol Niemand an der Universität in auffallenderer Weise als ich mißhandelt worden. Mit 800 Gulden Besoldung kann man in Gießen nicht leben. Gemeinschaftlich mit einigen anderen Collegen bin ich vor vier Jahren um eine Besoldungserhöhung eingekommen, sie ist uns abgeschlagen worden. Sie haben mich|mit Lächeln versichert, daß die Staatskasse keine Fonds besitze; ich habe daraus gesehen, daß Sie Kummer und quälende Nahrungssorgen nie gekannt haben. Von diesem Augenblicke an habe ich durch unablässiges Arbeiten mir eine unabhängige Stellung zu erwerben gesucht; meine Anstrengungen sind nicht ohne Erfolg geblieben, aber sie sind über meine Kräfte gegangen, ich bin dabei invalid geworden; und wenn ich jetzt, wo ich den Staat nicht mehr bedarf, erwäge, daß mit einigen elenden hundert Gulden meine Gesundheit in früheren Jahren nicht gelitten hätte, indem mein Leben sorgenfreier gewesen wäre, so ist es für mich der härteste Gedanke, daß meine Lage Ihnen bekannt war. Die Mittel, welche das Laboratorium besitzt, sind von Anfang an zu gering gewesen. Man gab mir vier leere Wände statt eines Laboratoriums; an eine bestimmte Summe zur Ausstattung desselben, zur Anschaffung eines Inventariums ist trotz meiner Gesuche nicht gedacht worden. Ich habe Instrumente und Präparate nöthig gehabt und bin gezwungen gewesen jährlich 3—400 Gulden aus eignen Mitteln dazu zu verwenden; ich habe neben dem Famulus, den der Staat bezahlt, einen Assistenten nöthig, der mich selbst 320 Gulden kostet; ziehen Sie beide Ausgaben von meiner Besoldung ab, so bleibt davon nicht so viel übrig, um nur meine Kinder zu kleiden. Aus dieser ursprünglichen Behandlung des Laboratoriums hat sich die Folge herausgestellt, daß es kein Eigenthum besitzt, denn ich kann nachweisen, daß die Einrichtungen, die Instrumente, die Präparate, welche das Gießener Laboratorium — ich kann es ohne Erröthen sagen — zum ersten in Deutschland gemacht haben, mein Eigenthum sind. ... Ich will nicht mehr von mir sprechen, meine Rechnung mit Gießen ist abgeschlossen; mein Weg ist nicht der Weg der Reptilien, ob dieser auch der leichteste, wenn auch schmutzigste ist. Das Gesagte wird hinreichen, um meinen Entschluß bei dem Ministerium und dem Fürsten zu rechtfertigen, daß ich diesen Winter in Gießen nicht lesen kann ... Wenn ich gesund bin, wird es mir an Kraft nicht fehlen, eine Art Universität für meine Lehrzweige auf eigne Hand zu errichten. Wird es mir nicht erlaubt und erhalte ich meinen Abschied, so befreit mich dieser von dem Vorwurf der Undankbarkeit gegen das Land, aus dessen Mitteln meine Ausbildung möglich war. Ich habe manches Unrecht, manches falsche Urtheil zu tragen gelernt, aber dieser Vorwurf wäre für meine Schultern zu schwer.“ — Dieser Brief scheint denn auch den gewünschten Eindruck gemacht zu haben und es wurden seine sehr bescheidenen Wünsche befriedigt.
Die Gründung der Gießener Schule unter L. ist eine That, die in der Geschichte der Naturwissenschaften eine hervorragende Stelle einzunehmen verdient. L. hat hier bewiesen, wie hoch er den Nutzen experimenteller Anleitung, wie er ihn bei Gay-Lussac genossen, stellte; er hat die inductive Methode, welche Bacon philosophisch als die für die Naturforschung nothwendige erkannt hatte, praktisch in den Unterricht eingeführt. Welchem Bedürfniß die Gründung des Gießener Laboratoriums entsprach, zeigte sich bald durch den außerordentlichen Zudrang von Schülern, welche zu ihm von allen Theilen des gebildeten Europa's strömten. Er entfaltete nun sein großartiges Talent als Lehrer, die Schüler zum Selbstschaffen anregend. Die große Zahl glänzender Namen, die aus seiner Schule hervorgegangen, zeugen für den Erfolg seiner Lehrmethode. Fast 30 Jahre seines Lebens ist L. in dieser Art thätig gewesen, einen großen Theil seiner Zeit dem Unterrichte widmend. So ward er im wahren Sinne des Wortes ein Reformator seiner Wissenschaft — und wie alle Reformatoren zog auch er sich unendlich viele Feinde zu, deren Bekämpfung er sich auf das Schärfste und Tapferste angelegen sein ließ. Im J. 1840 schrieb er zwei von sittlicher Entrüstung dictirte Broschüren an die Adresse der Regierungen gerichtet: „Ueber den Zustand der Chemie in Preußen“ und „Ueber den Zustand der Chemie in Oesterreich“.|Sie wirkten sehr verschieden an den verschiedenen maßgebenden Stellen — in Berlin versuchte man sie zu ignoriren, ja man verbot sogar den Preußen in Gießen zu studiren — von Oesterreich aus dagegen schickte man Jünglinge in sein Laboratorium, um des genialen Kämpfers Unterricht zu genießen, und ihm selbst bot man eine Professur in Wien an. Dieser sowie mehreren anderen Verlockungen nach Außen widerstand L., um sich seiner Lebensaufgabe ungestört widmen und bei dem ruhigeren Leben der kleinen Stadt neben seiner ausgebreiteten Lehrthätigkeit seine eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen, die er vom großartigsten, allgemeinen Standpunkte aus betrieb, fortsetzen zu können. —
Gleich Anfangs hatte sich L. die Aufgabe gestellt, das damals fast noch ganz brach liegende Gebiet der organischen Chemie zu durchforschen und ihren wissenschaftlichen Zusammenhang mit der anorganischen Chemie herzustellen. Dazu bedurfte es einer genauen Erkenntniß der elementaren Zusammensetzungen; für Mineralkörper gab es leichte Methoden der Analyse, für organische nur sehr schwierige: und so sann L. nun auf eine gründliche Verbesserung der Methode, die es ermöglichen sollte, die elementare quantitative Zusammensetzung der organischen Verbindungen womöglich ebenso schnell zu ermitteln, wie die der anorganischen. Die Art, wie er nach und nach zu der noch jetzt gebräuchlichen „Elementaranalyse“ gelangte, ist ein Beweis für sein schöpferisches Genie. Hier wo es sich um die Bestimmung von Kohlensäure und Wasser handelt, welche durch Verbrennung organischer Substanzen entstehen, war man durch die aufeinander folgenden Bemühungen eines Lavoisier, Saussure, Gay-Lussac und Berzelius dahingelangt, die betreffende organische Substanz mit einem, Sauerstoff enthaltenden und diesen in höherer Temperatur leicht abgebenden Körper gemischt, in einer horizontalen Röhre zu glühen, das entstehende Wasser in einem mit Chlorcalcium gefüllten Rohr aufzufangen und zurückzuhalten, so daß das Gewicht desselben durch zwei Wägungen des Rohrs vor und nach dem Versuch bestimmt werden konnte; während man die Kohlensäure in einem Gasmeßrohr auffing und aus der Feststellung ihres Volumens das Gewicht berechnete. Diese Bestimmung der Kohlensäure verlangte eine Reihe von Manipulationen, welche die ganze Methode zu einer sehr schwierigen und umständlichen machte, so daß sich nur sehr wenige Chemiker dieser Aufgabe unterziehen mochten. L. beseitigte nun jenen Uebelstand, indem er lehrte, wie man Kohlensäure auch dem Gewicht nach bestimmen kann: er construirte den nach ihm benannten Fünf-Kugel-Apparat, der mit Kalilauge zur vollständigen Absorption der Kohlensäure gefüllt und von der bei der Verbrennung gebildeten Kohlensäure durchstrichen wird. Die Differenz der Wägungen des Apparats vor und nach der Verbrennung gibt auch hier wieder das Gewicht der Kohlensäure. Durch diese unbedeutend scheinende Veränderung ist die Elementaranalyse eine der einfachsten und leicht und schnell ausführbarsten Operationen geworden, welche in jedem Laboratorium täglich in Anwendung kommt und welche es ermöglicht, die Zusammensetzung der zahllosen neuen Körper zu ermitteln. Ohne diese Entdeckung Liebig's wäre die ganze heutige organische Chemie undenkbar; und er selbst und seine Schüler haben auf diese Weise mit bewundernswerthem Fleiße jahrelang Material gesammelt als Grundlage seiner späteren Forschungen.
Das erste Resultat, welches nach dieser Richtung hin von dauerndem Einfluß geblieben ist, ist eine im J. 1833 mit Wöhler gemeinschaftlich publicirte Abhandlung über „Das Bittermandelöl und seine Abkömmlinge“. Vor dem näheren Eingehen auf die Bedeutung dieser Arbeit ist es wol hier am Platz, mit wenigen Worten des Freundschaftsbündnisses zu gedenken, welches zwischen L. und Wöhler schon damals bestand und bis zum Tode des ersteren fortdauerte. Die beiden Forscher waren zunächst durch eine wissenschaftliche Streitfrage miteinander in Berührung gekommen. Wöhler hatte nämlich bei der Untersuchung der Cyansäure für deren Zusammensetzung dieselben Zahlen gefunden, welche L. aus der Analyse für die Knallsäure erschlossen hatte. Eine solche Uebereinstimmung der Zusammensetzung bei vollständiger Verschiedenheit der Eigenschaften der betreffenden Körper erschien damals unmöglich; dennoch ergaben die fortgesetzten Untersuchungen auf beiden Seiten die Richtigkeit der Behauptungen: diese Resultate waren das erste Beispiel einer jetzt als sehr allgemein vorkommend erkannten Eigenschaft der Materie, die durch Berzelius im J. 1830 als „Isomerie“ bezeichnet wurde. — Das sich aus diesen Arbeiten entwickelnde Freundschaftsbündniß zwischen L. und Wöhler ist für beide, als Menschen wie als Forscher, eine reiche Quelle der Anregung und Förderung geworden, und für die Chemie ist es nicht ohne Bedeutung gewesen — eine ganze Reihe von Arbeiten haben sie gemeinschaftlich publicirt, die jeder allein nicht im Stande gewesen wäre, in dieser Weise auszuführen und zu vollenden. —
Die Bedeutung der vorhin genannten gemeinsamen Arbeit über das Bittermandelöl ist dahin zu definiren, daß darin zum ersten Mal ein sauerstoffhaltiges Radikal, das „Benzoyl“, angenommen war. Berzelius schätzte die Wichtigkeit dieser Erkenntniß so hoch, daß er in einem Briefe an L. diesem vorschlug, das neue Radikal Orthrin oder Proin (Morgendämmerung ὀρϑρος) zu nennen, weil er glaubte, den Anfang eines neuen Tages für die Chemie hereinbrechen zu sehen — und Berzelius war kein Enthusiast! Das Wort Radikal war von Lavoisier eingeführt — er verstand darunter die neben Sauerstoff in einer Säure vorhandenen Bestandtheile. Der Begriff des Radikals wurde später vielfach verändert, man hatte aber bis zu jener Arbeit von Liebig und Wöhler daran festgehalten, daß damit nur neben Sauerstoff vorkommende Bestandtheile einer Verbindung bezeichnet werden konnten, mit deren Natur man aber damals schon anfing sich eingehend zu beschäftigen, weil davon auch im Wesentlichen die Natur der aus dem Radikal entstehenden Verbindungen abhängen sollte. Indem nun L. und Wöhler den Begriff des Wortes durch die Einführung auch sauerstoffhaltiger Radikale nach der einen Seite hin zerstörten, suchten sie die Bedeutung desselben für das, was man die Constitution einer Verbindung nannte, mehr und mehr darzuthun. Sie zeigten, wie einfach und elegant alle die von ihnen gefundenen chemischen Zersetzungen erklärbar waren, wie sie den bei anorganischen Körpern beobachteten analog verliefen, wenn man, wie sie, das Radikal Benzoyl annahm und voraussetzte, daß dieses Radikal sich verhielte wie ein einfaches Element der anorganischen Chemie. Dadurch bildet diese Untersuchung, allerdings neben einigen anderen, die Grundlage der sogenannten Radikaltheorie, welche während vieler Jahre die organische Chemie beherrschte; sie trägt schon den Keim jenes Ausspruches Liebig's in sich, den er im J. 1840 an die Spitze seines Handbuches der organischen Chemie setzte: „Die organische Chemie ist die Chemie der zusammengesetzten Radikale“. Hier wurde ganz allgemein den zusammengesetzten Radikalen, d. h. gewissen aus verschiedenen Elementen bestehenden, meist nicht isolirten und daher rein hypothetischen Gruppen, dieselbe Rolle und Bedeutung für die organische Chemie zugeschrieben wie den Elementen in der Mineralchemie. Es galt von nun an für die Aufgabe jedes Chemikers, die Radikale der Körper, mit denen er sich beschäftigte, aufzufinden, d. h. aus dem Complex der Atome, welche das kleinste Theilchen des Körpers zusammensetzt, einige Atome als das Radikal bildend auszuscheiden; diese mußten dann bei allen Veränderungen, die der Körper durch chemische Zersetzung erlitt, unverändert bleiben, wie es z. B. das Benzoyl bei den verschiedensten Zersetzungen des Bittermandelöls wirklich zeigte. Das Benzoyl, das im Bittermandelöl an|Wasserstoff gebunden ist, verbindet sich mit Chlor, mit Cyan, mit Brom u. s. w., ohne sich selbst zu verändern.
Eine andere Arbeit Liebig's, von weittragendstem Erfolge für die Entwickelung der Chemie, ist die Ende der 30er Jahre erschienene Untersuchung über mehrbasische Säuren. Der erste Abschnitt derselben, der schon einen Theil der leitenden Ideen enthielt, ist mit Dumas, dem berühmten französischen Chemiker, gemeinschaftlich publicirt. Der zweite, ausführliche Theil ist von L. allein ausgeführt. Die Arbeit stützt sich einerseits auf einige zuerst von Humphry Davy, dann von Dulong vertretene Sätze über die Constitution der Säuren und Salze, die bis dahin kaum Beachtung und noch viel weniger Anerkennung gefunden hatten: andererseits auf eine sehr bedeutende Untersuchung des Engländers Graham über die Natur der Phosphorsäure. Der letztere hatte hier zuerst auf die äußerst wichtige, bis dahin ganz vernachlässigte Bedeutung des Wassers in den Säuren hingewiesen und gezeigt, daß die Phosphorsäure je nach der Menge Wasser, die sie enthält, verschiedene Eigenschaften besitzt und namentlich sehr verschiedenartige Salze erzeugt. L., der diesen Gegenstand weiter verfolgt und bei einer Reihe anderer Säuren ähnliche Verhältnisse findet, kommt zu dem Schluß, daß die kleinsten Mengen verschiedener Säuren, die man damals noch Atome, jetzt Moleküle nennt, nicht gleichwerthig (äquivalent) seien, sondern verschiedener Mengen einer Base zu ihrer Neutralisation bedürfen. Die Atome (um Liebig's Schreibweise beizubehalten) mancher Säuren bedürfen ein Atom Base, die Atome anderer Säuren zwei Atome Base, die Atome noch anderer Säuren drei Atome Base etc. So kommt L. auf den Begriff der Basicität der Säuren und theilt diese ein in einbasische, zweibasische, dreibasische etc., je nach der Anzahl Atome Base, die ein Atom Säure zur Neutralisation bedarf. Hier war also klar gezeigt worden, daß Atom und Aequivalent verschieden sein können, während man diese beiden Worte damals und noch längere Zeit hernach als Synonyma gebrauchte; jetzt dagegen bildet die Scheidung zwischen Aequivalent und Atom eine der Grundlagen unserer heutigen Ansichten, welche hiernach in der eben dargelegten Arbeit von L. zu finden ist. Auch nach anderer Richtung hin wirkte diese Arbeit fördernd; sie trug dazu bei, die alte dualistische Auffassungsweise namentlich der Entstehung der Salze zu verdrängen. Nach dieser sollten die Salze entstehen aus Base und Säure, die erste bildet den elektropositiven, die zweite den elektronegativen Bestandtheil. In jeder chemischen Verbindung suchte man in ganz analoger Weise zwei Bestandtheile anzunehmen, einen positiven und einen negativen. L. dagegen nimmt die alte Davy- und Dulong’sche Ansicht wieder auf, wonach die Säuren Wasserstoffverbinduugen sind, deren Wasserstoff durch Metalle vertretbar ist. Der Bestandtheil, der nach L. für die Säure nothwendig ist, ist der Wasserstoff, während nach Lavoisier der Sauerstoff das säuremachende Princip war. Auch hierin sind Liebig's Ideen, zwar erst nach hartnäckigen Kämpfen, doch endlich zum Siege gelangt.
Daß L. bei der außerordentlich großen Zahl seiner experimentellen Untersuchungen, selbst wenn sie wie die vorhin beschriebenen einen rein theoretischen Zweck verfolgten, eine große Zahl neuer Körper entdeckte, versteht sich von selbst und würde kaum der eingehenden Erwähnung werth sein, wenn nicht einige derselben später von eminent praktischer Bedeutung geworden wären. So ist L. unter Anderem der Entdecker des Chloroform und des Chloral, die er 1832 bei seiner Untersuchung über den Einfluß des Chlors auf den Alkohol fand. Obgleich er nicht die jetzt für richtig gehaltene Formel derselben, die wir Dumas verdanken, angab, beschrieb er auf das Genaueste die Methode ihrer Darstellung. Welche Wichtigkeit diese beiden Körper in der Medicin jetzt erlangt haben, ist allbekannt.|Dieselbe Reihe von Arbeiten führte L. zur Entdeckung des Aldehyds, welchen Döbereiner allerdings schon im unreinen Zustand unter Händen gehabt zu haben scheint. L. fand ihn bei der Oxydation des Alkohols, wodurch dieser Vorgang erst aufgeklärt wurde. Daraus entwickelte sich eine wesentlich verbesserte Methode zur Essigsäuredarstellung. Ferner führte die Entdeckung des Aldehyds zur Herstellung von Silberspiegeln, die allerdings heute nicht mehr mittelst Aldehyd gewonnen werden, aber doch in vielen Fällen die Quecksilberspiegel verdrängt haben. — All' diese praktischen Folgen jener Liebig’schen Entdeckung aber treten weit zurück hinter der theoretischen Bedeutung der Arbeit und es wäre geradezu thöricht, wollte man die Wichtigkeit des Aldehyds durch die Essigsäurefabrikation oder durch die Gewinnung von Silberspiegeln messen. Der Aldehyd ist der Repräsentant einer großen Klasse analoger Körper, die, nach ihm Aldehyde genannt, eine der wichtigsten Körperklassen der organischen Chemie bilden und durch die außerordentliche Mannigfaltigkeit ihrer Umsetzungen das größte Interesse verdienen.
Weiter sei hier die von L. und Wöhler gemeinschaftliche Arbeit über die Harnsäure (erschienen im J. 1838) erwähnt, die zur Entdeckung einer großen Zahl neuer Körper führte. Die Arbeit ist in Bezug auf die Sorgfalt und Präcision, mit der sie ausgeführt wurde, geradezu bewunderungswürdig. Sie darf als eine propädeutische Arbeit für die späteren physiologischen Arbeiten Liebig's betrachtet werden. Sie gibt zuerst Aufschluß über die Natur der Harnsäure und stellt namentlich die Beziehungen fest zwischen ihr und dem Harnstoffe. Wenn es ihnen auch nicht gelingt die Harnsäure künstlich darzustellen oder einen vollständigen Einblick in ihre Constitution zu geben, so war doch hier der erste glückliche Versuch gemacht, eine so complicirte Substanz wie die Harnsäure, über welche die Chemiker heute noch nicht zu voller Klarheit gelangt sind, einer eingehenden chemischen Untersuchung zu unterwerfen. Zwar ist das Resultat dieser Arbeit nicht eine sogenannte Entdeckung und läßt sich auch nicht in einfachen Worten für Laien zusammenfassen, doch soll hervorgehoben werden, daß die Art der Behandlung der ganzen Aufgabe als Vorbild für viele spätere ähnliche Untersuchungen gedient hat und insofern als bahnbrechend angesehen werden darf. Auch darin ist die Arbeit mustergültig, daß sie sich jeder Speculation über die Thatsachen hinaus enthält. Hatte doch L. kurz vorher an sich selbst erfahren, wie unheilbringend vorgefaßte Hypothesen sind und war ihm durch eine solche die Entdeckung des Broms entgangen. Er selbst erzählt diesen seinen Irrthum in launiger, charakteristischer Weise: „Es gibt kein größeres Mißgeschick für einen Chemiker, als wenn er sich von vorgefaßten Ideen nicht losreißen kann, wenn die Befangenheit des Geistes so weit geht, über jede von der Vorstellung abweichende Erscheinung sich eine Erklärung zu schaffen, eine Erklärung, die nicht dem Experimente entnommen ist. Am meisten findet sich dieses bei Personen, die keine Erfahrung in chemischen Untersuchungen besitzen. Fälle dieser Art kommen täglich vor. Wenn ich einem Anfänger in der Analyse ein Mineral gebe mit der Bemerkung, daß er Antimon, Blei und Kali darin zu suchen habe, so bin ich gewiß, daß er Antimon, Blei und Kali findet trotz der abweichendsten Reactionen, allein über jede Anomalie macht er sich eine Erklärung, mit der er zufrieden ist. Ich kenne einen Chemiker, welcher bei einem Aufenthalte in Kreuznach sich mit der Untersuchung der dortigen Salzmutterlauge abgab; er fand darin Jod, er beobachtete, daß die Jodstärke über Nacht feuergelb gefärbt wurde; die Erscheinung fiel ihm auf, er ließ sich eine große Quantität Mutterlauge kommen, sättigte sie mit Chlor und erhielt durch Destillation eine bedeutende Menge einer Flüssigkeit, welche die Stärke gelb färbte und die äußeren Eigenschaften von Chlorjod besaß, aber in vielen Reactionen mit dieser Verbindung nicht übereinstimmte, alle Abweichungen erklärte|er sich aber ganz befriedigend, er machte sich eine Theorie darüber. Einige Monate darauf erhielt er die schöne Arbeit des Herrn Balard, er war im Stande den nämlichen Tag eine Reihe von Versuchen über das Verhalten des Broms zu Eisen, Platin und Kohle bekannt zu machen; denn Balard's Brom stand in seinem Laboratorium als flüssiges Chlorjod signirt. Seit dieser Zeit macht er keine Theorien mehr, wenn sie durch unzweideutige Versuche nicht bewiesen und gestützt werden können; ich kann versichern, daß er dabei nicht schlecht gefahren ist.“ — Daß jener Chemiker L. selbst war, versteht sich; wie sehr er sich aber noch lange Zeit nachher darüber ärgerte, daß er sich diese Entdeckung hatte entgehen lassen, bezeugt sein bekannter scharfer Ausspruch: „Nicht Balard hat das Brom entdeckt, sondern das Brom hat Balard entdeckt!“
Jene Arbeit über die Harnsäure bildet den Uebergang zu einem neuen, epochemachenden Abschnitt in Liebig's wissenschaftlichem Leben. 15 Jahre lang hatte L. nun im Gießener Laboratorium als Lehrer und Leiter gewirkt, hatte seine eigenen Untersuchungen fast ausschließlich der allgemeinen Chemie und speciell der organischen Chemie zugewandt und auch die Arbeiten seiner zahlreichen Schüler nach dieser Richtung hin angeregt und geleitet. Nun verlor er aber mehr und mehr das Interesse für diese speciellen theoretischen Untersuchungen und sein reger, schöpferischer Geist wandte sich der Lösung allgemeiner praktischer Fragen zu; er beschäftigte sich jetzt mit der Anwendung seiner Wissenschaft auf Physiologie und Ackerbau. Er tritt gleich mit einem abgerundeten Werk, diesen Gegenstand betreffend auf: „Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie“ (erschienen im J. 1840). Dieses Werk erregte ein so ungeheures Aufsehen, daß es in 6 Jahren 6 Auflagen erlebte.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß auf dem Gebiete der physiologischen Chemie Liebig's größte That in der Erfassung und klaren Darlegung eines Gedankens besteht, der vor ihm kaum oder jedenfalls nur sehr ungenügend erkannt war. Gewöhnlich ist diese Idee als „der Kreislauf des Lebens“ bezeichnet worden und es handelt sich hier um jenen großartigen Vorgang der Natur, welcher Thier- und Pflanzenwelt mit einander verbindet, ihre Existenzen von einander abhängig macht. L. zeigt mit anderen Worten, daß Pflanzeneiweiß und Thiereiweiß dieselbe Zusammensetzung haben und daß die Pflanzen aus Kohlensäure, Wasser und Ammoniak im Stande sind die Stoffe zu bilden, welche den Thieren mittelbar oder unmittelbar zur Ernährung dienen. Diese verwandeln dann wiederum durch ihren Athmungs- und Verdauungsproceß jene complicirten, höher organisirten Materien in Kohlensäure, Wasser und Ammoniak zurück. Bei diesem Kreislauf erzeugen die Pflanzen aus einfachen Bausteinen zusammengesetzte Gebilde, welche durch das thierische Leben wieder in ihre Bestandtheile zurückgespalten werden. Die Erfassung dieses Gesetzes darf als eine der großartigsten naturwissenschaftlichen Ideen angesehen werden. Man machte bald nachher schon Anwendung von dem leitenden Gedanken Liebig's, indem man in kleine, mit Wasser gefüllte Kästen Pflanzen und Thiere hineinbrachte und sich selbst überließ — man schuf also kleine Aquarien, die man „Liebig's Welt im Glase“ nannte.
Wenn an jenem Grundgedanken auch seit der Zeit im Einzelnen viel gedeutet und Vieles hinzugekommen ist, was L. noch nicht ahnen konnte, wie namentlich die Folgerungen, welche das allgemeine Princip der Erhaltung der Kraft für diesen Fall verlangt, so bleibt doch die Wahrheit jenes Satzes durchaus bestehen, und L. gebührt das unauslöschliche Verdienst, ihn zuerst in seinen allgemeinen Zügen erkannt und ausgesprochen zu haben.
Dumas, der schon früher erwähnte Chemiker in Frankreich, hat etwas später ähnliche Ansichten veröffentlicht; und obgleich L., der in Prioritätsfragen nicht wenig empfindlich war, mit Dumas zwei Jahre vorher eine gemeinschaftliche Untersuchung publicirt hatte und dabei, wie er angab, alle bis dahin bekannten Versuche auf dem Gebiete der organischen Chemie mit ihm wiederholen wollte, um Richtiges vom Falschen zu scheiden, mit ihm also eine wissenschaftliche Verbindung für's Leben schließen wollte, hat er es doch nicht unterlassen, diesen selben Dumas jetzt öffentlich anzuklagen, er habe ihm seine Ideen gestohlen. Wenn die Untersuchungen Dumas' auch in vieler Beziehung mit denen von L. übereinstimmten, so war doch ein Punkt, in dem sie durchaus verschiedener Ansicht waren und welcher zu einer sehr berühmten wissenschaftlichen Polemik zwischen Beiden führte: dieser Punkt betraf die Fettbildung im Thierkörper.
Während Dumas behauptete, daß das Fett des Thieres einfach durch die Nahrung aufgenommen werde, nahm L. an, daß wenigstens ein Theil sich erst im Körper bilde, und zwar behauptete er, daß das Fett aus den stickstofffreien Nahrungsmitteln, speciell aus den Kohlenhydraten, gebildet werde, die danach auch Fettbildner genannt wurden. Spätere genaue Versuche von Dumas und Boussingault zeigten dann auch wirklich, daß das Fett der Nahrung nicht hinreiche, um den Fettansatz des Thieres zu erklären. Versuche bei Bienen, die nur mit Zucker ernährt wurden und doch Honig und Wachs erzeugten, schienen direct die Liebig’sche Ansicht zu bestätigen; nichtsdestoweniger haben neue Versuche von Voit es sehr wahrscheinlich gemacht, daß nur aus Eiweiß und ähnlichen stickstoffhaltigen Körpern Fett gebildet werde. — Auch die bekannte und heute noch vielfach gebrauchte Definition von L., wonach die Nahrungsstoffe in plastische und respiratorische eingetheilt werden, d. h. in solche, welche, wie die Eiweißkörper, zur Erzeugung von Muskeln etc. verwendet werden können, und in solche wie die Kohlenhydrate und Fette, welche, wie Liebig meinte, ausschließlich zur Athmung oder zur Unterhaltung der thierischen Wärme verwerthet werden, bedarf gewiß ebenfalls einiger Einschränkungen, doch auch hier war eine Anregung gegeben, die in jeder Beziehung fördernd auf die Wissenschaft wirkte. —
Im Verlauf dieser langjährigen wissenschaftlichen Arbeiten, besonders bei den in physiologischer Beziehung wichtigsten über das Fleisch und den genauen Untersuchungen seiner Bestandtheile, gelangte L. zu einer Entdeckung, die ihn zu einem der populärsten Männer seiner Zeit gemacht und durch die er der Wohlthäter von tausenden von Menschen geworden ist, zur Darstellung des Fleischextrakts. Nach und nach ist derselbe über die ganze Welt verbreitet und seine Bedeutung allseitig anerkannt worden, dennoch hat man viel über den Werth desselben als Nahrungsmittel gestritten. Die Behauptung, daß L. gesagt habe, sein Fleischextrakt könne das Fleisch ersetzen, erscheint sehr unwahrscheinlich und ist jedenfalls nur in der leidenschaftlichen Erregung des Augenblickes denkbar; denn L. hat selbst bei seiner Anweisung zur Herstellung des Extrakts angegeben, daß darin, damit er haltbar sei, weder Eiweißkörper noch Fett sich finden dürfen. — Welchen Werth für die Ernährung die Extraktivstoffe, namentlich das Kreatin etc. haben, ist immer noch nicht vollständig festgestellt: man hat sich einstweilen damit beruhigt, daß man den Fleischextrakt zu den Genußmitteln zählt und ihm eine ähnliche Wirkung wie dem Kaffee zuschreibt. — Nicht minder originell wie die Entdeckung selber war nun auch die praktische Ausführung derselben. Wol empfand L., daß die Einführung seines Extrakts sich nur dann bewähren könne, wenn es gelänge, denselben aus sonst ungebraucht verloren gehendem Fleische herzustellen; es war daher Liebig's Lieblingsidee, ihn in Gegenden bereitet zu sehen, wo Vieh und Fleisch bis dahin fast werthlos gewesen, wie in Südamerika, dessen riesige Viehheerden nur zum Zweck der Häute gehütet und geschlachtet wurden. In großartigster Weise ist dieser sein Wunsch in Erfüllung gegangen.|Zuerst und gleich in ausgedehntem Maßstabe entstand in Fray-Bentos in Südamerika eine Fleischextraktfabrik, die noch heute die beste und verbreitetste Marke führt. Tausende von Rindern werden jetzt täglich dort geschlachtet und der daraus bereitete Extrakt nach Europa gesandt. L. erzählt, von all' den vielen freudenreichen Stunden seines Lebens sei selten eine reiner und größer von ihm empfunden worden als die, in der er die erste Büchse von Fleischextrakt aus Fray-Bentos erhalten!
Noch ein anderes gemeinnütziges und viel verbreitetes Erzeugniß, das Kindermehl, als Ersatzmittel für Milch, hängt mit diesen Arbeiten zusammen und sichert L. die Dankbarkeit vieler Mütter, denen die Erreichung guter Kindermilch aus irgend einem Grunde schwer oder unmöglich ist.
Das Aufsehen, welches jenes oben citirte Werk Liebig's „Die Anwendung der Chemie auf Agricultur und Physiologie“ so allgemein hervorgerufen, beruht nun aber nicht nur auf jenem, doch meist rein wissenschaftlichen, physiologischen Theil, sondern auf den darin zum ersten Mal ausgesprochenen überraschenden Lehren für Ackerbau und rationelle Landwirtschaft. Die Landwirthschaft lag damals noch in einem rein empirischen Zustand. Man wußte, daß man dieselbe Pflanze nicht continuirlich auf demselben Boden ernten könne; man wußte, daß das Erträgniß des Landes durch Düngung erhöht werde und man hatte sogar neben der Stalldüngung, die bekanntlich uralt ist, auch die Mineraldüngung, d. h. aufgeschlossenes Knochenmehl in England benutzt, während berühmte Landwirthe, wie Thaer und Sprengel, diese für Deutschland nutzlos erklärten. Man kannte die Brache und die Wechselwirthschaft, man hatte aber keine klare Vorstellung von dem Grund ihrer Nützlichkeit. Saussure und andere bedeutende Forscher hatten auch schon die Aschen oder anorganischen Bestandtheile einiger Pflanzen untersucht und auf deren Wichtigkeit hingewiesen, allein der einfache Zusammenhang zwischen Pflanzenernährung, Düngung, Bodenbestandtheilen etc. war nur von den Wenigsten geahnt, allgemein aber unbekannt. — Daher die allgemeine Aufregung, welche jenes Werk hervorrief. Liebig's Gedankengang darin war folgender: Wie das Thier verkümmert oder zu Grunde geht, wenn man ihm nach und nach die nöthige Nahrung entzieht, oder dieselbe seiner Constitution nicht entspricht, so auch die Pflanze. Sie bedarf zu ihrem Wachsthum und zu ihrer Ernährung zunächst gewisser Bestandtheile der Atmosphäre, Kohlensäure, Wasser und Ammoniak, die sie durch ihre Blätter aufnimmt, dann aber auch gewisser anorganischer Salze, die sie durch die Wurzel dem Boden entnehmen muß, namentlich Kalium, resp. Natrium- und Kalkverbindungen und andererseits Phosphorsäure-, Schwefelsäure- und Salzsäure-Verbindungen. Der Landwirth, welcher Jahr aus, Jahr ein durch Bepflanzung und Ernte dem Boden nach und nach diese Bestandtheile entzieht, bewirthschaftet seinen Grund und Boden schlecht, läßt ihn verarmen, er betreibt, wie L. sagt, Raubbau. Der Boden wird untauglich zu weiterer Bepflanzung, wenn ihm diese Bestandtheile nicht wieder ersetzt werden. Durch solchen jahrhundertelangen irrationellen Ackerbau sind die im Alterthum fruchtbarsten Länder, sind Griechenland, Italien und Sicilien, einst die Kornkammer Roms, unfruchtbar geworden. In dieser Verarmung des Ackers, in seinem Bedürfniß nach Ersatz für die durch die Aschenbestandtheile der Ernte dem Boden entführten Stoffe, beruhe also die Bedeutung der Düngung. — Diese für die Landwirthschaft so wichtige Thatsache, das eigentliche Fundament derselben zu Tage gefördert und davon für den rationellen Ackerbau die segensreichste Nutzanwendung gemacht zu haben, ist vielleicht Liebig's größte Leistung. Er ist als erster wirklicher Agriculturchemiker, der Reformator des Feldbaues geworden. — Es gehört, so schließt L. weiter, zu einer rationellen Landwirthschaft Kenntniß der Zusammensetzung der betreffenden Ackererde, und die Analyse|der Aschenbestandtheile der zu cultivirenden Pflanze. Aus diesen beiden Factoren ergebe sich die Zusammensetzung des zweckmäßigsten Düngmittels. Nach beiden Richtungen hin griff L. zu und zwar machte er nicht nur selbst derartige Analysen und ließ solche durch seine Schüler ausführen, sondern er veranlaßte ähnliche Arbeiten, wo er nur irgend konnte, so daß nach wenigen Jahren ihm wirklich ein außerordentlich umfangreiches Material in dieser Beziehung zu Gebote stand. Aber damit begnügte er sich nicht. Er griff die Sache auch praktisch an. Einen seiner Schüler, Herrn Muspratt, einen der größten Sodafabrikanten Englands, veranlaßte er, einen künstlichen Dünger nach seiner Vorschrift zu bereiten. Dieser Dünger sollte namentlich die Alkalisalze und die Phosphorsäure dem Boden zuführen. Da nun aber phosphorsaure Alkalien in Wasser leicht löslich sind und L. fürchtete, daß der Regen alsdann die künstlich dem Boden zugeführten Stoffe wieder entführen würde, so suchte er die als nothwendig erkannten Zusätze in eine wenig lösliche Form zu bringen und erreichte dies nach vielen vergeblichen Versuchen durch Zusammenschmelzen des eigentlichen Düngemittels mit kohlensaurem Kalk. Dieser künstliche Dünger wurde fabricirt, er wurde auch Anfangs verkauft und benutzt, aber ohne jeden Erfolg, so daß die Fabrikation sehr bald wieder eingestellt wurde. Gleichzeitig entspann sich eine sehr lebhafte Discussion zwischen ihm und den Gegnern seiner Lehre, unter denen hauptsächlich Lawes und Gilbert zu nennen sind, welche in England mit löslichem Dünger aus Ammoniaksalzen und aufgeschlossener Knochenasche, sogenanntem Superphosphat, ausgezeichnete Erfolge erzielten. Kein Wunder, daß alle praktischen Landwirthe sich als Gegner Liebig's erklärten und daß auch dieser augenblickliche Mißerfolg wieder als Beispiel benutzt wurde, zu zeigen, „wie grau jede Theorie sei“.
L. war von der Erfolglosigkeit seiner Bemühungen tief aufgeregt und unglücklich, jahrelang suchte er vergeblich die Fehler seiner Schlußfolgerungen aufzufinden, wobei er stets von der Richtigkeit seiner Grundsätze überzeugt blieb. Endlich offenbarte sich ihm das Räthsel: er hatte eine Eigenschaft der Ackerkrume, die schon seit längerer Zeit bekannt war, vernachlässigt. Man wußte schon durch Bronner, Thompson und Way, daß der Ackerboden gewisse Stoffe zurückzuhalten vermag, die ihm kein Wasser mehr entziehen kann. Man hatte aber dieser Eigenschaft bisher nicht die gehörige Beachtung geschenkt. Erst im J. 1860 hat L. erkannt, daß hier das punctum saliens liegt; diese Eigenschaft der Ackerkrume macht es überflüssig, den Dünger in eine unlösliche Form zu bringen: der Regen kann die löslichen Bestandtheile dem Boden nicht wieder entziehen, wol aber die Pflanzenwurzel. So stand denn jetzt Erfahrung und Theorie in Uebereinstimmung: der sofortige Erfolg der löslichen Düngstoffe war erklärt und ebenso der Nichterfolg oder wenigstens die außerordentlich langsame Wirkung des Liebig’schen Düngers; denn eine solche hatte sich bei den Liebig’schen Versuchen schließlich herausgestellt, und dieses stand im Einklang mit der schwierigeren Aufnahme unlöslicher Stoffe durch die Pflanzenwurzel.
Diese weitgreifenden, allgemeinen Arbeiten und Forschungen mußten selbst einen so genialen Geist wie L. vollkommen in Anspruch nehmen und verlangten die Hingabe des ganzen ungetheilten Denk- und Arbeitsvermögens. L. empfand dies sehr bald und versuchte seine Wirksamkeit als Leiter des nach und nach so großartig herangewachsenen Laboratoriums, dem er fast 30 Jahre seiner besten Arbeitskraft gewidmet, einzuschränken. Dazu bot sich ihm Gelegenheit, als König Max von Baiern im J. 1851 L. durch Professor Pettenkofer auffordern ließ, in München eine chemische Professur zu übernehmen. In Gießen versuchte man nicht einmal ihn zu halten, so wenig Verständniß zeigten die maßgebenden Kreise|immer noch für den Mann, der der kleinen Universität Weltruf verschaffte und mit dessen Fortgang dieselbe wieder in ihre frühere Bedeutungslosigkeit zurückfiel.
Im Herbst 1852 siedelte L. nach München über. Er hatte es übernommen Vorlesungen über seine Wissenschaft zu halten, aber keinem Unterrichtslaboratorium vorzustehen. Dadurch schuf er sich jene Muße, deren Folgen die umfangreichen Forschungen auf physiologischem und agriculturchemischem Gebiete geworden sind. Was Anfangs sein Wunsch war, blieb nun bis an seines Lebens Ende ein gewisser Zwang: er hatte keine Gelegenheit mehr zu rein chemischen Untersuchungen zurückzukehren. — Dagegen setzte er hier die Herausgabe verschiedener großer Werke fort, die er schon in Gießen begonnen hatte. Um seine und seiner Schüler Arbeiten, sowie seine vielen, umfangreichen polemischen Schriften veröffentlichen zu können, schuf er sich ein Journal: die „Annalen der Chemie“. Dasselbe war eine Fortsetzung des von Hänle gegründeten und von diesem mit Geiger längere Zeit redigirten Magazins der Pharmacie, in dessen Redaction auch L. 1831 eingetreten war. Vom J. 1836 erschien es in seiner jetzt noch bestehenden Form und wurde von L. und Wöhler und später hauptsächlich durch Hermann Kopp geleitet. Heute weist dieses Journal über 200 Bände auf und bildet einen der gelesensten und werthvollsten Theil der Quellenlitteratur. Das „Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie“, welches L. in Gemeinschaft mit Poggendorff und Wöhler 1837 gegründet, wurde erst 1864 beendet. Die ersten beiden Bände enthalten hervorragende Aufsätze aus Liebig's Feder, später hat er selbst nicht mehr daran gearbeitet, sondern das Werk von Freunden und Schülern fertig schreiben lassen. Dadurch und durch das sehr langsame Erscheinen hat es etwas von der Bedeutung verloren, die es Anfangs gehabt; immerhin hat sich die Form, die Wissenschaft encyklopädisch zusammenzufassen, so bewährt, daß England und Frankreich das Handwörterbuch nachgeahmt haben und in Deutschland jetzt eine zweite Auflage davon erscheint, die allerdings ebenso langsam fortschreitet. Liebig's drittes großes Unternehmen, der „Jahresbericht der Chemie“, den er von 1847 an auch in Gemeinschaft mit Hermann Kopp bearbeitete, ist für unsere Wissenschaft von hervorragender Bedeutung gewesen und geblieben, obgleich L. nur etwa 10 Jahre an der Herausgabe theil genommen hat. Er wird noch jetzt jährlich veröffentlicht und ist uns ein täglich benutztes, unentbehrliches litterarisches Hilfsmittel geworden. —
So hat durch diese vielseitigen literarischen Schriften L. einen Beweis seiner schöpferischen Thätigkeit und unverwüstlichen Arbeitskraft gegeben. Will man aber Liebig's Gesammtleistungen als Naturforscher übersehen, so muß man seine Verdienste in Bezug auf die Culturentwickelung des Volkes ins Auge fassen, denn nicht darf es bezweifelt werden, daß wir L. wirklich einen großen Einfluß auf dieselbe zu verdanken haben. Er hat diesen namentlich dadurch erlangt, daß er mit Eifer, ja man könnte fast sagen mit Leidenschaft, die Grundsätze und die Gesetze der Wissenschaft überall zur Geltung zu bringen suchte, und daß er namentlich sein ganzes Leben hindurch bemüht war, wissenschaftlichen Principien auch im täglichen Leben Anerkennung und Geltung zu verschaffen. Sein allgemein wissenschaftlicher Standpunkt war zwar weit entfernt davon der des Materialisten zu sein, ja er huldigte sogar, wie seine Vorgänger in der Physiologie, noch der Lebenskraft und er war ein eifriger Deist und ein vollkommen gläubiger Mensch. Sehr charakteristisch für diese seine Naturauffassung ist ein Passus seiner Schriften, worin er die endliche Erkenntniß seines Fehlers bei der Einführung des unlöslichen Düngers schildert und der hier eine Stelle finden möge — die Frage selbst ist schon an anderer Stelle erörtert; L. sagt: „Endlich nachdem ich alle Thatsachen einer neuen und aufmerksamen Prüfung Schritt vor Schritt unterworfen hatte, entdeckte ich den Grund. Ich hatte mich an der Weisheit|des Schöpfers versündigt und dafür meine gerechte Strafe empfangen; ich wollte sein Werk verbessern und in meiner Blindheit glaubte ich, daß in der wundervollen Kette von Gesetzen, welche das Leben an der Oberfläche der Erde fesseln und immer frisch erhalten, ein Glied vergessen sei, was ich, der schwache, ohnmächtige Wurm, ersetzen müsse. Das Gesetz, zu welchem mich meine Untersuchungen über die Ackerkrume führten, heißt: an der äußersten Kruste der Erde soll sich unter dem Einfluß der Sonne das organische Leben entwickeln — und so verlieh denn der große Baumeister den Trümmern dieser Kruste das Vermögen, alle diejenigen Elemente, welche zur Ernährung der Pflanze und damit auch der Thiere dienen, anzuziehen und festzuhalten, wie der Magnet Eisenfeile anzieht und festhält, so daß kein Theilchen davon verloren geht .....“ Wir haben hier das seltene Beispiel eines freien, klaren Forschergeistes, der seinen festen Gottesglauben in Einklang zu bringen vermochte mit großen, allgemein gültigen Naturgesetzen, die zu erkennen und zu erforschen die Aufgabe seines Lebens gewesen ist. Er war sich dabei ganz klar, daß die Gesetze der Chemie und Physik auch im thierischen Leben zur Anwendung kommen müssen, und gerade die volle Ueberzeugung von der Richtigkeit dieser Grundsätze hat es ihm auf dem Gebiete der Physiologie, auf dem er doch reiner Autodidakt und immerhin Dilettant gewesen und geblieben ist, möglich gemacht, so große Erfolge zu erringen. Seine 22jährigen Forschungen in dieser Richtung erhielten einen Abschluß in einem 1862 veröffentlichten Werke: „Der chemische Proceß der Ernährung der Vegetabilien und die Naturgesetze des Feldbaues“. —
Ganz bezeichnend für Liebig's Art der Schlußfolgerungen und der Anwendung der einmal für richtig erkannten Gesetze ist ein Beispiel, das hier noch angeführt zu werden verdient: Bekanntlich hat Lavoisier schon die thierische Wärme durch die Verbindung der Nahrungsmittel mit Sauerstoff zu erklären gesucht; Versuche, die etwas später von Dulong und Despretz angestellt wurden, ergaben, daß wirklich 90% der thierischen Wärme in dieser Weise entstünden; über die fehlenden 10% waren alle möglichen Hypothesen im Umlauf. Hauptsächlich glaubte man, daß durch die Nerventhätigkeit das letzte Zehntel erklärt werden könne. L., ohne einen Versuch zu machen, erklärte die Dulong’schen Untersuchungen für ungenau und behauptete mit großer Bestimmtheit, daß alle Wärme durch den chemischen Proceß der Verdauung und Athmung entstehen müsse, was spätere genaue Versuche auch bestätigt haben. — Dieses Durchdrungensein von der allgemeinen Anwendbarkeit wissenschaftlicher Grundsätze machten ihn auch zu einem gefürchteten Gegner jedes Aberglaubens und jedes Mysticismus. Wer kennt nicht seine Angriffe gegen die Möglichkeit der Selbstverbrennung, wer hätte so schnell wie er diesen für eine unbedingt erwiesene Thatsache geltenden Schwindel aus der Welt schaffen können. Nimmt man hinzu die von Leidenschaft durchglühte Ueberzeugung, mit der L. für seine Ansicht stritt, so hat man die Erklärung für die Aufregung und die allgemeine Anregung, welche Liebig's „Chemische Briefe“, zuerst in der Augsburger Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, hervorriefen. Es war ja nicht das erste Mal, daß ein großer Forscher für das gesammte gebildete Publikum schrieb; Humboldt's Kosmos hatte schon viele Gemüther der Wissenschaft gewonnen; nicht geringer ist aber wol der Einfluß der chemischen Briefe zu schätzen. An Form und Inhalt gleich gediegen bringen sie, jedem verständlich, ein populäres Bild der ernstesten, wissenschaftlichen Ergebnisse. Sie fesseln den Laien durch ihre anmuthige, leicht faßbare Schreibweise, den Landwirth durch die vielen darin enthaltenen praktischen Winke, die er benutzen kann, den Gelehrten durch die exacte, naturwissenschaftliche Darstellung. Die Chemiker müssen noch ganz im Besonderen L. dafür dankbar sein, denn er vor Allem ist es gewesen, der verstanden hat der Welt klar zu machen, daß die Chemie eine Wissenschaft sei und der es vermochte, dem Publikum Achtung vor ihren Errungenschaften einzuflößen.
Liebig's Lebenslauf neigt sich seinem Ende zu. Die letzten Jahre seines Lebens wurden ihm durch ein nervöses Leiden getrübt, das ihn am anhaltenden Arbeiten hinderte. Doch blieb er rüstig und geistig frisch bis zuletzt und die Nachricht seines Todes kam unerwartet und tief erschütternd. Er starb noch nicht ganz 70 Jahre alt nach kurzer Krankheit am 18. April 1873 in München, wo er die letzten 25 Jahre ununterbrochen gelebt hatte.
Der wissenschaftlichen Früchte seines Münchener Aufenthalts ist soeben gedacht worden. Daß er dort nach kurzer Zeit den Mittelpunkt des gesammten wissenschaftlichen Lebens bildete, ist bekannt. Auch an äußeren Zeichen der höchsten Anerkennung fehlte es ihm nicht. Die Wahl zum Präsidenten der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, eine Würde, die er lange Jahre bekleidete, zeigt, wie sehr ihn seine Collegen zu schätzen wußten; durch die Erhebung in den erblichen Freiherrnstand bewies ihm sein König, welchen Werth er darauf legte, einen solchen Mann an seine Hochschule zu fesseln. Die wissenschaftlichen Gesellschaften und alle Akademieen des In- und Auslandes rechneten es sich zur Ehre an, ihn zu ihrem Mitgliede ernennen zu dürfen, während fast alle Fürsten ihm durch die Verleihung hoher Orden ihre Anerkennung auszudrücken versuchten. So erreichte L. schon bei Lebzeiten unsterblichen Ruhm und erntete die Früchte seines arbeitsamen Lebens.
Als sich die Trauerkunde von Liebig's Tode verbreitete, empfand die ganze wissenschaftliche Welt, daß ihr der Führer, der Meister gestorben, und allseitig wurde der Wunsch laut, ihm, dem größten Naturforscher seiner Zeit, ein würdiges Denkmal zu setzen. Die Absicht ist zur That herangereift, und so hinterlassen wir der Nachwelt auch ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und Verehrung, die die Mitwelt ihrem Geistesheroen gezollt.
-
Literatur
Carrière, Liebig und Platen (Allgemeine Zeitung 1873, S. 2637). Kolbe, Liebig, der Lehrer, Gelehrte und Reformator (Unsere Zeit 1874, Bd. X, 1. Thl., S. 721). A. W. Hofmann, The Life-Work of Liebig. Faraday-lecture. London 1876. Bischoff, Erlenmeyer, v. Pettenkofer, Reden, gehalten in der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, nach Liebig's Tode.
-
Autor/in
Ladenburg. -
Zitierweise
Ladenburg, Albert, "Liebig, Justus von" in: Allgemeine Deutsche Biographie 18 (1883), S. 589-605 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118572741.html#adbcontent