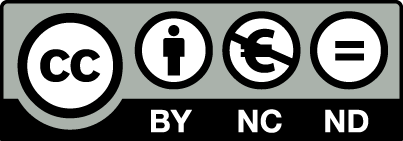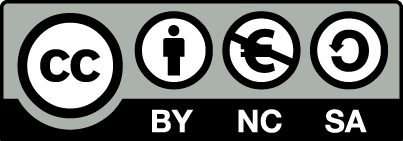Keller, Gottfried
- Lebensdaten
- 1819 – 1890
- Geburtsort
- Zürich
- Sterbeort
- Zürich
- Beruf/Funktion
- Dichter ; Regierungssekretär ; Schriftsteller ; Librettist ; Maler ; Lyriker
- Konfession
- reformiert
- Normdaten
- GND: 11856109X | OGND | VIAF: 102319551
- Namensvarianten
-
- Keller, Gottfried
- Kerā
- keraz
- Cerā
- Kai le
- Cai le
- Kaile
- Caile
- Keler, Gotfrid
- Celer, Gotfrid
- Keleri, Gotpʹrid
- Celeri, Gotpʹrid
- Kīllir, Ǧūtfrīd
- kizllir, ǧuztfrizd
- Cīllir, Ǧūtfrīd
- Keller, Gotfryd
- Celler, Gotfryd
- Keller, Gotfrid
- Celler, Gotfrid
- Keller, Goffredo
- Celler, Goffredo
- Kaile, Gaotefeilite
- Caile, Gaotefeilite
- Keller, Gkoto̲fri̲nt
- Celler, Gkoto̲fri̲nt
- 高·凯勒
- ケラー, ゴットフリート
- 凯勒, 高
- ケラー・ゴットフリート
- קלר, גוטפריד
- 凱勒
- Celler, Gottfried
Vernetzte Angebote
- SIKART - Lexikon zur Kunst in der Schweiz [2006-]
- * Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) [2001-2014] Autor/in: Ursula Amrein (2012)
- * Filmportal [2010-]
- Theaterlexikon der Schweiz online [2005]
- Personen im Wien Geschichte Wiki [2012-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1977] Autor/in: Rothenberg, Jürgen (1977)
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Geßler, Albert (1906)
- Blue Mountain. Historic Avant-Garde Periodicals for Digital Research [2017-]
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Edition der Tagebücher Erich Mühsam's
- Alfred Escher-Briefedition (via metagrid.ch)
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte)
- Diplomatische Dokumente der Schweiz 1848-1975 (via metagrid.ch) [2019]
- * Nachlass Sommerfeld beim Deutschen Museum
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Archivportal - D
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Personen im Wien Geschichte Wiki [2012-]
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
Personen im NDB Artikel
Personen in der GND - familiäre Beziehungen
Personen in der GND - Bekannte und Freunde
- ADB 42 (1897), S. 403 (Wieland, Christoph Martin)
- ADB 42 (1897), S. 407 (Wieland, Christoph Martin)
- ADB 55 (1910), S. 895 Korrektur
- NDB 1 (1953), S. 419 (Assing, verehelichte Grimelli, Rosa Ludmilla)
- NDB 1 (1953), S. 667 (Baumgartner, Wilhelm Franz Joseph)
- NDB 2 (1955), S. 373 (Böcklin, Arnold)
- NDB 2 (1955), S. 485 (Bosshart, Jakob)
- NDB 5 (1961), S. 414 (Frey, Gustav Adolf)
- NDB 6 (1964), S. 177 (Gelzer, Johann Heinrich)
- NDB 7 (1966), S. 417 (Hadlaub, Johannes)
- NDB 8 (1969), S. 519 (Henckell, Karl Friedrich)
- NDB 8 (1969), S. 591* (Herbst, Hans)
- NDB 9 (1972), S. 17 (Hesse, Hermann)
- NDB 9 (1972), S. 705 (Huch, Ricarda, geborene Huch)
- NDB 11 (1977), S. 47* (Kalbeck, Max)
- NDB 11 (1977), S. 137 (Kapp, Gottfried)
- NDB 11 (1977), S. 525 (Kerner, Justinus)
- NDB 11 (1977), S. 703 (Klaiber, Theodor)
- NDB 12 (1980), S. (Köster, Albert)
- NDB 13 (1982), S. 61 (Kröner, Adolf von)
- NDB 13 (1982), S. 250 (Kuh, Emil)
- NDB 14 (1985), S. (Leuthold, Heinrich)
- NDB 14 (1985), S. 386* (Leuthold, Heinrich)
- NDB 14 (1985), S. 578 (Linde, Carl Ritter von)
- NDB 15 (1987), S. 434 (Ludwig, Otto)
- NDB 16 (1990), S. 558* (Maync, Harry)
- NDB 17 (1994), S. 314 (Meyer, Victor)
- NDB 18 (1997), S. 289 (Mühlestein, Hans)
- NDB 21 (2003), S. 225* (Rebhuhn, Werner)
- NDB 21 (2003), S. 365* (Reinhart, Oskar)
- NDB 21 (2003), S. 694 (Rodenberg, Julius)
- NDB 22 (2005), S. 310* (Rychner, Max)
- NDB 22 (2005), S. 709 (Scheu, Heinrich)
- NDB 23 (2007), S. 718 in Artikel Schulz (Schulz, Wilhelm Friedrich)
- NDB 23 (2007), S. 284 (Schneider, Albert)
- NDB 25 (2013), S. 446 in Artikel Storm
- NDB 26 (2016), S. 717 in Artikel Varnhagen von Ense ( Varnhagen von Ense Karl August Ludwig Philipp (bis 1811 Varnhagen) (Pseudonym August Becker))
- NDB 28 (2024), S. 182 in Artikel Wille (Wille, Conrad Ulrich Sigmund)
- NDB 28 (2024), S. 412 in Artikel Wolf (Wolf, Hugo Philipp Jakob)
- NDB 28 (2024), S. 245 (Winkler, Hildegard)
- NDB 28 (2024), S. 343 (Wittgenstein, Ludwig Josef Johann)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Keller, Gottfried
Dichter, * 19.7.1819 Zürich, † 15.7.1890 Zürich. (reformiert)
-
Genealogie
V →Joh. Rudolf (1791–1824), Drechslermeister in Z. (s. L), S d. Küfermeisters Rudolf in Glattfelden (Wirts - S) u. d. Elisabeth Amberg (aus Müllerfam.);
M Elisabeth (1787–1864), T d. Joh. Heinrich Scheuchzer (1751–1817), Chirurg in Z., u. d. Elisabeth Margarethe Rägis aus Erlach;
Schw Regula (1822–88); - ledig; Verlobte (1866) Luise Scheidegger († 13.7.1866). -
Biographie
Kindheit und Jugend (1819–40)
Auf den ersten Blick scheint alles auf eine harmonisch verlaufende Kindheit und Jugend K.s hinzudeuten. Wenn es in dieser frühen Lebensphase dennoch und eigentlich wider Erwarten ernsthafte Konflikte gibt zwischen Mensch und Welt, müssen die Ursachen statt im geistig-sozialen Klima in privat-biographischem Umkreis zu suchen sein. Entscheidend für die Prägung des K.schen Weltverhältnisses wird der frühe Tod des Vaters – nach allem, was wir wissen, ein vielgereister, geistig beweglicher Mann mit (freilich erst vage) erkennbar politischem Profil, diversen literarisch-ästhetischen Interessen bei nachhaltig sozialem Engagement –, bedeutet er doch über den Wegfall (unverzichtbar) erzieherischer Autorität hinaus das Ende einer behüteten Kindheit, die Konfrontation mit materieller Not – trotz aller haushälterischen Tüchtigkeit erst der Mutter, später der Schwester Regula – wie die Erfahrung der Schutzlosigkeit der Familie überhaupt: Einer Geringfügigkeit wegen und zu Unrecht von der eben erst eröffneten Industrie-Schule relegiert (9.7.1834), überkommt den solcherart geistig ‚Enthaupteten' das Gefühl lebendigen Begrabenseins, das heißt hier sozialer Desintegration wie intellektueller Isolation. Womit aus (atypischen) widrigen äußern Umständen im Verein mit individuell erhöhter Sensibilität sowie einem ausgeprägten Hang zu Selbstbemitleidung und Märtyrertum neuerlich ein Klima entstehen konnte, das nicht sehr verschieden war von den Voraussetzungen für empfindsame Konfliktfälle und tatsächlich noch einmal die nämlichen Folgen zeitigte: Abkapselung gegenüber der Außenwelt, Rückzug auf die Position reiner Innerlichkeit, ein Mißverhältnis, das sich zunächst bemerkbar macht in dem mehr psychologischem Bedürfnis als unabweislichem Produktionsdrang entspringenden Wunsch, Maler zu werden.
Malerei als Scheinlösung (München 1840–42)
Gegen den Willen und das instinktiv bessere Wissen der Mutter schrittweise durchgesetzt, findet K. Unterkommen zunächst bei handwerklich schlechten (Peter Steiger) oder menschlich zweifelhaften (Rudolf Meyer) Lehrern, ehe er sich in ‚Alles-oder-Nichts'-Manier auf das Abenteuer der Kunstreise nach München kapriziert. Ohne Empfehlungen kommt es auch dort zu keiner geregelten Ausbildung; K. war nie eingeschriebener Schüler der Akademie. Aber selbst wenn er ernsthafte Studien hätte betreiben wollen, wäre er in der ‚Münchner Szene' von 1840 – beherrscht von der Historienmalerei der Cornelius und Kaulbach – als Landschafter fehl am Platze gewesen. So des Lernzwangs (glücklich?) enthoben, bleibt ihm immerhin die Erfüllung jenes andern Wunschtraums vom Leben als Bohemien, und als ‚lustiges Kellerchen' – der Übername „Strabo“ nebst Bierfaß als Wappen sprechen für sich – verschafft er sich innerhalb der kleinen Schweizer Kolonie alsbald einen ‚unverwechselbaren' Ruf. Dies freilich nur so lange, wie das Geld reichen will und die Gesundheit mitspielt. Von einer Typhusepidemie ergriffen, kommt er physisch wie materiell – Briefe an den Malfreund Salomon Hegi verraten von seiner damaligen Verfassung mehr als die meist schonend gehaltenen Nachrichten an die Mutter – rasch ‚auf den Hund'. Die schließliche Rückkunft, schon im „Grünen Heinrich“ kümmerlich genug, gestaltet sich in Wahrheit zu einer makabren Burleske: Erst verkohlt ein Bild bei dem Versuch, es für die speziellen Bedürfnisse einer Verlosung herzurichten. Ein anderes Objekt, nach Zürich verschickt, trifft dort verspätet und, da unzureichend verpackt, überdies verschmutzt ein. Im Katalog verzeichnet, erweist es sich anfangs als unauffindbar; aus dem Keller geholt und (doch noch) ausgestellt, bleibt es dank fehlender (das heißt von neidischer Kollegenhand unterschlagener) Auszeichnung unverkäuflich. Seiner Schulden wegen inzwischen steckbrieflich gesucht, findet K. sich bei aufgekündigtem Logis zuletzt in buchstäblichem Sinne auf den Straßen Münchens sitzend wieder. Als ‚verkrachte Existenz' kehrt er Ende 1842 in die Heimat zurück.
Es ist dies die erste große Krise seines Lebens, in den älteren Biographien zumeist heruntergespielt und überdeckt mit Hilfe der ebenso unzutreffenden wie stereotypen Formel vom künftigen ‚Maler'-Dichter, wobei die Behauptung in der Fremde erlernter „Schaufreude“ allerdings gestattet, die Münchner Jahre als unverloren anzusehen, wie sie geeignet ist, (Vor-) Urteile bezüglich des nachmaligen ‚Realisten' bestärken zu helfen. Darüber hinaus haben die Begleitumstände der Heimkehr, gleichgültig, ob man sie nun als künstlerisches Scheitern in Rechnung zu stellen bereit ist oder nicht, naturgemäß immer wieder die Frage aufkommen lassen, was aus dem Maleleven geworden wäre, wenn er materiell günstigere Bedingungen als Voraussetzung für „Fröhlichkeit und sorglosen Sinn“, dazu geeignete Lehrer vorgefunden und bei ihnen „die strenge und berufsmäßige Bildung erhalten hätte, welche die bildende Kunst verlangt.“ Wäre er etwa im Paris der Delacroix, Daumier, Millet … der Maler geworden, der er hatte werden wollen? Fragen, denen – manchen Expertisen zum Trotz, die ihm Talent und mehr bescheinigen – allemal etwas Akademisches anhaftet angesichts der Tatsache, daß K. zumindest, ‚professionell' nach 1842 nicht mehr vor der Staffelei gestanden hat. Und selbst wenn die Anekdote von der leeren, schwarzgerahmten Leinwand im Schlafzimmer ins Reich der Fabel gehören sollte, so erscheint sie doch innerlich stimmig in bezug auf jemanden, dem dies Metier eine Zeitlang eher Refugium bedeutet haben|mochte vor den Anforderungen des Lebens denn künstlerische Selbstverwirklichung. Hält man die Prämisse vom empfindsamen Ausgangspunkt (mitsamt der gerade für sie typischen Verwechslung von ästhetischer Sensibilität und handwerklichem Können) mit einer weitern von K. stammenden Einlassung zusammen, wonach der Mensch dasjenige, was ihm „zukommt, … bis zu einem gewissen Grade schon im Anfang [kann], ohne es sichtlich gelernt zu haben oder wenigstens ohne daß ihm das Lernen schwer fällt; dasjenige [aber], dessen Erlernung ihm schon im Anfange Verdruß macht und nicht recht vonstatten gehen will, … ihm nicht zu[komme]“, dann kann die Antwort auf die Frage nach dem Berufensein zum Maler kaum länger zweifelhaft sein.
Literarische Anfänge
Blieb das dringlichere Problem der künstlerischen Zukunft des einstigen „Spiritualisten“ und ‚Kopfmalers', als welche sich, freilich nur sehr zaghaft und ganz allmählich, das weite Feld literarischer Betätigung zu eröffnen scheint. Ein im Sommer 1843 vorübergehend (8.7.-16.8.) geführtes Tagebuch jedenfalls läßt einen zunehmend deutlicher werdenden, zuletzt sogar „großen Drang zum Dichten“ erkennen. Ein fleißiger Leser (wiewohl anfänglich ganz auf empfindsam-weltabgewandte Manier) war K. von jeher gewesen, ein „Schreiber“ nach eigenem Bekenntnis „vielleicht schon vom zwölften Jahre an …“, warum also sollte er „nicht [einmal] probieren, was an der Sache ist?“ Während er sich noch darüber verwundert, wieso er die Münchner Jahre „handelnd und leidend … [hatte an sich] vorbeiziehen lassen, ohne eine Silbe darüber niederzuschreiben“, sich ernsthaft anschickt, dieses sein bisheriges Versäumnis nachzuholen, gibt es, kaum daß ein Dutzend Seiten zu Papier gebracht sind, eine „klangvolle Störung“ in Form der Begegnung mit den Gedichten Herweghs („Lieder eines Lebendigen“) und Anastasius Grüns („Schutt“). Politisch ist dies die Zeit der Sonderbundskämpfe in der Schweiz, eine Zeit, von der es nun (5.8.43) im Tagebuch heißt, sie ergreife ihn „mit eisernen Armen. Es tobt und gärt in mir wie in einem Vulkane. Ich werfe mich dem Kampfe für völlige Unabhängigkeit und Freiheit des Geistes und der religiösen Ansichten in die Arme“. Was dieses Toben und Gären auf poetischem Gebiet zutage fördert, sind – anstelle der Autobiographie – Verse, Kampflieder voll verbaler Radikalismen gegen reaktionäre Finsterlinge in Kirche und Parteileben, auf Kanzeln und Fürstenthronen. K. statt als stillschaffender Maler oder nachdenklicher Autobiograph als Polit-Barde mit radikal-liberaler Attitüde – das ist eine gewiß überraschende Kehre und Öffnung nach ‚draußen', die ihn zunächst Kontakt finden läßt zu jenen buntschillernden Immigrantenkreisen von Herwegh bis Bakunin, ihm Mut macht, den Herausgeber der „Lieder eines Lebendigen“ (Fröbel) anzugehen, und ihm schließlich in der Person Adolf Follens einen tatkräftigen Förderer ‚beschert', der nach dem Versuchsballon einer ersten vorläufigen Auswahl („Lieder eines Autodidakten“) im folgenden Jahr 1846 einen umfangreicheren Band „Gedichte“ – freilich nicht ohne eigenwillige Redaktionen – bei dem befreundeten Buchhändler Anton Winter in Heidelberg erscheinen läßt. Begeisterte Rezensionen verhelfen dem eben noch Erfolglosen zu einem Namen, dessen Klang selbst dann nichts von seiner Wirkung verliert, als die politischen Freunde längst zerstoben, die emphatischen Stilübungen der Sommertage zwischen 1843 und 1845 vorüber oder doch zumindest dabei sind, sich wieder „im stillen“ zu verlaufen. Einmal zum Spielmann der liberalen Bewegung avanciert, erhält er auf Betreiben einiger in Zürich ansässiger reichsdeutscher Professoren magistratliche Unterstützung in Gestalt eines Reisestipendiums – mit keiner andern Auflage verbunden als der, sein Talent weiterzubilden und das angetragene Unternehmen wahlweise via Orient respektive an einer deutschen Hochschule zu absolvieren: Plötzliche Verkehrung jahrelanger nicht nur pekuniärer Erfolglosigkeit in ihr Gegenteil, und dies auf Grund von Produktionen, die der Autor selbst zumindest für verfrüht und voreilig, für ‚unerlebt' auch – ein wichtiges Kriterium gegenüber früher (1837/38) und später Veröffentlichtem! – hält. Mag dies immerhin als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit erscheinen, von „Erweckung“ wird man angesichts des 1846 Vorliegenden allenfalls in psychologischer Hinsicht sprechen können, sei es, daß K. hier Gelegenheit nahm, seine privaten Probleme nach außen zu projizieren, sei es, daß er die Chance erkannte, die einst unfreiwillig auferlegte Isolation, als Mitglied einer verschworenen ‚Kampfgemeinschaft', überspringen zu können. Demnach scheint es zuletzt auf wenig mehr denn auf Bestätigung des einmal eingeschlagenen poetischen Weges hinauszulaufen, aber selbst dieser Effekt wird wieder zweifelhaft, wenn man hört, K. habe augenblicksweise daran gedacht, mit dem Erlös des Liederbändchens nach München, zur bildenden Kunst zurückzukehren. Daß es erst der Verlockung des Stipendiums bedurfte,|ihn literarisch bei der Stange zu halten, macht die wesentlich funktionale Bedeutung dieser frühen Produktionen unbezweifelbar: Während er Pankraz die Orientofferte annehmen und nach Indien reisen läßt, wählt er für sich selbst Heidelberg zum Studienort.
Stationen der Selbstfindung: Heidelberg und Berlin (1848–55)
Was ihn die Universitätsstadt den Abenteuern der Ferne vorziehen läßt, ist (neben anderem) das Verlangen nach jenem so einfachen wie rückhaltlosen „Glück des Wissens“, von dem der „Grüne Heinrich“ in beinah schwärmerischem Tonfall zu berichten weiß, wobei der Art und Weise, in der K. sich diesen Jugendtraum erfüllt, naturgemäß alle Merkmale des Autodidaktischen anhaften: Seit dem Wintersemester 1848/49 werden scheinbar wahllos und in bunter Fülle Kollegs über Anthropologie (Henle), Literaturgeschichte, Ästhetik und Philosophie – Begegnung und Freundschaft mit →Hermann Hettner gehen daraus hervor – bis hin zu Exerzitien in Physik und Jurisprudenz absolviert. Lediglich die eigentlich historischen Studien, dem Stipendiaten ausdrücklich ans Herz gelegt, wollen nicht recht voranrücken, schon deshalb nicht, weil sie (fatalerweise) vormittags gelegen sind, eine Tageszeit, zu der der Studiosus K. grundsätzlich „keine Kollegien“ besucht.
Die eigentliche Anregung aber kommt ihm von außerhalb des universitären Bereiches zu: in Person und Lehre Ludwig Feuerbachs, der als exponierter Verfechter atheistischer Denkweise sein offizielles Lehramt längst hatte aufgeben müssen und statt dessen eben den Winter 1848/49 hindurch dreimal wöchentlich im Rathaussaal vor einem gemischten Publikum aus Studenten, Bürgern und Arbeitern über das Wesen der Religion sprach. Wenn K. dabei aus der Rolle eines anfänglich eher kritisch-distanzierten Zuhörers allmählich in die eines Sympathisanten und zuletzt Proselyten hinüberwechselt, so ist dies eine ‚Bekehrung' nach Saulus/Paulus-Muster weniger auf intellektuell (religions-) philosophischer Ebene denn im Umkreis ästhetischer Anschauungen. Hatte er noch kurz zuvor (30./31.10.1848) in einer Rezension der „Gesammelten Schriften“ Arnold Ruges die materialistische Position – unter ausdrücklicher Einbeziehung Feuerbachs! – ihres notorisch kunst- und schönheitsfeindlichen Charakters wegen generell und mit Verve abgelehnt, so lernt er nunmehr in zäh und intensiv geführtem geistigem Ringen diesen seinen wesentlich, produktionsethisch' eingefärbten Vorbehalt als Irrtum erkennen und – folgerichtig zu kassieren. Erst, als er sicher sein kann, daß das Leben für den Dissidenten keineswegs „prosaischer und gemeiner“ wird nach Feuerbach, ist er bereit, den Maximen seines neuen Mentors zu folgen und sich an ein tabula-rasa-Machen zu begeben, wobei sich herausstellt, wie sehr die religiöse Verunsicherung bereits fortgeschritten, sein Gott längst nur noch „eine Art von Präsident oder erstem Konsul [war], welcher nicht viel Ansehen genoß“; nachdem er Feuerbach gehört und erlebt hat, heißt es: „ich mußte ihn absetzen.“ K. damals über seinen Lehrer: „Die Welt ist eine Republik, sagt er, und erträgt weder einen absoluten, noch einen konstitutionellen Gott … Ich kann einstweilen diesem Aufruf nicht widerstehen.“ Freilich ist der theologische ‚Demokrat' K. damit auch in Zukunft alles andere als areligiös. Neben Duldsamkeit Andersdenkenden gegenüber äußert sich die Gottesfürchtigkeit dieses Mannes, der in bezug auf sich selbst nicht einmal schwören möchte, niemals wieder ein „Reichsoberhaupt“ zu wählen, mehr noch in einer tiefverwurzelt-allumfassenden Ehrfurcht vor dem Leben. Künftighin weder als Person noch als Abstraktum gedacht, holt er ‚seine' Gottheit von den Altären herunter, aus der Enge der Kirchen heraus, um sie in den Weltsaal Natur zu versetzen, von woher sie dem in der Nachfolge Feuerbachs ‚weltfrommen Gottesleugner' als numinoser Schönheitsglanz zurückstrahlt.
So steht am Ende des Heidelberg-Aufenthalts ein neues Sich-ins-Benehmen-Setzen mit der zwar weitgehend entgöttlichten, aber noch immer erregend reiz- und geheimnisvoll verbliebenen Welt als entscheidende Voraussetzung für die Tragfähigkeit allen ferneren künstlerischen Planens und Schaffens. K. reist Anfang 1850 nach Berlin in der Gewißheit, dort das Ziel dichterischer Verwirklichung zu erreichen; und er kultiviert diesen Glauben um so enthusiastischer, als er auf anderm Felde, im Kampf mit dem ‚alten Adam' in sich, bereits schmählich unterlegen war und im Gegensatz zu ursprünglich hochgespannt-utopistischen Erwartungen (Freiligrath gegenüber) kleinlaut hatte bekennen müssen, menschlich sei er, unerachtet allen Sterblichkeitsbewußtseins, „weder besser noch schlechter geworden, sondern ganz, im Guten wie im Schlimmen, der Alte geblieben …“.
Nun ist diese zweite Station seiner Bildungsreise nicht nur bewußter gewählt, K. erscheint inzwischen auch besser vorbereitet|als zur Zeit seiner Ankunft in Süddeutschland: In Berlin als dem damaligen Mekka der Theaterwelt will er sich, als Konsequenz der bereits in Heidelberg theoretisch begonnenen dramaturgischen Studien und getreu der Maxime, nach der Kenntnisse sich am ehesten vermitteln lassen auf dem Wege anschauender Beobachtung, das praktischhandwerkliche Rüstzeug aneignen. K. auf dem Weg zum Drama – das scheint auf den ersten Blick nur die logische Folge und Erfüllung zu sein der vielleicht ältesten unter all seinen künstlerischen Betätigungen: Schon das allererste Notizbüchlein von 1833 enthält einen Personenzettel zu „Rettung für Rettung“, und von weiteren ausgiebigen dramatischen Spiel- und Stilübungen des Kindes weiß die Autobiographie von 1876 zu berichten. Die „Meerkatzen“-Episode des „Grünen Heinrich“ hat sich so oder ähnlich tatsächlich zugetragen, nur daß K. sich in Wahrheit noch weit ungeschickter anließ als im Roman nachzulesen und von daher einen wenig schmeichelhaften Übernamen („de stiif Züriaff“) davontrug. Gleich bei seiner Abreise aus der Heimat standen denn auch – noch verdeckt zwar – Theaterpläne im Raum, und als er im Frühjahr 1850 Berliner Boden betritt, trägt er das Bruchstück eines bereits in Heidelberg konzipierten Trauerspiels („Therese“) im Gepäck.
Nach derart aufwendigen Vorbereitungen geschieht nun wenig mehr als ein rasch lustlos werdendes und immer erneuten Stockungen unterworfenes Weiterbasteln am „Theresen“-Fragment. Im übrigen besucht K. sooft als möglich Theateraufführungen, wobei er, wie die Biographie von 1889 zu berichten weiß, „an Hand des [je] mitgenommenen Zettels, den er aufbewahrte, eine Reihe von Betrachtungen und Folgerungen schrieb, die er für sich aufbehielt.“ Dies letztere doch nicht ganz, wie aus der Korrespondenz mit →Hermann Hettner ersichtlich, in deren Verlauf K. so etwas wie eine Theorie des Dramas entwirft, eine Konzeption, die – ihrer innern Stringenz und Logik entsprechend – zu weiten Teilen und gelegentlich fast wörtlich in das 1852 erscheinende Buch des Freundes („Das moderne Drama“) eingehen konnte: K. hier zur Abwechslung in der Rolle des ‚Ghostwriters' wie des Theoretikers wider Willen – ein ebenso apartes wie, gemessen an den hochgesteckten Zielen und Ansprüchen, mageres Ergebnis.
Bleibt die Frage nach den Ursachen, wo doch, zieht man die zwischenzeitlich erreichte weltanschauliche Position zu Rate, mit Ablehnung aller christlichen Tröstungen zumindest eine entscheidende Voraussetzung für das Vorhandensein des Tragischen gegeben war, die Unwiderruflichkeit nämlich allen Tuns und Unterlassens. Warum also, ungeachtet dieser denkbar günstigen Ausgangsbasis – Tod als endgültige Vernichtung – keine Dramen aus der Feder K.s? Die Antwort läßt sich am ehesten den Briefen an seinen Freund Baumgartner entnehmen, sofern man weiß, wie weitgehend die Begriffe des Dramatischen und Tragischen in K.s Denken zu Synonyma verschmelzen, und sobald man ergänzt, daß der Tod dem Nichtchristen K. über lediglich ernste Bedenklichkeit hinaus zum übergewaltigen Schrecknis aufsteigt; und eben weil in dieser Valenz und Größenordnung nicht zu ertragen, auf alle erdenkliche Weise verkleinert, das heißt auch spaßhaft vermindert, ins Komische umgebogen werden muß: Ein Prozeß, der, soweit nicht bloß vordergründig-taktischen Erwägungen entsprungen, stofflich am deutlichsten zu greifen ist in den erhaltenen Notizen zu dem Lustspielplan „Die Rothen“ von 1851, darin die Greuel der Revolution ins Lachhafte gezogen und schließlich ad absurdum geführt werden sollten dadurch, daß ein Monarchist und ein Republikaner sich wechselseitig zum Tode verurteilen und anschließend genötigt sehen, der Exekution leibhaftig beizuwohnen, worauf „das lehrreiche Spiel“ mit Hilfe von Scheintod und unverhoffter Begegnung eine „possierliche Lösung“ erhalten hätte. „Jedem das Seine“ überträgt den tragischen Liebeskonflikt – das „Theresen“-Thema! – ins Komödiantische, macht daraus eine Art von Partnertausch und komischem Menuett zu viert. Womit denn Feuerbach nicht nur als Geburtshelfer, sondern ebensosehr als Totengräber des Dramatikers K. dastünde?
Nun mag Todesfurcht zwar eine der objektiv benennbaren Ursachen des K.schen Unvermögens dem Tragischen gegenüber sein und es, wenn nicht mit dem Teufel, so doch mit dem ‚lieben Gott' und dessen Suspendierung zusammenhängen, daß aus ihm nicht der erhoffte „Shakespeare der Zukunft“ wurde; durchmustert man indes das vorhandene Material, so muß die Diagnose im subjektiven Bereich auf ‚Insuffizienz' lauten, und dies im Unterschied zum ‚fraglichen' Maler und umstrittenen Lyriker in eindeutiger Weise: K. war weder seinem Wesen noch seinem künstlerischen Vermögen nach je ein dramatisches Talent! Ein absolutes Debakel demnach, und ein Versagen, das ihn selbst am härtesten getroffen haben muß. Wie lange er brauchte, sich davon zu erholen,|läßt bereits die ungewöhnliche Länge des Berlin-Aufenthalts vermuten; und völlig scheint er dieses Desaster nie verwunden zu haben, wie sonst hätte man sein lebenslang währendes zähes Festhalten an wechselnden Dramenplänen zu deuten? Zieht man das Fazit, dann brachten die Berliner Jahre zunächst die Krise seines Künstlerdaseins schlechthin. Wenn sie erneut relativ unbemerkt verlief, dann diesmal wesentlich deshalb, weil nach außen hin die Arbeit am Roman im Vordergrund stand und der Berliner Aufenthalt so, anders als die Münchner Episode, in Hinsicht auf den (poetischen) Ertrag über jeden Zweifel erhaben blieb.
In der Tat wäre das, was von Beginn an und uneingeschränkt die Tagesordnung hätte bestimmen sollen, die Arbeit am „Grünen Heinrich“ gewesen. Durch die politischen Wirren in den Anfängen unterbrochen, hatte K. dieses sein immerhin erstes bewußtes dichterisches Vorhaben nicht nur mit auf die Reise und wohl auch gelegentlich wieder zur Hand genommen, sondern gegen Ende des Heidelberg-Aufenthalts seinem neuen Braunschweiger Verleger angeboten mit der im Nachhinein kaum glaublich anmutenden Versicherung, im Verlauf von etwa vierzehn Tagen wenn nicht die ganze Arbeit, so doch wesentliche Teile des Manuskripts abliefern zu wollen. Aber obwohl Viewegs Antwort bemerkenswert positiv ausfällt, reagiert K. – verräterisch! – erst zwei volle Monate später (3.5.1850) von Berlin aus mit jener bekannten Einlassung hinsichtlich der „Moral“ seines Buches; verräterisch deshalb, weil an dieser Verzögerung weniger der Ortswechsel als vielmehr eine zwischenzeitlich erfolgte merkliche Interessenabkühlung dem Sujet selbst gegenüber Schuld trug; ein Stimmungswandel, demzufolge K. das subjektive Genre wo nicht zu überspringen, so doch entschieden zurückzustutzen gedachte und – dies generell – möglichst bald hinter sich gebracht wissen wollte zugunsten objektiver, das hieß für ihn damals noch: dramatischer Tätigkeit. So soll der Roman, kaum begonnen, zugleich schon die letzte (autobiographisch eingefärbte) Äußerung dieser Art sein, wie er, mit der Redaktion an den „Neueren Gedichten“ (1851 bei Vieweg erschienen) beschäftigt, gleichzeitig Abschied zu nehmen gedenkt von aller Erlebnis-Lyrik.
Es sollte ein langer Weg werden zum kurz gedachten Abschied; was den Roman angeht, wird er den Autor noch fünf Jahre über den selbstgesteckten Liefertermin hinaus in Atem halten. Um eine Verzögerung dieses Ausmaßes zu bewirken, muß nun freilich ein ganzes Bündel von Faktoren zusammenkommen: Zu der wachsenden Degagiertheit allem subjektiven ‚Geblümsel' gegenüber – bei gleichzeitig enervierend erfolglosem Werben ums Drama – der Aufenthalt in einer (wieder einmal) ungeliebten Stadt, in der sich der permanent Heimwehkranke nicht nur innerlich einsam weiß, sondern zuletzt noch unglücklich verliebt. Denn wenn er Berlin abwechselnd einen „verdammten Sandhaufen“ nennt oder als „Saunest“ tituliert und „zum Teufel“ wünscht – Aversionen, erwachsen aus der Irritation angesichts ihn umgebender Armut bei daraus folgender Roheit der Wesensart–, so läßt ihn die Stadt dies entgelten, indem sie ihm die kalte Schulter zeigt. Dies freilich wesentlich in Gestalt des vornehmen Berlin der Salons und Abendgesellschaften, wo Varnhagen von Ense ihn „für die Welt etwas verschroben, nicht ganz brauchbar zugerichtet“ findet; vor allem aber in Erscheinung und Person Betty Tenderings, Schwester der Verlegersgattin Lina Duncker, in die K. sich hoffnungslos verliebt. Hoffnungslos weniger der Altersdifferenz – Betty ist immerhin zwölf Jahre jünger – als vielmehr des fatalen Größenunterschieds wegen, verkörpert sie doch von allen ‚Schätzen' des Dichters wohl am ausgeprägtesten jenen Heroinentyp, der nun einmal seinem Schönheitsideal entsprach. Während aber „große schöne Menschenbilder immer wieder die Sinne verleiten“ und die Umwelt (hier K.) geneigt ist, „ihnen einen höheren menschlichen Wert zuzuschreiben, als sie wirklich haben“, mußte es umgekehrt einer eleganten jungen Dame vom Schlage Betty Tenderings schwerfallen, hinter der kleinen, ruppig-„struppigen Personnage“ ihres Liebhabers die Liebesfähigkeit eines treugesinnten Herzens zu erkennen. K. weiß um diese Über-Forderung, und so ist es wenig wahrscheinlich, daß er sich Betty gegenüber erklärt hat, zumal es bereits nach den Heidelberger Irrungen um Johanna Kapp diesbezüglich geheißen hatte, sein Herz „einem liebenden Weibe noch [einmal] als bare Münze anzubieten, dazu … habe … [er] es nun schon zu sehr abgebraucht …“. Am Ende vertraut er seine Leiden um die hübsche Rheinländerin wie seine abschließend-endgültige Resignation in Liebesdingen den Schreibunterlagen an, die er während der Arbeit am „Grünen Heinrich“ benutzt. Geldnot, Liebesleid, dazu die große Einsamkeit in einer großen Stadt – wahrlich Anlässe genug, einen wenn nicht manisch-depressiven, so doch eigner Aussage zufolge von bisweilen geradezu „pathologische[r] Arbeitsscheu in puncto litteris“ befallenen|Menschen an zügigem Schreiben zu hindern. K. kannte das unheimliche „Stadium des faulen Hundes“, auf das er in den „Züricher Novellen“ ironisch anspielt, aus innerer Anschauung allzu gut. „Nichts getan“, lautet ein bezeichnender Tagebucheintrag aus dem Jahre 1843, und nicht selten wird das tägliche ‚Pensum' jener Berliner Tage ähnlich ausgefallen sein. Rechnet man ferner sein ‚Kopfdichtertum' hinzu, das heißt die Angewohnheit, dichterische Visionen, hatten sie in seiner Phantasie erst einmal Gestalt angenommen, sogleich für (schreib- oder lese-) ‚fertig' zu halten – und anschließend guten Gewissens dafür auszugeben! –, so kann man die Traumata ermessen, die Vieweg wie spätere Verleger im Umgang mit einem Menschen davontrugen, der so wenig Zeitgefühl zu haben schien, daß manche seiner Geschäftspartner die Erfüllung eingegangener Verträge erst sozusagen ‚posthum' erleben sollten.
Derart „fabelhafte Langsamkeit“ läßt sich am Entstehungsprozeß seines epischen Erstlings in geradezu exemplarischer Weise verfolgen. Hier, in der Korrespondenz zwischen Autor und Verleger, spielen sich jene dramatischen Szenen ab, die K. für die Bühne nicht gelingen wollten; es wechseln Zuspruch und Anmahnung, ultimative Forderung und (Beinah-) Kapitulation (des Schreibers), Vorabveröffentlichung und (erzieherisch gedachtes) Sich-Verweigern. Im April 1855 liegt das Material zum abschließend vierten Band endlich vor, von Autorseite „unter den größten Leiden aller Art … fertig gebracht …“, „das letzte Kapitel … buchstäblich unter Tränen geschmiert …“.‚Glückhaft' konnte das Ganze sich unter den obwaltenden Umständen – so gut wie alle Stereotypen empfindsamen Leidens hatten bei der Entstehung Pate gestanden – wohl kaum präsentieren; im Gegenteil nimmt es nicht wunder, daß der Roman genau das wurde, was schon das Abrégé von 1850 versprochen hatte: ein Stück empfindsamer Epik, in dem der Held an sich selbst wie den leidvollen Erfahrungen „immerwährenden Mißlingen[s] … [seines] Zusammentreffens mit der übrigen Welt“ zugrunde geht, zwar nicht eben ein kleiner, dafür jedoch ein um so trister gestimmter Roman „über den tragischen Abbruch einer jungen Künstlerlaufbahn … mit … einem zypressendunkeln Schlusse, wo alles begraben“ wird.
Ungeachtet dieser „förmliche[n] Elegie über den Tod“ war und wurde das Schicksalswerk zunehmend ein Buch der Befreiung. Indem K. sich des Goetheschen Verfahrens bediente, den schlechtern Part seiner Selbst aus sich herauszustellen und in Gestalt des Helden gleichsam in effigie hinzurichten, gelingt es ihm, die eigne Haut zu retten und seinen Frieden zu machen mit der Welt. Freilich bedurfte es ebenso langer – die zu ungewöhnlichem Umfang angeschwollene Jugendgeschichte – wie bitter-schmerzlicher Erfahrungen, ehe K. das letztlich Asoziale seines Weges nach innen einsehen lernte. Umgekehrt: wenn ihm aus dieser Konfliktsituation heraus der Durchbruch gelingen sollte zum Dichter, dann folgerichtig in autobiographischer Form, in Gestalt eines Rapports seiner Leiden und Irrtümer, ehe das von sich selbst berichtende Ich fähig erschien, über andere und die (trotz allen privaten Leids) schöne Welt zu schreiben.
Wie sehr K. sich mit Abschluß des „Grünen Heinrich“ freigeschrieben hatte, läßt sich kaum überzeugender demonstrieren als im Hinweis auf die in ihrer Singularität beinah wie ein Wunder anmutende Leichtigkeit der Entstehung des ersten Seldwyla-Bandes. Fast unbemerkt liegen im Frühherbst 1855 fünf der später insgesamt zehn Erzählungen des Zyklus vor; aber was andern Anlaß genug gewesen wäre zu Empfindungen freudiger Genugtuung – immerhin sind Perlen wie die „Pankraz“- und „Romeo“-Novellen oder jene nachmals berühmte Geschichte von den „Gerechten Kammachern“ darunter –, findet bei K. gar keine Erwähnung oder allenfalls eine schlechte Beurteilung, weil er das Erreichte ausschließlich mißt am Erstrebten. Dies so rigoros, daß die erwähnte Diskrepanz gleich in der Eingangserzählung noch einmal und sozusagen schulgerecht thematisiert wird, wie dabei zugleich ein (neben der Todesfurcht) weiterer objektiv benennbarer Grund beigebracht werden kann für das Verfehlen des Dramatischen: die als wesentlich epigonal empfundene Zeitsituation. Anläßlich des Verhaltens der Lydia – Betty Tendering soll ihr Züge geliehen haben – geht dem Pankraz der insgesamt unzulängliche Charakter von Menschheit und gegenwärtigem Weltzustand auf. Die Ära der großen Naturen – die Shakespeare/Hamlet-Thematik, wie die „Romeo“-Novelle sie bereits im Titel erkennen läßt – sei passée, heißt es, und so treffe nie ein „ganzer Schurke auf einen ganzen wehrbaren Mann, nie ein vollständiger Narr auf einen unbedingt klugen Fröhlichen“; mit der Folge, daß es, wie im Leben, so in der Kunst, „zu keinem rechten Trauerspiel noch zu keiner guten Komödie kommen kann.“ Je mehr K. sich in historischer Hinsicht als Angehörigen eines Zwischenreichs begreifen lernt zwischen Goethe-Klassik (mit der noch immer als kanonisch-vorbildlich geltenden Kunstform Drama) und einem erst vage erkennbaren Neuen, desto mehr erscheint ihm episodisch-anekdotische Prosa als die eigentlich (zeit-) gemäße Darbietungsform. Wenn es ‚Geschichten' absetzt dabei, dann, wie gleich im „Pankraz“, solche der halben Gefühle und schließlichen Entsagung. Wo es darüber hinaus und ausnahmsweise Fälle gibt von ausgetragener Leidenschaft, bleibt das äußerste Erreichbare die tragische Novelle, ein „Romeo“-Schicksal, oder – vice versa – die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Komödie angesiedelte Erzählung lustspielhaften Zuschnitts („Kleider machen Leute“). Womit derartige Kunstübung vornehmlich ein Sich-Bescheiden beinhaltet, für den Dichter – darin den Gestalten seiner Phantasie ähnelnd – einem Akt der (künstlerischen) Entsagung gleichkommt.
Mochte K. so anstelle ausbündigen Vergnügens eher ein stilles Genügen empfinden ob des Erreichten, es war und wurde dies, gewollt oder ungewollt, dennoch sein eigentliches Metier, das, was ihm innerhalb der Grenzen seiner Zeit an verbleibender Möglichkeit zu objektiver Welterfassung „zukam“. Berlin bringt damit nächst der großen Krise zugleich deren nachhaltige Überwindung; wie nachhaltig-endgültig, lehrt ein Blick auf die spätere Produktion: Von ihr führt K., als er endlich in die Heimat aufbrechen kann, mit Ausnahme der „Züricher Novellen“ und des „Martin Salander“ nahezu alles – bei unterschiedlichsten Reifegraden – mit sich, das heißt aber den weitaus überwiegenden Teil seines nachmaligen erzählerischen Schaffens überhaupt.
Im Amt (1861–76)
Zwar verläuft die Heimkehr noch einmal nach gehabtem Muster – die Mutter muß das väterliche Haus verkaufen, um den Sohn aus seinen Berliner Schuldverpflichtungen herauslösen zu können, und K. ist Betty Tenderings wegen nicht minder unglücklich, als er es seinerzeit vor der Abreise nach Heidelberg im Kummer um die schöne Winterthurerin Luise Rieter gewesen war; aber der da im Verlauf des Winters 1855, nunmehr 36jährig, in Zürich eintrifft, ist, wenn nicht im Bewußtsein des inzwischen Geleisteten, so doch hinsichtlich der Gewißheit seiner künstlerischen Möglichkeiten ein anderer geworden. Menschlich findet er alte Freunde wieder, allen voran →Wilhelm Baumgartner, den Komponisten und Vertoner so manches seiner Lieder. Dazu ergeben sich neue Kontakte und Bekanntschaften mit Friedrich Th. Vischer, →Gottfried Semper, →Jacob Burckhardt, →Richard Wagner und anderen. Von dem ehemaligen Kreis um Folien ist nur Herwegh geblieben, Folien selbst bereits ein Jahr zuvor in Bern verstorben. Und zumindest nach außen hin erfreut sich der Heimgekehrte eines zunehmenden literarischen Rufes. Insbesondere →Berthold Auerbach tut sich seit Besprechung der „Leute von Seldwyla“ in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ als Entdecker und Protektor hervor, so sehr, daß K. zuletzt abwiegeln muß und derart verdienstvolle Gespreiztheit mit dem halb ärgerlichen, halb belustigten Bonmot quittiert, er sei vielleicht doch noch mehr und anderes als gerade nur „Auerbachs Keller“. Freilich bleibt festzuhalten, daß K. erst mit großer Verspätung und auch dann nur vorübergehend (s)ein Publikum findet. Als 1873/74 der 2. Teil der „Leute von Seldwyla“ erscheint, erweist die Neuauflage der Eingangserzählungen (von 1856) – trotz des Abstands nahezu zweier Jahrzehnte und einer kümmerlich anmutenden Auflage (500 Stück) – sich mehr als buchtechnische denn als kaufmännische Notwendigkeit. Entsprechend vermag der Autor, in der Absicht, den „Grünen Heinrich“ umzuschreiben, ohne viel Mühe noch genügend Restexemplare (120 von 1000) von seinem einstigen Verleger zurückzukaufen, um damit den strengen Winter 1879/80 hindurch zur Freude der sparsamen Schwester den Ofen seines Arbeitszimmers heizen zu können. Was Wunder, wenn der (erste) Versuch einer Existenz als freier Schriftsteller – verfrüht unternommen – zum Scheitern verurteilt ist, zumal K. mit neuerlichen Produktionszusagen – trotz selbstauferlegter Konventionalstrafen – bereits wieder hoffnungslos im Hintertreffen liegt, das in den Jahren bis 1860 Veröffentlichte mithin wesentlich auf Gelegenheitsarbeiten (Festlieder, Maskenaufzüge, Prologe und so weiter) beschränkt bleibt.
In dieser Situation tut K. den entscheidenden Schritt, versteht er, der zuvor zweimal (1854/57) das Angebot einer Professur am Zürcher Polytechnikum aus fachlichen Skrupeln wie um seiner poetischen ‚Sendung' willen abgelehnt hatte, sich schließlich dazu, „den bürgerlichen Begriffen genugzutun und mittels der Eselsbrücke von Amt und Einkommen über die kritische Zeit hinwegzugehen …“. Als 1861 die ebenso angesehene wie gutdotierte Position des Ersten Staatsschreibers des Kantons Zürich – der Leitung einer heutigen (Länder-) Staatskanzlei vergleichbar – frei wird, haben Freunde ihn vermocht, seinen Namen auf die Liste der Anwärter zu setzen. Die Beweggründe mögen vielfältig gewesen sein, Gefühle der Verpflichtung Mutter und Schwester gegenüber sowenig gefehlt haben wie vorbeugend-selbstretterische Tendenzen angesichts einer zunehmend deutlicher hervortretenden Empfindung unwiderruflich verrinnenden Lebens. Die Bewerbung selbst, einen einzigen Satz umfassend, fällt lakonisch aus, ist jedoch nicht erfolglos: Mit knapper Mehrheit (5: 3) – die Wahl begleitet von unüberhörbar publizistischem Mißfallen – entscheidet man sich für ihn. Einwände, auch berechtigte, gab es genug, sie reichten von Vorbehalten gegen seine private Lebensführung über Fragen nach der fachlichen Kompetenz bis hin zu Zweifeln an der richtigen, sprich parteipolitisch erwünschten Einstellung. Den erstem Argwohn angehend, sollten die Zürcher nur vermeintlich Recht behalten. Zwar erschien der neue ‚Würdenträger‘ am Tage des Amtsantritts (23.9.1861) zu spät und verkatert und überhaupt erst, nachdem sein Gönner ihn mit Mühe hatte aus den Federn holen können, nach vollzogener Übersiedlung ins „Steinhaus“ aber hat K. sich auch nicht die geringste fernere Unpünktlichkeit zuschulden kommen lassen. Da der neue Staatsschreiber die anfangs mangelnde Sachkenntnis durch intensives Einarbeiten zu kompensieren verstand, blieb von allen Zweifeln lediglich der politische, konkret gesprochen, die Frage nach der Vereinbarkeit von Staatsamt und K.s einst prononciert liberaler Gesinnung zurück. Hier nun konnte, zumindest was den Zeitpunkt der Einstellung betraf, von Anpassung keine Rede sein, hatte K. doch gerade noch (Mitte 1860–61) im Zusammenhang mit dem sogenannten ‚Savoyer Handel' gegen die herrschende Friedenspartei polemisiert und dabei derart unverblümt zum Kampf gegen die Annexionspolitik →Napoleons III. aufgerufen, daß seine alten Gönner →Jakob Dubs und →Alfred Escher eher umgekehrt nach Beweisen von Loyalität hätten fragen können. Andererseits sollten die 60er Jahre die Zeit der Verfassungsrevisionen werden, Bestrebungen aufkommen lassen, die in zunehmendem Maße auf eine Umwandlung des Repräsentativ-Systems in eine zuletzt absolute Demokratie hinausliefen. Und eben diesem Trend gegenüber erwies gerade K. sich nun alles andere als förderlich. Sollte demnach nicht der Eintritt ins Amt, wohl aber das Amt selbst den einstigen Radikalliberalen zu jener Haltung bürgerlicher Regression veranlaßt und ihn am Ende gar korrumpiert haben?
Läßt man die stattliche Liste seiner öffentlichen Aktivitäten vom ‚Straußenhandel' (1839) über den ‚Freischärler' der Jahre 1844/45 bis hin zur Abwehr militanter Übergriffe Preußens (Neuenburg 1856) wie Frankreichs (1860 folgende) Revue passieren, so hatte er sich längst vor den „Gedichten“ von 1846 politisch engagiert gezeigt, war er oft genug ein ‚Trommler' – vergleiche die aus Anlaß des zweiten Freischarenzugs entstandene Karikatur aus der Feder von Johannes Ruff – gewesen für die Sache der Freiheit, freilich niemals ein Chaote. Und so vernimmt man im Revolutionsjahr 1848 wohl die entschiedene Forderung, es dürfe „keine Privatleute mehr geben“; seine eigne Person angehend, hält er jedoch merklich zurück, bekennt er, sich zwischenzeitlich aus „einem vagen Revolutionär und Freischärler à tout prix … zu einem bewußten und besonnenen Menschen herangebildet“ zu haben, „der das Heil schöner und marmorfester Form auch in politischen Dingen zu ehren weiß …“, ohne darüber des gesunden Sinnes „für die rechte und notwendige Revolution“ verlustig gegangen zu sein, die freilich, seine eigne Vaterstadt angehend – dank des liberalen Regiments unter Bürgermeister Furrer –, „von Tage zu Tage unzulässiger und überflüssiger“ werde. Den Ausbruch revolutionärer Gärung ringsum (Paris, Berlin, Wien …) verfolgt er in der Rolle des bloßen Zuschauers, dazu mit durchaus gemischten Gefühlen, wobei die negativen Wertungen (künstlich, krankhaft) überwiegen, wie er den Versuch gewaltsamer Veränderung sozialen Miteinanders in Chaos und Anarchie enden sieht; eine Beurteilung, bei der steigende Revolutionsangst wie erwachend-wachsende Ehrfurcht vor dem Leben einander in die Hand gearbeitet haben mögen.
Gut ein Dutzend Jahre später tritt der Staatsschreiber K. nachdrücklich für den Erhalt der repräsentativen Demokratie ein, unter den Voraussetzungen menschlicher Integrität der Regierenden freilich wie auch einer wenn nicht imperativ, so doch plebiszitär-direkt verstandenen Mandatsführung, eines Systems, wie es letztlich nur unter intakt patriarchalischen Verhältnissen funktionieren kann. Womit zugleich eine der Konstanten von K.s politischer Anschauung benannt wäre: sein ausgeprägter Sinn fürs Organische, der ihn ein Staatswesen weniger als Abstraktum denn als lebendigen Organismus – die Gemeinschaft des Volkes als Makro Familie – begreifen läßt. Lebendig geformte Gebilde dieser Art bedürfen verfassungsmäßiger Absicherung allenfalls im Sinne|variabel-lockerer Vereinbarungen, nicht aber nach Maßgabe so theoretisch ersonnener wie endgültig fixierter Idealentwürfe. Wenn K. sich in der Zeit der Revisionskämpfe immer wieder auf das ‚Positionspapier' von 1831 beruft, so selten ohne den Hinweis auf die Vielzahl der zwischenzeitlich (bis 1865) erfolgten Änderungen, um eben an ihnen das Moment des gewachsen Lebensvollen hervorheben zu können.
Wichtiger als alle gesetzlichen Fixierungen – wobei der Praktiker K. den angestrebten Demokratismus für sowenig machbar hält, wie der Menschenkenner sich davon eine Besserung der politisch-sozialen Verhältnisse verspricht – erscheint ihm die Einhaltung bestimmter ethischer Normen als Voraussetzung jeden menschlichen Zusammenlebens überhaupt; und so setzt eben hier sein erzieherischer Impetus an: Erziehung zum rechten, das heißt natürlich-selbstlosen Menschen ist ihm folglich – und dies bereits 1852! –, nicht anders als seiner „Frau Regula“, identisch mit Erziehung zum homo politicus, das heißt zu jener Art von mündigem (Staats-) Bürger, der seine politischen Rechte und Pflichten zu gebotener Stunde „ohne zuviel Geschrei, Zeitverlust, Reibung …“ wahrzunehmen weiß. K. selbst geht, den lediglich funktionalen Stellenwert politischen Handelns überhaupt wie erst recht allen speziell poetisch-politischen Geschäfts überzeugend demonstrieren zu können, gerade hier mit gutem Beispiel voran: Schon die „Gedichte“ von 1846 hatten neben den Freiheitsgesängen auch und vielleicht ebensosehr Naturund Liebeslyrik enthalten. Und daß eine solche Zusammenstellung nicht zufällig gewesen war, konnte man der grundsätzlichen Äußerung entnehmen, wonach die Propaganda sich irre, „wenn sie glaubt, die Dichtkunst sei nur für die Tat und zu politischen … Zwecken geschaffen. Der Dichter soll seine Stimme erheben für das Volk in Bedrängnis und Not; aber nachher soll seine Kunst wieder der Blumengarten und Erholungsplatz des Lebens sein.“ Dieser frühen Maxime des Tagebuchs (8.8.1843) bleibt er zeitlebens verpflichtet, sie ist Movens und Maßstab zugleich all seiner politischen Aktivitäten, wobei die Kriterien des Politikers sich von denen des Dichters kaum nennenswert unterscheiden: Auf beiden Ebenen geht es um die Bekämpfung eigennütziger Gesinnung. Droht sie in einem demokratischen Staatswesen überhand zu nehmen, wie im Jahre 1860, als die Bürgerschaft aus wesentlich kapitalistischen Eigeninteressen heraus (Frankreich gegenüber) zum Frieden rät und dabei bourgeoise Züge anzunehmen beginnt, lehnt er sich gegen derartige ‚Verholzungen' ebenso nachdrücklich auf, wie er umgekehrt sozialistischen Tendenzen und Experimenten zu wehren weiß, solange er hinter den idealistischen volksbeglückenden Phraseologien eines Wuhrmann und Weitling nichts anderes vermutet als den kurzsichtig-gierigen Neid auf die Reichen dieser Welt, Selbstsucht also unter lediglich revolutionären Vorzeichen. In dieser Weise ‚überparteilich', ist auch sein Verbleiben im Amt über das Jahr 1869 mit dem endlich erreichten Sieg der Revisionisten hinaus weniger politischer Fauxpas als noch einmal ein Stück in Sorge um das Gemeinwohl gelebter Kontinuität; wie K.s Hoffnung dabei (gerade angesichts sich mehrender Zeichen moralisch-sittlichen Verfalls) weniger in der Faszination politischer Heilslehren gründet als auf der selbsterhaltendreinigenden Kraft des Volksganzen ruht. Als Verkörperung des Gedankens der Wechseldauer, sich seiner (latent vorhandenen) lebendigen Wirkkräfte bewußt werdend in den – Vergangenheit vergegenwärtigenden – Festen, steigt das Volk in K.s Augen auf zu wesentlich mythischer Größe. Dabei gewinnt sein Denken (bei auffälligem Fehlen spezifisch soziologischer Kategorien) neben dem Merkmal des Organischen zugleich mythische Valenz als Ausdruck eher ahistorischer denn allzu fortschrittsgläubiger Daseinshaltung.
Mag der K. des Jahres 1876 nach alledem einem Altliberalen weitaus ähnlicher sehen als dem ‚Jungtürken' von einst, zu keiner Zeit hat er darum etwas von seinen anfänglichen Prinzipien preisgegeben: Politik wie Dichtung als Medien zur Beförderung des Humanen – in diesem Sinne verwaltet er das Amt über anderthalb Jahrzehnte hinweg (1861-76). Wäre dieser Schritt je begleitet gewesen von Opportunismus, er hätte ihn teuer zu bezahlen gehabt, erwies die übernommene Stelle sich doch schon bald „weder [als] ganze noch … [als] halbe Sinekure,“ vielmehr als den vollen persönlichen Einsatz erfordernd. Wie sehr, läßt sich am eindrucksvollsten bei →Adolf Frey nachlesen, der den Spuren der Verpflichtungen des Staatsschreibers nachgegangen ist und dabei ein erstaunliches tägliches wie ein imponierendes Gesamtarbeitspensum registrieren konnte; eine Arbeitsleistung, hinter deren Bewältigung der Mensch K. fast ganz verschwände, bliebe da nicht die Vorliebe für Rosen wie die unendliche Geduld und Nachsicht seinem Lieblingstier Katze gegenüber. Der Dichter verstummt in diesen Jahren keineswegs, denkt man an die Veröffentlichung immerhin der „Sieben Legenden“ wie des Schlußbandes der „Leute von Seldwyla“. Seine Amtsbürde abzulegen zeigt K. sich erst entschlossen, als er, zu kontinuierlich poetischer Produktion aufgefordert, dazu nicht genügend Zeit erübrigen kann, während er andererseits gewiß ist, nunmehr hinreichend „Werch an der Kunkel“ zu haben, um endlich das Experiment eines Daseins als freier Schriftsteller mit Erfolg wiederholen zu können.
Dichterischer Ertrag
Nicht der strengen Chronologie, wohl aber der Rangfolge nach gehören „Die Leute von Seldwyla“ an den Anfang jeder Werkanalyse; um so mehr, als sie ebenso seinen Ruhm begründen halfen, wie sie umgekehrt maßgeblichen Anteil hatten an Entstehung und Verbreitung der Mehrzahl jener Mißverständnisse, die die Rezeption dieses Dichters seither begleiten, der Klischees, die das Verständnis seines Schaffens noch immer erschweren oder gar verstellen.
Unter psychologischem Aspekt betrachtet, setzen die Seldwyla-Geschichten just da ein, wo „Der grüne Heinrich“ aufgehört hatte: Pankraz ist seinem Charakter nach die genaue Fortsetzung (wenn man will, der jüngere Bruder) des Romanhelden. Und auch ihm präsentiert sich Umwelt nicht viel anders als jenem: äußerlich noch immer bestimmt von Mangel und Not, was die Menschen angeht, bevölkert mit fühllos-egozentrischen Figuren. Es kommt für Pankraz entscheidend darauf an, sich in der zwar nicht besten aller Welten, wohl aber der einzig denk- und lebbaren, einzurichten, ohne irreparablen Schaden zu nehmen an Leib und Seele; was auf nichts anderes hinausläuft, als zu den Fehlern und Unvollkommenheiten des Daseins die rechte Einstellung zu finden, in der Terminologie des Zyklus gesprochen: vom ausschließlichen Schmollen zum wenigstens gelegentlichen Lachen zu finden. Wie man dies bewerkstelligt, wird nicht zufällig an den jeweils mittleren Erzählstücken beider Halbteile demonstriert: Indem Frau Regula menschlich verständliche Fehler statt als Sünde oder Verbrechen als Narretei abtut, folgt sie bei ihren pädagogischen Maßnahmen nicht allein dem Prinzip der Angemessenheit der Mittel, ihrer Einschätzung von Welt und Leben zufolge hat man sie – nicht anders Gritli und Wilhelm in der Parallelgeschichte von den „Mißbrauchten Liebesbriefen“ – den halblustigen Gutbestehenden zuzurechnen, das heißt jener kleinen Schar von Auserwählten, denen im Werk K.s das hohe Ziel vorbildlicher Lebensführung zu erreichen vergönnt ist. Duldsamkeit mit Grundsätzen, lautet die Formel, auf die der Autor seine Helden verpflichtet, die Position auch, die er selbst den Gestalten seiner Phantasie gegenüber vertritt; wobei der Spielraum des (noch oder nicht mehr) Zulässigen wohl am deutlichsten erkennbar ausgeschritten wird in der Geschichte von den „Drei gerechten Kammachern“, darin alle Toleranz ein Ende hat angesichts des Unmenschlichen, wie auch die Tonlage ‚Komik' eindeutiger als je umschlägt in satirische Unerbittlichkeit. Im Typ des herzlosen Philisters zur Unnatur gesteigert, wird selbstsüchtiges Gebaren zur eigentlichen Zielscheibe K.scher Narrenschelte, das Goutieren satirischen Verlachens von Seiten des Lesers zum Testfall erhoben für das Verständnis seines Werkes schlechthin; eine Art insistierenden Beharrens, neben der die Möglichkeit humoristischen Sprechens zwar nicht in Abrede gestellt ist, seiner Verbreitung jedoch engere Grenzen als gemeinhin angenommen gezogen sind. Was Eitelkeit und Egozentrik so gefährlich macht, daß sie mit Abstand an der Spitze des K.schen Lasterkatalogs rangieren, sind ihre letztlich isolierenden und damit wo nicht lebensgefährdenden, so doch lebenverkürzenden Auswirkungen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen als eben – die Liebe! Verstanden weniger als Eros denn als Agape, wird liebevolle Zuneigung in der Bedeutung von Selbstlosigkeit und Güte zum eigentlichen Gegenspieler eigennützigen (das heißt hier Eß- oder besser ‚Freß'-Lust, Geld- und Besitzgier, Sammelwut und Horten dinglicher Schätzbarkeiten umfassenden) Verhaltens, ja man kann getrost die Behauptung wagen, die Auseinandersetzung beider Grundhaltungen sei – ein bestimmtes, den Erhalt der Menschenwürde sicherndes materielles Niveau vorausgesetzt – über „Romeo“ wie „Dietegen“ hinaus eines der Hauptthemen K.schen Erzählens schlechthin.– Freilich bedarf es, um isolierend-asoziale Ichbezogenheit in liebendes und liebevolles Miteinander aufgehen zu lassen, der (irdisch-) charakterlichen Wandlung der Beteiligten ebenso wie nachhelfend göttlicher Gerechtigkeit oder, wo diese suspendiert ist, einer Art innerweltlichen Heilsplans, demzufolge das Gute belohnt, das Böse, sprich Inhumane, bestraft werden kann, was nichts anderes besagt, als daß Märchenluft – die Summe saeldenweilerhaft günstiger äußerer Konditionen – herrschen muß, wo immer der Hans zu seiner Grete, Wenzel („Kleider machen Leute“) zu seinem Nettchen finden soll. Der einzelne, nach Art Strapinskis eine Welt herausbildend aus sich – ihm gegenüber, in schonungsvoller Distanz, die vielen, bereit, selbst Fehlentwicklungen (innerhalb bestimmter Margen) zu tolerieren, verdientem Glück am Ende nicht im Wege zu stehen, damit ist menschliche Existenz zwar nicht insgesamt, aber doch in entscheidenden Phasen den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit entzogen, K. mithin weniger ein Realist denn „au fond ein Märchenerzähler“ zu nennen.
Die eigentliche Frucht der Amtszeit, direkter Anlaß zugleich ihrer Beendigung, stellen die „Züricher Novellen“ dar, wie sie seit 1876 zunächst in der von Julius Rodenberg geführten „Deutschen Rundschau“ erscheinen. Historische Erzählungen allesamt, bedeutet dieser Umstand indes nur scheinbar ein weiteres Stück immediater Kunstübung jenseits allen Wirklichkeitsbezugs, während sie in Wahrheit ein so allgemeines wie privataktuelles Problem angehen, die Frage nämlich, ob in einer Zeit epigonalen Menschentums ursprüngliche Kunst überhaupt noch möglich sei. Wenn K. den Erzählungen sämtlich Spätzeitcharakter verliehen hat, dann nicht nur, um die Krankheit seiner Zeit in historischer Verfremdung zeigen zu können, vielmehr sind es stets auch Epochen des Umschwungs und Übergangs, und damit ist, nächst der Hoffnung auf Besserung – konkret auf Dramenproduktion! – zugleich und über alles erschwerende Historisieren hinaus bereits die Lösung des Problems angedeutet: Sie liegt, nicht anders, wohl aber deutlicher als sonst, in der Treue des Herzens, nur daß eben dies Normale in Zeiten des Umbruchs – seiner Seltenheit wegen – den Rang des Originalen gewinnt, selbst wenn es, absolut betrachtet, anstatt des Unerhörten und Erzursprünglichen das eher Einfache und Selbstverständliche darstellen sollte.
Nach Abschluß der „Züricher Novellen“ (1878) macht K. sich an die Überarbeitung des Jugendromans, eine Aufgabe, die dem einstigen Staatsschreiber inzwischen ebenso notwendig erscheint, wie sie in der nachmaligen Form durch die Erfahrungen dieser Amtsjahre überhaupt erst möglich wird. Liegengelassen als empfindsamer Roman, in dem Kunst das sozusagen einzig adäquate Medium seelischer Entfaltung gewesen war, fungiert in der Überarbeitung Malerei nunmehr als lediglich eine von zahlreichen potentiellen Bildungsmächten, während dem Helden die bittere Erkenntnis nicht erspart bleibt, im strengen Sinne überhaupt kein Maler zu sein, insofern in seiner Person schöpferisches Unvermögen mit gleichzeitiger Stümperhaftigkeit in technisch-handwerklicher Hinsicht gepaart erscheint. Folgerichtig landen die Bemühungen seines Kunstfleißes, ihrem Wert entsprechend, beim Trödler, indes er selbst sich – nolens volens – zur Haltung des Verzichts bereitfindet, wobei die Wiederholung dieses Schrittes – voraufgegangen war eine zeitweilige Wiederaufnahme der Arbeit auf dem Grafenschloß – im wesentlichen dazu dient, einen aus absoluter Notlage heraus getroffenen Entsagungsentschluß in den Rang freier Willensentscheidung zu erheben. Im übrigen bleibt Heinrich das, was er immer war: „‚ein dilettantischer Akademist'“, ein Nichtberufener im Reich der Kunst. Wenn der Dichter darüber hinaus das Künstlervölkchen insgesamt – man beachte die lange Reihe der sowohl sozial deklassierten wie psychologisch derangierten, dabei nicht selten in Wahnvorstellungen befangenen Künstler – an der Ecke des Berufsmalertums scheitern läßt, dann ist dies über alle individuellen Begründungen hinaus als Hieb und Affront gedacht gegen eine sozusagen ‚tote' Kunstgattung, deren Unfähigkeit, das wirkliche Leben zu erfassen, am Beispiel der Glasmalerei – gemalte Welt als verstaubtvergreiste Welt hinter Glas und Rahmen – besonders nachhaltig zum Ausdruck kommt, wie überhaupt der Roman sich auf dieser Stufe ausweitet zu einer Abrechnung mit dem Malmetier als der ästhetisch ‚abgehalfterten' Ausdrucksform schlechthin.
Parallel zur inneren Loslösung von den Musen vollzieht sich die Auseinandersetzung des Helden mit der Religion. Für den materiell Bedürftigen noch einmal Reich des schönen Scheins und der großen Erwartungen, wird der Glaube daran in den Erzählungen um Frau Margret in die Nähe des Aberglaubens verwiesen, bekommt christliche Lehre in der Gestalt Annas – einer Art Legendenfigur – Märchencharakter zudiktiert entsprechend der K.schen These, wonach der Wahrheitsgehalt der Bibel nicht höher zu veranschlagen sei als der alter Sagen- oder Märchenbücher. Um so gefährlich-verwerflicher, bei zunehmender Verflüchtigung religiöser Substanz – das Ätherisch-Lebensunfähige in Erscheinungsbild und Schicksal Annas –, das doktrinär-verlogene Festhalten der Zunft an einer, wenn nicht wesenlos geworden, so zumindest nicht länger wißbaren ‚Sache', gefährlich darum, weil es den Menschen – das Memento der Zwiehan-Episode! – um die buchstäblich letzte Chance der Daseinsverwirklichung bringen kann. Auch hier stellt die Station „Grafenschloß“ für Heinrich den Endpunkt eines Desillusionierungs- wie Immunisierungsprozesses dar: Dortchen, die mit ihrem Verhalten – Hingabe an den so erfüllt-schönen wie nichts als immanent-diesseitigen Augenblick – den rechten Weg vorlebt.
Es ist – in der Wiederbegegnung mit (der heimgekehrt gereiften, das heißt selbstlos und gut gewordenen) Judith – das Erlebnis der Naturwahrheit, das Heinrich aller Verstrikkung in Unnatur, Lüge und Schein befreiend enthebt und den Weg hinausfinden läßt zu dauerhafter Daseinsverwirklichung, dies letztere – wie schon im Falle der Freunde (Lys, Erikson) – sozial gefaßt im Sinne bleibendnachhaltigen Sich-verdient-Machens um das Wohl einer Gemeinschaft. Damit hat „Der grüne Heinrich“ über die (bloße) Beschreibung einer Künstlervita hinaus, als Notat aufkommenden, ausgetragenen und schließlich bewältigten Konflikts mit der Umwelt, die Dimension eines Entwicklungsromans erlangt; wobei der inhaltlich-funktionalen Seite – Restitution des isoliert einzelnen in ein (familiär, dörflich oder volkhaft) Ganzes – das strukturelle Element korrespondiert: Der Anlage nach dreischrittig, folgt einer Phase absoluter Innerlichkeit die Position einer ebenso einseitigen Extrovertiertheit, in der der Held sich nachgerade an die Welt – Heinrich in München – zu verlieren droht, während im Schlußteil alles auf eine Art Synthese zusteuert, die ‚Lösung' – sowohl räumlich wie sozial: (beengende) Bürgerlichkeit des Elternhauses – Boheme – (Wiedereintauchen in) bürgerliche Berufswelt – in Form einer Rückkehr an den Anfang gefunden wird; dies freilich, wie es sich für einen dialektischen Prozeß geziemt, auf höherer Ebene, das (neu) eingegangene Engagement weniger zu eignem Nutzen gedacht denn mit sozialem Impetus versehen und bei aller Begrenztheit des Aufgabenbereichs gekoppelt mit der Einsicht in Zusammenhang und Funktionsfähigkeit des (Staats-)Ganzen.
An die Neufassung des Romans (1879/80) – erneut ein langwieriger Prozeß mit Änderungen vom Handlungsgerüst bis hin zu stilistischen Details – schließt mit dem „Sinngedicht“ (1881) der Erzählzyklus mit der längsten ‚Inkubationszeit' bei gleichzeitig kürzester Fertigungsfrist an; ein Zyklus, dessen Einlagen am Beispiel der Partnerwahl stets das nämliche Problem der erwünschten Berechenbarkeit des Unberechenbaren demonstrieren, während sich doch in den Wundern der Liebe wie auch in deren unvermutetem Scheitern, nächst der Darwinschen These vom Kampf aller gegen alle, gerade die Behauptung von der gesetzmäßigen Anlage und Durchschaubarkeit der Welt eindrucksvoll widerlegt findet. Nimmt man die vielfältigen motivlich-thematischen Korrespondenzen zwischen Rahmen- und Binnenerzählungen wie auch den stringent didaktischen Grundriß bei durchgehend unverwechselbarem Erzähltimbre hinzu, dann erweist „Das Sinngedicht“ sich als ein vielgestaltig-komplexes Gebilde von zugleich größtmöglicher Einheitlichkeit – und in dieser letztern Valenz als entscheidendes Äquivalent gegenüber der Unform des ‚opus magnum', seines Romans, der, obwohl in der zweiten Fassung kompositionell um vieles straffer (Kürzung der Jugendgeschichte, vermehrte Kapiteleinteilungen, Einsatz strukturierender Zusatz-Motive) geraten, das Odium des ‚Strickstrumpfförmigen' auch weiterhin nicht verleugnen konnte. Zwar hatten schon die ersten Seldwyler Geschichten – und erst recht die spätere Erweiterung mit der nunmehr methodisch betriebenen Verzahnung von Parallel- und Kontrastmotiven – gegenüber derart formalen Unzulänglichkeiten (strukturell) unleugbare Fortschritte erbracht, die eigentliche ‚Rehabilitation' und Selbstbestätigung sollte dem Künstler K. freilich erst mit jenen „Sinngedicht“-Novellen „von vollendeter Klassizität …, … strengem Seelenadel … [und] endloser Grazie …“ gelingen. Letzter und zugleich vollkommenster unter all seinen Erzählzyklen, kommt „Das Sinngedicht“ nicht nur in diesem Belang einem ästhetischen Vermächtnis gleich: Was den Rahmen angeht, der hier wie anderswo dämpfend-ausfilternde Wirkung zeitigt der je andrängenden Wirklichkeit gegenüber, die Dünnhäutigkeit des K.schen Naturells demonstrierend; in poetologischer Hinsicht Veranschaulichung der These, wonach nicht das einzelne schön genannt werden darf, sondern allenfalls das Ganze, die organische Einheit, das harmonische – der Natur abgesehene – Miteinander der Teile; zuletzt und ganz allgemein in der Weise, daß Kompensation verantwortlich zeichnet für die durchgängige (bereits in der frühen Lyrik erkennbare) Nutzung des zyklischen Prinzips, und dies gleich in doppelter Hinsicht, insofern dem bloß Episodischen zu den Zügen formaler Geschlossenheit gehaltlich (die Lebensläufe betreffend) die Kriterien des Dauerhaften abgehen. Mögen die K.schen Zyklen ihrer Tektonik, ihrem inneren Nexus nach von unterschiedlicher Qualität sein, daß es zwischen 1856 und 1881 keine selbständige Erzählung gibt, die nicht irgendeinem übergeordneten Zusammenhang eingefügt wäre, ist Hinweis|genug, wie sehr alles einzelne nach Meinung des Dichters vorläufig-unzulänglich bleiben muß, wie nötig es, über ästhetische Gesichtspunkte hinaus und essentiell, aus Gründen der Existenzverlängerung, der Ergänzung und des Anschlusses bedarf.
Knapp zehn Jahre zuvor (1872) waren die „Sieben Legenden“ erschienen. Scheinbar das ganz andere bietend, sind sie doch nicht nur der Entstehungszeit nach in der Nähe des 1874 erneuerten „Lalenbuch-genus “ anzusiedeln. Hätte bereits ein Vergleich der beiden Seldwyla-Bände ein Überwiegen des Märchentons für die späteren Erzählungen ergeben, so tritt diese Tendenz in den „Legenden“ erstmals unverhüllt zutage, boten sie K. doch im wesentlichen die Möglichkeit, wie im Märchen Wunder geschehen zu lassen: Wollte er den kirchlichen Jenseitsvertröstungen irdische Verhältnisse konkurrierend zur Seite stellen, asketisch veranlagte Naturen mit der Chance auf Erfolg zu Weltkindern bekehren, so war der Dichter verpflichtet, diese Erde von ihrer schönsten, verlockendsten Seite zu zeigen, in Reichtum, Glanz und Glück. Nirgends fehlt darum die entwirklichende Kraft des Märchens, der Goldgrund, auf den K. eine Zeitlang im Titel anzuspielen erwog. Kein Zufall demnach bei derart meisterlicher Lasierungskunst, wenn gerade diese Sammlung K.s erster großer buchhändlerischer Erfolg wurde, wie man in ihrem Sog nun auch die Seldwyla-Fabeln weniger als Dorfgeschichten à la Auerbach denn als Wirklichkeitsmärchen lesen und, wenn auch verspätet, innerhalb breiterer Publikumskreise schätzen lernte.
Vom ‚edlen Armen' der „Romeo“-Novelle, dessen Irrealität schon Fontane moniert hatte, bis hin zum Helden des „Sinngedichts“, der noch in einer Zeit, da der Schatten Darwins bereits übermächtig zu werden beginnt, daherkommen kann wie ein Prinz, der auszieht, das Küssen zu lernen: stilisierende Tendenzen, wohin man sieht, ziseliertentschärfte Wirklichkeit als Folge jenes „K.-Tons“, dem es – im wesentlichen die Effekte des Verzieilichens mit den Wirkungen uneigentlich-vergleichsweisen Sprechens kombinierend– gelingt, die Einflüsse der Umwelt auf ein erträgliches Maß herabzustimmen, die Gestalten besonders in den ‚Elendspartien' schonungsvoll zu umgeben, um so auch noch aus tiefster Not schöne Menschlichkeit aufscheinen zu lassen – was alles nachhaltige Zweifel wecken muß hinsichtlich der Zeitgemäßheit oder gar Modernität dieses Dichters, Bedenken, die sich in der Folge sehr viel einfacher und zugleich überzeugender widerlegen lassen, als zu erwarten stand: Meldet sich in den „Züricher Novellen“ K.s Spätzeitgefühl, trotz historischer Maske ebenso aktualisiert wie methodisch-konsequent angegangen, zu Wort, so reitet der Dichter im „Sinngedicht“ – den Aspekt des Satirischen für weite Partien unterstellt – eine Attacke gegen die Wissenschaftsgläubigkeit der Zeit; und hatte der Autor schon früher keine Gelegenheit versäumt, die Haltung der Geistlichen ironisch aufs Korn zu nehmen, sie sozusagen doppelt zu verurteilen, indem er ihre Unduldsamkeit der selbstgerechten Hartherzigkeit des Philisters gleichsetzt und dazu aus der Ängstlichkeit eines verunsicherten Konservatismus ableitet, in den „Legenden“ – lange Zeit Bestandteil der „Sinngedicht“-Konzeption – gilt sein Angriff weniger einzelnen ihrer Vertreter als vielmehr der Institution Kirche schlechthin, und dies nicht zufällig just in einem Augenblick zunehmender dogmatischer Verhärtung des Katholizismus zu Beginn der 70er Jahre.
Über derart kasuistische ‚Modernismen' hinaus macht K. immer dann von jener früh beanspruchten Rolle des Poeten als eines Warners und Nothelfers Gebrauch, wenn er kollektive Bedrängnisse oder gar Atavismen heraufziehen sieht. Sie sind, auch für die Schweiz, mindestens seit den späten 60er Jahren nicht mehr zu leugnen, mit dem Effekt, daß das Prinzip „Reichsunmittelbarkeit“ zwar nicht aufgehoben, wohl aber bereits erkennbar gelockert erscheint für die Erzählungen des 2. Seldwyla-Bandes, darin – zugleich mit der Forcierung des K.-Tons – satirische Ausfälle häufiger werden gegen die zunehmenden Laster der Zeit, die Unsitte des Spekulantentums etwa oder Mißstände im Erziehungswesen, während politischer Pamphletismus wie reformtheologische Umtriebe den Zeitgenossen K. veranlassen, sein als Märchen-Zyklus begonnenes Unternehmen mit dem bekannt „ernsteren Kultur- und Gesellschaftsbilde“ des „Verlornen Lachens“ abzuschließen.
Als gerade Fortsetzung dieser Tendenzen ist K.s letztes Werk, der „Martin Salander“ von 1886 aufzufassen, mit dem der Dichter erneut, und diesmal konsequenter als je zuvor modern, ja aktuell ist, einen Zeitroman, mehr noch ein zeitkritisches Buch schreibt, das, um sozialem Mißbehagen wie den verderblichen Begleiterscheinungen „moderner materieller Betriebsamkeit“ Einhalt zu gebieten, noch einmal „ein politisches Spiegelbild der öffentlichen Zustände in … [seiner] engeren Heimat zu entwerfen“ sucht, wobei der „moralische“ Schauplatz „sich nicht nur über|den Kanton Zürich“ erstreckt, „sondern ziemlich auf die ganze Schweiz … “. In dem Augenblick aber, da er sich des reichsunmittelbaren Genres, das heißt der zweckfreien Kunst begibt und „Eisenbahnmisere“ beschreibt, ist er gezwungen, so starken satirischen Tabak zu rauchen, daß der gewohnte (Märchen-) Glanz auf allem alsbald erlischt. Am Ende behauptet Satire das Feld, nicht ‚schöne' Kunst, aber auch nicht realistische. K. weiß um diese Einseitigkeit, und er weiß auch, daß er sich damit in die Reihe derer stellt, die er bisher verlacht oder verachtet hatte, der Verfallspropheten nämlich von der naturalistischen Observanz. Was er an ihnen vermißte, die „Charis, die Sonnenwärme“, beides fehlt ihm nun selbst; ein Umstand, dem man am ehesten entnehmen kann, an welche Bedingungen – die des Märchens – Glanz und Glück im Werk dieses Dichters geknüpft sind. Fehlen sie, bleibt nichts als Bitternis zurück – und die Satire als Großform.
Mensch und Werk: Das Werk als Spiegel der Persönlichkeit
K.s Vita will auf den ersten Blick nicht sonderlich interessant erscheinen: Weder gehört er zu den notorisch Wandernden oder gar Umgetriebenen, noch läßt sich von der – in manchen Phasen eher ‚retardiert' anmutenden – inneren Entwicklung behaupten, sie trage spektakulär ‚dramatische' Züge. Sieht man von gelegentlichen Besonderheiten des Sozialstatus ab, dann ergibt die Summierung biographischer Details das Bild einer im letzten bürgerlichen Normen verpflichteten Existenz, freilich einer solchen mit changierenden Randzonen, denen selbst psychoanalytische Zudringlichkeit (Hitschmann) bislang keine eindeutige Bestimmung hat zuweisen können; mit der Folge, daß der Mensch K. auch und gerade da, wo alle Fakten zur Hand sind, Material und Daten hinreichend vorliegen, sich dem Betrachter noch immer als ein „offenbar Geheimnis“ darbietet.
Wenn K., der nur ein Glück, das in Frauenarmen, gelten lassen wollte, dies an sich selbst niemals erfuhr, dann doch wohl, weil die Natur ihn benachteiligt hatte mit einem Untermaß, das, verbunden mit einer Disproportion der Teile – imposantem Haupt auf normalem Rumpf bei unzulänglich entwickelten Beinen – jedem andern als freundschaftlich gesinnten Auge den Eindruck mißgestalteter Verwachsenheit vermitteln mußte, in den zarter Empfindenden überdies ein Gefühl des hilfsbedürftig Hinfälligen, regelrechter „Angst um sein Fortkommen“ aufsteigen ließ. Luise Rieter hat als erste – immerhin im Tone des Bedauerns – auf seine „sehr kleine[n], kurze[n] Beine“ verwiesen; und noch von seiten Marie Exners, die ihn unter allen weiblichen Wesen am besten gekannt haben dürfte, ist die Ansicht (Brief an Karl Dilthey) überliefert, wonach K.s Schicksal sich bei höherem Wuchs gewiß anders gestaltet hätte. Man muß nicht alles auf den „Zwerg“ (W. Muschg) zurückführen wollen, aber es waren außer den kältend-distanzierenden Eisesregionen seines Genies (Weber) auch und ebensosehr physische Unzuträglichkeiten, die einer glückhaften Zweisamkeit dieses Dichters hindernd im Wege standen. Welche Rückwirkungen dies auf sein Selbstgefühl haben mußte, läßt sich an K.s kläglichen Auftritten als Liebhaber ablesen: Während er sich Marie Melos gegenüber gar nicht erst zu erklären wagte, darf man den Werbebrief an Luise Rieter den rührend-kuriosesten Liebesepisteln deutscher Sprache zuzählen, da doch sein Inhalt in nichts anderem zu bestehen scheint, als der geliebten Person das so gefürchtete wie als unausbleiblich empfundene Nein in der zartfühlendsten Weise erleichtern zu helfen. Nimmt man die grenzenlose Ernüchterung des Heidelberger ‚Landolt'-Erlebnisses – Johanna Kapp, von der er sich verstanden, ja geliebt glaubt, deren Gefühle indes weniger ihm als einem Dritten, noch dazu ausgerechnet (und nicht minder hoffnungslos) seinem Lehrer →Feuerbach galten! – wie die Berliner Seelennötez um Betty Tendering hinzu, dann wird das Ausmaß zwischenmenschlicher Misere offenkundig, der K. jahrzehntelang ausgesetzt war: „Ein Herz allein gilt heute nichts mehr“; schon 1847 dem „Traumbuch“ anvertraut, sollte dieser fatalistische Stoßseufzer sich über die eigentliche Adressalin (L. Rieter) hinaus zum bestimmenden Motto all seiner künftigen ‚Affären' entwickeln.
Zum Liebenden eher geschaffen als zum Liebhaber, läßt K. des weiteren kein besonderes Freundschaftstalent erkennen. Sicher war die Zeit empfindsam überschwenglicher Freundschaftsbezeigungen vorbei – Art und Ende der Beziehung zu Johann Müller mit Aufdeckung der plagiatorischen Seelenergüsse des Partners mag bezeichnend dafür stehen –, aber es gibt darüber hinaus ein Wort K.s an Johanna Kapp, wonach Freundschaft ihm zu keiner Zeit sonderlich viel bedeutet habe, also etwa ausgleichend für das Defizit an fraulicher Zuwendung hätte aufkommen können. In der Tat muß die (trotz aller Bekanntschaften) nicht minder lange Liste gegenseitiger ‚Verfehlungen'|zu denken geben: Fontane, Storm, Heyse, Geibel …, sie alle hätte K. allein in Berlin kennenlernen können; er hat sie ebenso, wenn auch weniger offensichtlich, zu ‚umgehen' gewußt wie im heimatlichen Zürich C. F. Meyer, dessen Zeitgefühl und Menschenbild dem seinen nun freilich zu verschieden war, als daß es – zumal mit einem Drechsler ohne „rechte Seele“ – zu annähernd herzlichem Einvernehmen hätte kommen können. Wenn sich manch versäumte Begegnung später, sei es direkt (Heyse), sei es brieflich (Storm) hat nachholen lassen, so bleibt bezeichnend, daß die Initiative dazu fast durchweg vom andern ausgehen mußte, während derartige Korrespondenzen, einmal in Gang gebracht, von seiten K.s lang und gern im Rahmen des Förmlichen wie in den Bahnen sachlich-fachlicher Diskussion gehalten und von daher jederzeit so abrupt (ausbleibende Briefe an Storm seit 1886 bis zu dessen Tode) wie ohne erkennbaren Grund abgebrochen werden konnten.
K. mithin in der Rolle des schwierig Einsamen, und an diesem Syndrom leidend, wie sehr, lassen Wirtshauslauferei wie aus solch eher anti-gesellig denn vergnüglich anmutenden Schweigeritualen erwachsende ‚Turbulenzen' erahnen. Trink- und Rauflust – was sie über lediglich persönliche Lizenzen hinaus in psycho-pathologischer Hinsicht relevant macht, ist neben dem notorisch Zwanghaften – als die Mutter 1864 plötzlich stirbt, ist der ansonsten mustergültig korrekte Staatsschreiber unvorbereitet-abwesend, will sagen: er sitzt im Wirtshaus; seinen politischen Gegnern ist es wenig später (1866) ein leichtes, die hypersensible Verlobte (Luise Scheidegger) mit Hilfe gezielter Indiskretionen von seiner Seite weg in Verzweiflung und Tod zu treiben – der existentielle Ernst derart handgreiflich geführter Auseinandersetzungen. Wo immer in K.s Dichtungen zwei Menschen mit bloßen Fäusten aufeinander losgehen, geschieht dies in Augenblicken höchster Verzweiflung wie aus der erklärten Absicht heraus, das Gegenüber zu vernichten. (Rück-) Übertragen auf nichtfiktionale Ebene, steht zu vermuten, daß K.s berüchtigte Raufereien ihren Ursprung nicht anders als bei seinen Helden anfangs in materieller Bedrängnis, später mehr und mehr in den seelischen Nöten der Vereinsamung hatten. Versuche der Betäubung also wie Gelegenheit, seelischen Überdruck abzulassen, dazwischen ein Sich-Ausschweigen als Verstummen über Abgründen, den nämlichen Klüften, die sich im Werk auftun und alsdann eine Fülle derb-schwankhafter Szenen zutage fördern, jene „Schnurren“ und ‚Batzen', die ihm „fast unwiderstehlich aufstoßen“ als Reaktion auf gravierende menschliche Defekte (Unnatur, Unmenschlichlichkeit) und – ungeachtet aller kopfschüttelnden Proteste von Seiten zeitgenössischer Leserschaft – „wie unbewegliche erratische Blöcke in … [seinem] Felde liegen bleiben“, ohne daß es ihm später möglich wäre, sie zu tilgen.
Dennoch gibt es, inmitten eines Meers von Einsamkeit, Inseln der Freundschaft in diesem Leben, wobei die Partner wie zu Anfang (Salomon Hegi) so in der Spätzeit (→Arnold Böcklin 1885 folgende) der Malerbranche entstammen. Zwischenein wäre, stellvertretend für viele, an den Musiker Baumgartner oder den Literaten Hettner zu erinnern, vor allem jedoch der ‚Exnerei' Erwähnung zu tun, das heißt jener zunächst kordialen Verbindung mit dem zeitweilig in Zürich lehrenden österreichischen Juristen →Adolf Exner, die von K.s 50. Geburtstag her datiert und bei Gelegenheit des Besuchs von Exners Schwester (1872) aufs schönste komplettiert und gekrönt wird durch die Freundschaftsliebe zu Marie. Wer den ganz ‚andern', den noch einmal reiselustigen, Fahrten ins Salzburgische (1873) und nach Wien (1874) nicht scheuenden K. kennenlernen will, erleben möchte, wie weit dieser Mensch über alles bedrücklich ‚Gramspelunkige' hinaus freudiger, ja selbst übermütiger Stimmungen fähig sein kann, muß die Korrespondenz mit den Geschwistern Exner gelesen haben, Widerspiegelung eines Herzensbundes, der vielleicht stellvertretend stehen darf für jene – soll man sagen – einzig glücklichen 70er Jahre zwischen Liebesleid und Verlobungsgram wie dem kältenden Mißtrauen vermehrter Alterseinsamkeit.
Es sind die zuletzt erwähnten Beziehungen, die am ehesten geeignet erscheinen, den sich aufdrängenden Aspekt des Tragischen herabzustimmen zugunsten jener „stille[n] Grundtrauer“, wie sie eigner Aussage zufolge als das eigentlich signifikante Merkmal über diesem Leben liegt. Jede fernere Abmilderung freilich käme bereits einem Zugeständnis an Klischee und Legende gleich, die Behauptung vom ‚ewigen Seldwylertum' mit seinen vielfältigen Assoziationen (Humor, carpe diem-Pose, ‚Meister Gottfried' im Biedermeierkostüm …) nicht minder denn die Stilisierung ins spitzweghaft Abseitige, Verkauzte als der (erwünschten) Möglichkeit, weniger angenehme Wahrheiten auf bequeme Weise hinter einem Schwall von heiter Anekdotischem verschwinden zu lassen.
Ein statt dessen nicht länger bewußt harmonisierendes, wohl aber vertieftes Psychogramm des Menschen K. sollte Responsionen zeitigen hinsichtlich des Werkverständnisses, muß zuletzt die Frage provozieren, wie denn diese Dichtung nun eigentlich zu lesen sei. Bei welcher Gelegenheit sich ergibt, daß gerade das bislang scheinbar Gesichertste und Selbstverständlichste fragwürdig zu werden beginnt. Denn wie man sich den Blick auf manche K.-Texte durch nichts sosehr verstellen kann wie durch die (zuletzt) unreflektierte Annahme vom Humoristen kat exochen, so wird das Verständnis der Prosaschriften insgesamt nicht unbedingt erleichtert, solange die Rezipienten in dem Verfasser weiterhin einen notorischen Realisten zu sehen gewillt sind. Im Gegenteil spricht manches dafür, daß er gerade dies am allerwenigsten ist: zu dem Umstand, daß die vielstrapazierte Formel vom „goldnen Überfluß der Welt“ lediglich für den Naturrahmen Gültigkeit besitzt, nicht aber den weiten Bereich des Sozialen erfaßt, die Mühe, die der Dichter häufig genug hat, zu positiven Erzählschlüssen zu gelangen; zuletzt (und nicht minder sprechend) der umgekehrt zu beobachtende Wechsel zwischen Lakonie („Hadlaub“) und ironisierender Relativierung endlich erreichtem, bürgerlichem Glück gegenüber („Kleider machen Leute“). Wo Biographik längst den Finger auf die Risse und Schründe des herkömmlichen K.-Porträts gelegt hat, wird sich der Glanz, der über allem dichterischen Schaffen liegen soll, Eintrübungen gefallen lassen müssen. Nur so, mit Hilfe namentlich des Versuchs, Art und Umfang der dahinter vermuteten Wirklichkeitsstörung zu präzisieren wie ihre Ursachen zu ergründen, dürfte die gegenwärtig noch zu beobachtende Beziehungslosigkeit der Interpretation von Leben und Werk zu überwinden sein, die zentrale These vom zu entidyllisierenden Werk als eines Spiegels der in ihren Widersprüchen bejahten Persönlichkeit auf angemessenem Niveau erneut überzeugend vertreten werden können.
Bliebe nachzutragen, daß mit der Suspendierung des Realismus-Etiketts keinerlei ästhetische (Ab-)Wertung verbunden, im Gegenteil die Hoffnung verknüpft wäre, dem eigentümlich ‚K.schen', der spezifischen Eigenart seines Werks gerade von dieser ‚Schwachstelle' und ihrer künstlerischen Bewältigung her erkenntnismäßig näherzukommen. Als der Dichter 1890 stirbt – er hat die Fertigstellung der Gesamtausgabe noch erlebt –, liegt ein Werk vor, das Bewunderung verdient und Zweifel allenfalls aufkommen läßt hinsichtlich des lyrischen Parts. Man muß nicht unbedingt der Meinung jenes misanthropischen Rezensenten sein und die Gedichte für „Magenbitter“ erklären, aber im Unterschied zu den apologetischen Kraftakten Fränkels (und mancher Nachfolger) wird man es doch eher mit dem Autor selbst halten dürfen, der im Hinblick auf die „Gesammelten Gedichte“ (1883) von (s)einem „metrischen Heuschober“ gesprochen hat – in dem nun freilich wiederum Perlen zu finden sind, wenn auch oft nur nach Strophen oder gar Versen bemessen, der ästhetische Genuß dazu von der Mühsal des Stecknadelsuchens im Heuhaufen getrübt. Nicht so im epischen Bereich, für den andere Normen gelten: Wo immer man dort die Sonde ansetzt, zumal an der mittleren Schicht zwischen Ideen und Physiognomik des Sprachlichen, mithin den Stoff befragt, aus dem die dichterischen Träume gewebt sind, geht – Teil des ‚Kunstcharakters' – die motivlichthematische Einheit dieses Werks auf überwältigend eindrucksvolle Weise hervor: Wenn Vergänglichkeit der Stachel ist, der es provozierend hervorrief, dann ist Dauer – Kompensation der mit Verabschiedung des Metaphysischen unvermeidlichen Existenzverkürzung – sein (bereits seit den Tagen der frühen Lyrik) immer wieder erneuertes Thema. Im wesentlichen kennt K. drei Wege, dem ersehnten Ziel dauerhafter Existenz näherzukommen: Der Reichtum wohlbestellter Häuser vermag materielle Geborgenheit zu verschaffen, ein persönliches Sicherheitsgefühl, in seinen Kindern kann man physisch überdauern – darum das „Lob des Herkommens“ zu Beginn des „Grünen Heinrich“, während den Novellen („Frau Regula“) am Ende selten der Hinweis fehlt auf die zahlreich blühende Nachkommenschaft –, das eigentlich Bestand Verbürgende aber ist im Bereich des Ethischen gelegen, das alles Überdauernde heißt: Treue des Herzens. Von diesem zentralen Aspekt (des Überdauerns) her – Entwicklungsziel schon des „Grünen Heinrich“; funktionsbestimmendes Element ebenso des Seldwyla-Rahmens mit dem Chor der Falliten als Negativfolie, von der die Hauptakteure sich in mehr oder minder positiv-durabler Hinsicht abheben – wird auch klar, weshalb die meisten der K.schen Erzählungen Liebesgeschichten sind: Mit der Wahl des rechten Partners bietet sich die Möglichkeit, den Besitz zu mehren, eine Familie zu gründen wie die Chance, an der Seite einer treusorgenden Frau und Mutter zu dauerhaftem Glück zu finden.
Liebesgeschichten (noch dazu ohne jede Erotik) als Thema – gerade das macht einen Teil der Schwierigkeiten aus, die zumindest der jüngere Leser heutzutage mit ‚seinem' K. erlebt. Schon Fontane hat auf eben diesen Umstand des (thematisch) Gehabten verwiesen, wenn er, indirekt zwar und dazu metaphorisch verbrämt, K.s Dichtung als „einen vorzüglichen Wein“ rühmt, dem nur leider das Manko anhafte, daß die Gegend, aus der er stamme, vertraut, der „Berg“, darauf die Reben gewachsen, (auf altmodische Weise) bekannt und „längst vorher“ dagewesen sei. Abgesehen von der Frage, ob das Kriterium des stofflich Neuen hier nicht in historisch unzulässiger Weise verabsolutiert wird – immerhin ist die Epoche des Sturm und Drang mit ihrer Forderung nach dem unverwechselbar Neuartigen als dem Kennzeichen des Genies lange vorbei –, scheint des weiteren übersehen zu werden, daß K. bewußt weder neu sein will noch faktisch dazu imstande wäre, sich vielmehr – Angehöriger jenes erwähnten „Zwischenreichs“ – darauf beschränkt, „das ihm Zunächstliegende [zu] ergreifen und … gerade [diese] seine Lage in schöner Form dar[zu]stellen …“.
Wer sich dennoch ernsthaft auf K.s Werk einzulassen bereit ist, wird mit Hofmannsthal bestätigt finden, daß seine Bücher „ihre schönste Wirkung … gar nicht in den Kopf ausstrahlen, sondern wirklich direkt ins Blut, so daß sie einem im Leben weiterhelfen und das Nächste leichter machen,“ jene schwierige Kunst zum Beispiel, seines Glückes Schmied zu werden, verbunden freilich mit der Belehrung, daß Glück kein einklagbarer Anspruch ist; aber ebenso dahingehend instruiert, wie man, einmal zu kurz gekommen in dieser Hinsicht, dennoch weiterleben kann, ohne zu verzweifeln. Natürlichkeit, Geradsinn, Tüchtigkeit …, und als Lohn dafür Treue von Partnerseite, wen dieser Wertekanon nicht bloß nicht eben neu, sondern obendrein ausgesprochen ‚bürgerlich' bedünken will, dem ist nicht viel mehr entgegenzuhalten als das nach Meinung des Autors überklassenmäßig ubiquitär Praktizierbare solcher Gesinnungen, die ihre ungebrochene Aktualität und bleibend appellative Wirkung paradoxerweise gerade aus dem Moment des Zeitlos-Immerwahren beziehen. – Wer schließlich über die gehaltliche Seite hinaus noch anderes gelten läßt in bezug auf poetische Texte, der wird dies alles vorgetragen finden in einem Sprachstil von solcher Dichtigkeit und ‚Richtigkeit', daß man kein Wort anders hören oder gar missen möchte; ein Erlebnis, dessen man im deutschen Sprachraum des 19. Jahrhunderts allenfalls im Umgang mit Goethe oder eben – Fontane teilhaftig wird. Wenn man zu gewichten hätte zwischen Fontanes kritischer Malice und der Huldigungsadresse von Seiten Carl Spittelers, müßte die Waagschale sich demnach – den Rezensenten Fontane in Ehren – der Spittelerschen Sentenz (von 1899) zuneigen, nach der K. gar nicht überschätzt werden kann.
-
Werke
Gesammelte Werke, 10 Bde., 1889 (1. Gesamtausg., d. K. noch selbst mitbetreut hat);
Werke, Krit. hist. u. erl. Ausg., hrsg. v. M. Nußberger, 8 Bde., 1921;
Sämtl. Werke, Auf Grund d. Nachlasses besorgte u. mit e. wiss. Anhang versehene [krit.] Ausg., hrsg. v. J. Fränkel (17 Bde.), 1926 ff., später hrsg. v. C. Helbung (7 Bde.), 1943/44-49 (dazu: J. Fränkel, G. K.-Philol., in: J. Fränkel, Dichtung u. Wiss., 1954, S. 96-194;
H. Zeller, Textwahl f. d. Datenverarbeitung, Der Wortindex z. Werken G. K.s u. d. K.-Ausg., in: Euphorion 66, 1972, S. 383-96);
Sämtl. Werke [P. Goldammer], 8 Bde., 1958;
Sämtl. Werke u. ausgew. Briefe, hrsg. v. Cl. Heselhaus, 3 Bde., 1956–58, ²1963;
Ausgew. Gedichte, hrsg. v. W. Muschg, 1956. - Briefe:
Gesammelte Briefe, 4 Bde., hrsg. v. C. Helbling, 1950-54. | -
Nachlass
Nachlaß: Zürich, Zentralbibl.; Weimar, Goethe- u. Schiller-Archiv; Marbach, Schiller-Nat.mus., Cotta-Archiv.
-
Literatur
ADB 51 (Geßler);
Ch. C. Zippermann, G. K.-Bibliogr. 1844-1934, 1935. - Forschungsberr.:
W. Preisendanz, Die K.-Forschung d. J. 1939–57, in: German.-Roman. Mschr. NF 8, 1958, S. 144-78;
F. Martini, Forschungsber. z. dt. Lit. in d. Zeit d. Realismus, 1962, S. 43-56;
B. u. C. Kahrmann, Forschungsber. Bürgerl. Realismus, in: Wirkendes Wort 23, 1973, S. 59-64. - Biogrr.:
B. Breitenbruch, G. K. in Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten, 1968 (W, L, P);
H. Boeschenstein, G. K., 1969 (W, L);
E. Ermatinger, G. K.s Leben, Mit Benutzung v. J. Baechtolds Biogr. dargest., 1915 f., ⁸1950 (W, L, P);
W. Weber, Freundschaften G. K.s, Versuch üb. d. Einsamkeit e. Genies, 1952 (L, P);
W. Muschg, Umriß e. G.-K.-Porträts, Der Zwerg, Das Vaterland, in: ders., Gestalten u. Figuren, 1968, S. 148-208;
M. Rychner, in: Die Gr. Deutschen III, 1956, S. 364-75 (P);
W. Preisendanz, in: Dt. Dichter d. 19. Jh., hrsg. v. B. v. Wiese, 1969, S. 440-62;
A. Frey, Erinnerungen an G. K., 1892;
A. Zäch, G. K. im Spiegel s. Zeit, 1952;
- G. K. (= Dichter üb. ihre Dichtungen), hrsg. v. K. Jeziorkowski, 1969. -
E. Hitschmann, G. K., Psychoanalyse d. Dichters, s. Gestalten u. Motive, 1919;
P. Schaffner, G. K. als Maler, 1923 (P);
W. Benjamin, G. K., Zu Ehren e. krit. Gesamtausg. s. Werke, in: Die literar. Welt v. 5.8.1927, wieder in: ders., Schrr. II, 1955, S. 284-96;
G. Lukács, G. K. (1939), in: ders., Dt. Realisten d. 19. Jh., 1951, S. 147-230;
E. Staiger, Die ruhende Zeit, in: ders., Die Zeit als Einbildungskraft d. Dichters, Unterss. zu Gedichten v. Brentano, Goethe u. K., 1939, ²1953, S. 159-210;
A. Henkel, G. K.s „Tanzlegendchen“, in: German.-Roman. Mschr. NF 6, 1956, S. 1-15;
|W. Kayser, Das Groteske, Seine Gestaltung in Malerei u. Dichtung, 1957, ²1960;
J. U. Saxer, G. K.s Bemühungen um d. Theater, 1957;
A. Hauser, G. K., Geburt u. Zerfall d. dichter. Welt, 1959;
M. Merkel-Nipperdey, G. K.s „Martin Salander“, Unterss. z. Struktur d. Zeitromans, 1959;
K. Reichert, Das Problem d. Originals im Zyklus d. „Züricher Novellen“, Diss. Jena 1960 (ungedr.);
ders., Die Zeitebenen d. hist. Dichtung, Dargest. am Beispiel e. Interpretation v. G. K.s „Züricher Novellen“, in: DVjS 36, 1962, S. 356-82;
ders., Die Entstehung d. „Züricher Novellen“ v. G. K., in: Zs. f. dt. Philol. 82, 1963, S. 471-500;
ders., Die Entstehung d. „Sieben Legenden“ v. G. K., in: Euphorion 57, 1963, S. 97-131;
ders., G. K.s „Sinngedicht“, Entstehung u. Struktur, in: German.-Roman. Mschr. NF 14, 1964, S. 77-101;
H. Richter, G. K.s frühe Novellen, 1960, ²1966;
W. Preisendanz, Humor als dichter. Einbildungskraft, Stud. z. Erzählkunst d. poet. Realismus, 1963, S. 143-213, ²1976;
ders., G. K.s „Sinngedicht“, in: Zs. f. dt. Philol. 82, 1963, S. 129-51;
ders., G. K., „Der grüne Heinrich“, in: Der dt. Roman II, hrsg. v. B. v. Wiese, 1963, S. 76-127;
R. Wildbolz, G. K.s Menschenbild, 1964. -
H. Laufhütte, Wirklichkeit u. Kunst in G. K.s Roman „Der grüne Heinrich“, 1969;
ders., Datierungskriterien, Nachforschungen u. Überlegungen zu e. Blatt aus d. hs. Nachlaß v. G. K., in: DVjS 47, 1973, S. 324-60;
H. Anton, Mytholog. Erotik in K.s „Sieben Legenden“ u. im „Sinngedicht“, 1970;
R. Luck, G. K. als Lit.kritiker, 1970;
F. Martini, Iron. Realismus: K., Raabe u. Fontane, in: Ironie u. Dichtung, hrsg. v. A. Schaefer, 1970, S. 126 ff.;
R. Würgau, Der Naturbegriff im Werk G. K.s, Diss. Tübingen 1970;
B. Hillebrand, Mensch u. Raum im Roman, Stud. zu K., Stifter, Fontane, 1971, S. 107-71;
ders., Der Garten d. „Grünen Heinrich“, in: DVjS 45, 1971, S. 567-82;
H. D. Irmscher, Konfiguration u. Spiegelung in G. K.s Erzz., in: Euphorion 65, 1971, S. 319-33;
K. Jeziorkowski, „Eine Art Statistik d. poet. Stoffes“, Zu einigen Themen G. K.s, in: DVjS 45, 1971, S. 547-66;
G. Kaiser, Sündenfall, Paradies u. himml. Jerusalem in K.s „Romeo u. Julia auf d. Dorfe“, in: Euphorion 65, 1971, S. 21-48;
L. Löwenthal, G. K. -
d. bürgerl. Regression, in: ders., Erzählkunst u. Ges., 1971, S. 206-25;
K. Wenger, G. K.s Auseinandersetzung mit d. Christentum, 1971;
C. Winter, G. K., 1971;
K. Kehr, G. K., 1972;
K. T. Locher, G. K.s „Der Apotheker v. Chamounix“, Versuch e. Rettung, in: Jb. d. Dt. Schillerges. 16, 1972, S. 483-515;
I. Mittenzwei, Dichtungstheoret. Äußerungen G. K.s u. C. F. Meyers, in: Btrr. z. Theorie d. Künste im 19. Jh. 2, 1972, S. 175-95;
H. Richartz, Lit.kritik als Ges.kritik, Darst.weise u. pol.-didakt. Intention in G. K.s Erzählkunst, 1975;
K. D. Müller, Die „Dialektik d. Kulturbewegung“, Hegels romantheoret. Grundsätze u. K.s „Grüner Heinrich“, in: Poetica 8, 1976, S. 300-20;
J. Rothenberg, G. K., Symbolgehalt u. Realitätserfassung s. Erz., 1976;
ders., G. K.s „Die kleine Passion“, Zur Darst. d. Todes im Werk d. Dichters, in: Jb. d. Dt. Schillerges. 19, 1975, S. 208-36;
ders., Geheimnisvoll schöne Welt, Zu G. K.s „Sinngedicht“ als antidarwinist. Streitschr., in: Zs. f. dt. Philol. 95, 1976, S. 255-90;
ders., „Der Landvogt v. Greifensee“, Zum Problem d. Epigonischen im Werk G. K.s, in: Sprachkunst, Internat. Btrr. z. Lit.-wiss. 7, 1976, S. 213-46;
G. Sautermeister, G. K. -
Kritik u. Apol. d. Privateigentums, Möglichkeiten u. Schranken liberaler Intelligenz, in: Positionen d. literar. Intelligenz zw. bürgert. Reaktion u. Imperialismus, hrsg. v. G. Mattenklott u. K. R. Scherpe, 1973, S. 39-102;
ders., Erziehung u. Ges. in G. K.s Novelle „Kleider machen Leute“, in: Lesen 2, Der alte Kanon neu, Zur Revision d. literar. Kanons in Wiss. u. Unterricht, hrsg. v. W. Raitz u. E. Schütz, 1976, S. 176-207;
H. Meier, G. K.s „Grüner Heinrich“, Betrachtungen z. Roman d. poet. Realismus, 1977. -
Jberr. d. G. K.-Ges., 1932 ff. - Zur Geneal.:
O. Schlaginhaufen, G. K.s Ahnen- u. Sippschaftstafel, in: Archiv d. J. Klaus-Stiftung 4, 1929;
C. v. Behr-Pinnow, Die Vererbung b. G. K., ebd. 10, 1935;
K. Garnier, G. K.s Vorfahren, 1942;
- A. Muschg, G. K., 1977. - Zu V Joh. Rudolf:
R. Stadelmann u. W. Fischer, Die Bildungswelt d. dt. Handwerkers um 1800, 1955, S. 154-58. -
Porträts
Zeichnung v. J. S. Hegi, 1840 (Zürich, Zentralbibl.), Abb. in: K., Bilder aus s. Leben, ³1970;
Radierung v. K. Stauffer-Bern, 1887 (ebd.), Abb. ebd. -
Autor/in
Jürgen Rothenberg -
Zitierweise
Rothenberg, Jürgen, "Keller, Gottfried" in: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), S. 437-455 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd11856109X.html#ndbcontent
-
Keller , Gottfried
-
Biographie
Keller *)Zu S. 108.: Gottfried K., schweizerischer Dichter, von Glattfelden (Kanton Zürich), geboren in Zürich am 19. Juli 1819 (im Hause „zum goldenen Winkel“, jetzt Neumarkt Nr. 27), war das zweite Kind des aus Glattfelden stammenden Drechslers Hans Rud. Keller (1791—1824) und dessen Gattin Elisabeth Scheuchzer (1787—1864). Der Vater war nicht nur ein geschickter Handwerker, sondern ein eifriger, für den politischen Fortschritt des Schweizerlandes und für das Wohl seiner Mitbürger ernstlich besorgter Mann, nicht ohne poetische Anlagen. Die Mutter, eine schlichtere Natur, war trotz ihrem nüchtern praktischen Sinne ebenfalls nicht ohne Gefühl für Poesie. Im Sommer 1817 waren die jungen Eheleute nach Zürich gezogen; Geschäft und Haushalt begannen zu blühen. Da starb (1824) der Vater, und die Wittwe stand mit dem fünfjährigen Gottfried und der 1822 geborenen Regula allein in der Dürftigkeit, aus der sie sich mit ihrem Manne eben herausgearbeitet hatte. K. hat seinen Vater nie vergessen. Ganz eng aber schloß er sich nun an die Mutter an; Mutter und Sohn sind auch später ein innig gepflegtes Lieblingsthema des Dichters gewesen. Die Jugend Keller's ist aus dem „Grünen Heinrich" bekannt: es sei in diesem Roman, sagt er in dem Aufsatz „Autobiographisches" ("Nachgelassene Schriften und Dichtungen" S. 20) „die eigentliche Kindheit, sogar das Anekdotische darin, so gut wie wahr". Diese Jugend war, trotz äußerer Beschränkung und Dürftigkeit, im Ganzen eine heitere, so daß der etwas verschlossene, zum Trotz neigende, innerlich aber sehr regsame Knabe nicht unter dem Drucke der kleinen Verhältnisse zu leiden hatte. Mit sechs Jahren kam er in die Armenschule „zum Brunnenthurm"; seine Erlebnisse dort ("Meierlein" u. s. w.) sind im „Grünen Heinrich" geschildert. Auf dem Dachboden eines befreundeten Hauses fand er das Bild des „Meretlein's"; auch „Frau Margreth“ und „Vater Jakoblein“ sind Figuren aus Keller's Jugendbekanntschaft: Jakob Bächtold hat diesen ganzen Kreis in seiner Keller-Biographie (Bd. I, S. 16 ff.) genau beschrieben. Von 1831—1833 besuchte K. als Sohn eines Niedergelassenen das „Landknabeninstitut“. Aus dieser Zeit stammen kindliche, aber bereits Talent verrathende Zeichnungen Keller's, ferner Entwürfe zu kleinen Dramen, über die er selbst im Aufsatz „Autobiographisches“ (a. a. O. S. 14 ff.) berichtet. Im Frühjahr 1833 trat K. in die Zürcher „Industrieschule“ über. Er war ein fleißiger Schüler, daneben zu Possen geneigt, aber kaum mehr als Andere. Durch eine Verknüpfung unglücklicher Umstände (s. darüber Bächtold I, S. 37 ff.) wurde er jedoch im Juli 1834 aus der Schule gewiesen; er hat diese ungerechte Relegation oder, wie er zu sagen pflegte, die Schuld an seinem „verhunzten“ Bildungsgang den Schulbehörden nie verziehen. Er wurde dadurch schon in der Jugend ein Einsamer, und sein strenges, knorriges, wortkarges Wesen konnte sich besonders deutlich ausbilden. Er streifte nun, von der etwas zu nachsichtigen Mutter nicht gehindert, in Feld und Wald umher und hielt sich mit besonderem Vergnügen beim Bruder seiner Mutter, dem Arzt Joh. Heinr. Scheuchzer (1786 bis 1856) (dem Oheim Pfarrer des „Grünen Heinrich") und dessen Frau|Regula, geb. Frey (dem Urbilde der Frau Regel Amrain), auf. Schon vorher hatte er den Entschluß gefaßt, Landschaftsmaler zu werden. Die Mutter erkundigte sich nach einer Lehre und übergab ihn dann einem Peter Steiger (dem „Habersaat“ des „Grünen Heinrich") zur Ausbildung; aber K. lernte dort nichts als eine faustfertige, oberflächliche Manier des Copirens. Er machte sich übrigens bald von dieser Lehre los und richtete sich im elterlichen Hause ein Atelier ein; aber über abenteuerlich romantisirende, dilettantenhafte Compositionen ist er dort nicht hinausgekommen. Zu Weihnachten 1835 wurde K. confirmirt: wie sehr ihn dieses Ereigniß innerlich bewegt hat, ist ebenfalls aus dem „Gr. H.“ (Bd. II, Cap. 11 u. 12) zu ersehen. Im Sommer 1837 kam K. in die Hände eines wirklichen Künstlers: Rudolf Meyer von Regensdorf (des „Römers“ im „Gr. H.“, Bd. III, Cap. II u. V). Auch da copirte der Schüler; aber der Meister hielt ihn auch zum Naturstudium an. Leider wurde Meyer geisteskrank. K. stand also wieder rathlos da. Aus jener Zeit stammt ein Brief des angehenden Malers an Joh. Müller aus Frauenfeld (Bächtold I, S. 62 ff.) mit Schilderungen des eigenen Zustandes, die den künftigen Schriftsteller deutlicher und charakteristischer ahnen lassen als die damaligen Aquarelle den Maler. Sodann sind in jener Zeit schriftliche Darstellungen von Landschaften, nach Keller's Ausdruck „idyllische Naturschilderungen in der Art Jean Paul'scher Traumbilder" entstanden; auch einen „Rückfall“ ins Dramatische constatirt der Aufsatz „Autobiographisches“ (a. a. O. S. 16) für jene Epoche. Neben diesen schriftstellerischen Versuchen und der Arbeit als Maler las K. viel. Dann erfaßte ihn die erste Liebe; die Erwählte hieß Henriette Keller (1818—1838) und war ein lieblich zartes Kind, das 19 jährig in Richtersweil gestorben ist, nachdem K. es als Bewohnerin des Hauses seiner Mutter und als Sommergästchen in Glattfelden kennen gelernt hatte. Auf ihren Tod hat er ein an Heine anklingendes Gedicht gemacht (Bächtold I, S. 81): Henriette ist das zarte Urbild der Anna des „Grünen Heinrich“. Das Lied auf ihr Grab ist, neben zwei noch früher entstandenen Liebesgedichten (Bächtold I, S. 424 ff.), die erste Lyrik Gottfried Keller's. Nach seinem 20. Geburtstage, an dem er seinem Freunde Joh. Müller einen bedeutsamen Brief geschrieben hatte (bei Bächtold I, S. 84 ff.), that K. in seiner Malerlaufbahn einen Schritt vorwärts; er entschloß sich, nach München zu gehen, um dort mit der Malerei von vorn anzufangen. Noch bewegte den von Vaters Erbtheil her für politisch-freiheitliche Bewegungen stets rasch und heftig Entflammten der unter dem Namen „Züriputsch“ bekannte conservative Bauernaufstand gegen die Berufung des Professors D. F. Strauß (6. September 1839) aufs Tiefste; dann reiste er mit geringer Barschaft, etwa dem vierten Theil einer kleinen väterlichen Hinterlassenschaft, nach München. Die Stadt gefiel ihm, nicht so die Bewohner; er hielt sich darum fast nur an die Schweizer Landsleute, speciell an den Zürcher Maler Joh. Salomon Hegi. An der Akademie hätte er kaum aufgenommen werden können; er betrieb deshalb seine Malerausbildung wieder selbst, besuchte etwa das Atelier eines Collegen und studirte in den Museen. Also wieder keine rechte Ausbildung; darum auch in München kein Erfolg. Denn daß er in der Schweizer-Gesellschaft als drolliger Spaßmacher gerne gesehen war und daß er dort litterarische Schnurren verfaßte (s. Bächtold I, S. 427 ff.), das förderte ihn nicht. Dazu trat eine Krankheit (Typhus) und kam, was das Schlimmste war, die Noth. Die Erbsumme war verbraucht; die Mutter konnte neue Mittel nicht schaffen; so zieht sich denn durch die Münchner Briefe an Frau Elisabeth das Thema der Geldverlegenheit in fast endlosen Variationen hin. Die Mutter forderte schließlich den Muthlosen auf, heimzukommen und etwas anderes zu werden;|aber K. blieb, bis er sich genöthigt sah, seinen ganzen Kunstbesitz (Skizzen, Aquarelle, Cartons) mit seiner letzten Habe zum Trödler zu tragen, ja endlich, wie sein „Grüner“, Flaggenstangen blau-weiß anzustreichen (October 1842). Im November endlich verschwand er aus München und kehrte heim: als Maler gescheitert. Und doch war die Münchner Zeit keine vergebliche gewesen: sie hat ihm den Hauptstoff zum „Grünen Heinrich“ geschenkt.
Es folgten nun sechs Jahre in der Heimath (1842—1848); K. hat sie „verlorene“ genannt; sie waren schlimm: er führte ein Einsiedlerleben, war womöglich äußerlich noch rauher als früher. Aber er ist in jener Zeit innerlich zum Dichter gereift. Das geht objectiv aus dem Tagebuch hervor, das er vom 8. Juli bis zum 16. August 1843 geführt hat. Wir erfahren da z. B. von vielartiger Lectüre; namentlich zog ihn Jean Paul magisch an (Bächtold I, S. 209); er versuchte auch wieder zu malen; doch gelangen ihm die Bilder mit Worten besser als mit dem Pinsel. Endlich sprang auch der Quell der Poesie hervor: „Ich habe", heißt es am 11. Juli 1843, „nun einmal großen Drang zum Dichten. Warum sollte ich nicht probiren, was an der Sache ist? Lieber es wissen, als mich vielleicht heimlich immer für ein gewaltiges Genie halten und das andere vernachlässigen". Er berichtet da von einigen Gedichten, die er zur Versendung an eine Zeitschrift zusammengepackt, und von einer Erzählung ("Reisetage"), die er begonnen habe. Sodann trat der Plan eines „traurigen kleinen Romanes“ hervor „über den tragischen Abschluß einer jungen Künstlerlaufbahn, an welcher Mutter und Sohn zu Grunde gingen ... Es schwebte mir das Bild eines elegisch-lyrischen Buches vor mit heiteren Episoden und einem cypressendunkeln Schlusse, wo alles begraben wurde“ (Nachgel. Schr. S. 18). Aber kaum hatte er zu schreiben angefangen, so „gab es unversehens eine klangvolle Störung": es rauschte die Lyrik aus seinem Innern. Zunächst politische Poesie, stark subjectiv, dabei aber in der Form oft an Heine, Lenau, Freiligrath, Herwegh angelehnt. Nur drei von diesen Gedichten sind später in die erste Sammlung Keller’scher Lyrik (1846) aufgenommen worden; eine Auswahl aus dem übrigen 1843 Gedichteten gibt Bächtold (I, S. 432 ff.). Wegen der Herausgabe seiner Gedichte wandte sich K. an Dr. Julius Fröbel, den Begründer des „litterarischen Comptoirs Zürich und Winterthur“, das 1841 Herwegh's „Gedichte eines Lebendigen“ herausgegeben hatte. Fröbel wies ihn an Adolf Ludwig Follen, der damals in Zürich lebte und einem Kreise deutscher Revolutionäre angehörte, den K. sehr hoch schätzte. Fallen fand in den Gedichten „viel lyrisches Feuer, auch Ohr für den Vers", und half sofort bei einer Umarbeitung und Sichtung mit, so daß in den Jahrgängen 1845 und 1846 des beim „litterarischen Comptoir“ herausgegebenen „deutschen Taschenbuches“ die „Lieder eines Autodidakten (Gottfried Keller von Glattfelden bei Zürich)“ herauskommen konnten. Sie wurden an verschiedenen Orten rühmend begrüßt. K. eilte dann als überzeugter Radicaler in die Freischarenzüge des Jahres 1845: revolutionäre Bewegungen, welche im wesentlichen gegen die Jesuiten in Luzern gerichtet waren, mangels genügender Organisation aber gescheitert sind. Erlebnisse aus diesen Zügen hat er später in der prächtigen Novelle „Frau Regel Amrain und ihr Jüngster“ verwerthet, gleich wie er die Siebenmännergesellschaft der Aufrechten, z. Th. Freunden seines Vaters, mit denen er damals in Verkehr trat, in der köstlichsten seiner humoristischen Erzählungen geschildert hat. Zu Anfang 1846 erschienen dann bei Winter in Heidelberg Keller's „Gedichte" als Bändchen von 346 Seiten. Die „Blätter für litterarische Unterhaltung“ meinten dazu: „Wenn irgend Einer, so hat Keller eine Gegenwart, die ihm die Zukunft verbürgt.“ Dieses prophetische Wort begreifen wir jetzt angesichts|der Ursprünglichkeit und Tiefe der Keller’schen Lyrik in seiner vollen Bedeutung. Unter den Vaterlandsliedern findet sich zwar noch manches (nach der ersten politischen Lyrik entstandene) grimmige, blutig höhnende Trutzgedicht, aber auch eine so unvergängliche Perle ist darunter wie „An mein Vaterland“, ein Gedicht, das K. selbst allerdings nie besonders geliebt hat, das aber, trotz der schwierigen Melodie Wilhelm Baumgartner's, eines der volksthümlichsten Schweizerlieder (wenn auch nicht Nationalhymne) geworden ist. Unter den Naturpoesien sodann stehen Gedichte, die dem Besten deutscher Lyrik zugehören; in ihnen klingt kein fremder Ton mehr mit; sie sind Seele Gottfried Keller's, die alle Schönheiten, alle Aufschwünge, alle Wunder der Natur als Offenbarungen empfindet und diese wieder außer sich setzt als Leben gewordene Träume, von denen aber das Traumhafte nicht abgestreift ist. Und dabei welche Kraft und mitnehmende Gewalt der Anschauung in Gedichten wie „Abendlied. An die Natur":
„Hüll' ein mich in die grünen Decken Mit deinem Säuseln lull' mich ein! Bei guter Zeit magst du mich wecken Mit deines Tages jungem Schein. Ich hab' mich müd in dir ergangen, Mein Aug' ist matt von deiner Pracht: Nun ist mein einziges Verlangen, Im Traum zu ruh'n in deiner Nacht.“
oder
„Fahre hinauf, du kristallener Wagen, Klingender Morgen, so frisch und so klar! Seidene Wimpel, vom Oste getragen, Flattre, du rosige Wölkleinschaar!“
Man fühlt in solcher Anschauung aufs angenehmste den Maler, der objectiv beobachtet; aber die gestimmte Seele nimmt diese Anschauung auf, löst sie in Stimmung, macht sie zur Lyrik. Und aus der Naturstimmung heraus wachsen Erhebungen des Ich zu mannhafter Klarheit, zu Entschlüssen wie in Nr. V der „Herbst"-Lieder:
„Es ist ein stiller Regentag, So weich, so ernst und doch so klar, Wo durch den Dämmer brechen mag Die Sonne weiß und sonderbar. „Ein wunderliches Zwielicht spielt Beschaulich über Berg und Thal; Natur, halb warm und halb verkühlt, Sie lächelt noch und weint zumal. „Die Hoffnung, das Verlorensein, Sind, gleicher Stärke, in mir wach; Die Lebenslust, die Todespein Sie ziehn auf meinem Herzen Schach. „Ich aber, mein bewußtes Ich Späht mit des Feldherrnauges Ruh: Und meine Seele rüstet sich Zum Kampfe mit dem Schicksal zu.“
In den „Sonetten" dann so klare Erinnerungsbilder wie „An einen Schulgenossen“, oder so lebendige, bildgewaltige Geistesumwerthungen wie „Reformation“. Hierauf der Cyklus der „27 Liebeslieder": ein zartester, in duftige Lyrik verhüllter Roman. K. hat später (1883) diesen Cyklus grausam umgestaltet, um, wie ihm dies bei der Herausgabe der „Gesammelten Gedichte“ Ideal war, objective epische Ruhe — auch in seiner Lyrik — zu gewinnen. Die schönste Blüte dieser 27 Lieder aber hat er wieder an den Anfang gestellt und hat sie „Jugendgedenken“ genannt; es ist das zauberhaft traumweiche Gedicht:
„Ich will spiegeln mich in jenen Tagen, Die wie Lindenwipfelwehn entflohn.“
Mehr novellistisch-idyllisch ist der Cyklus „Gedanken eines lebendig Begrabenen": vielfach barock, an der Grenze des guten Geschmacks, aber doch von Poesie gesättigt. Aehnlich ist der Cyklus „Feuer-Idylle"; nur tritt hier das Novellistische fast ganz zurück: es ist Idylle mit lyrischem Einschlag, etwa der Art Hebel's zu vergleichen. Auch das thränenfeuchte und doch so wundersam hoffnungsvolle Lied „Bei einer Kindesleiche“ und die ergreifende Dichtung „Am Sarge eines 90jährigen Landmanns vom Zürichsee“ streifen an die Idylle. Von Goethe’scher innerer Größe und äußerer Anschauung, echte, aus dem Leben herausgeschaute Lyrik, sind die zwei Gedichte: „Die Spinnerin"; diese ist eine der größten und tiefsten Frauengestalten des erlesenen Frauenmalers G. Keller. Nach der Herausgabe der Gedichte unternahm K. eine kleine Sommerreise nach Graubünden. Im J. 1847 machte ihn die Liebe zu einer schönen Winterthurerin, Luise Rieter, unglücklich-glücklich; diese Liebe verklärt sein im Herbst 1846 wieder aufgenommenes „Traum- und Tagebuch“ mit dem Zauberdufte reiner Lyrik. In diesem Tagebuch zeigt sich K. auch politisch reifer als früher: sein revolutionäres Freischärlerthum hat sich zu einem ruhigen sachlichen Freisinn gemildert; dies geht auch aus den „Litterarischen Briefen aus der Schweiz“ hervor, die er damals (1847) in die Brockhaus’schen „Blätter für litterarische Unterhaltung“ schrieb (derselben Zeitschrift hat er 1849, 1851, 1852 und 1855 die Aufsätze über Jeremias Gotthelf — Nachgel. Schr. S. 93 ff. — geliefert, welche, trotz manchem scharfen Urtheil, die beste Würdigung des großen Schweizer Bauerndarstellers sind). — Daneben vervollständigte K. seine allgemeine Bildung durch Lectüre und gelegentlichen Besuch eines philosophischen Collegs.
... Aber es ging nicht so weiter. Er durfte nicht länger der Mutter zur Last sein. Da thaten einige deutsche Universitätsprofessoren in Zürich, die ihn hochschätzten, Schritte, um bei der Kantonsregierung ein Stipendium für ihn zu erwirken. Es gelang; K. bekam 800 Frcs. und ging im October 1848 nach Heidelberg: für ein Jahr, wie er meinte; er ist aber volle sieben Jahre in Deutschland geblieben. Sie sind für sein Talent die endgültig entscheidenden geworden. In Heidelberg hörte er Jakob Henle's berühmte Vorlesungen über Anthropologie und schloß sich eng an Hermann Hettner, den Zitterarhistoriker und Aesthetiker, an. Mit diesem unterhielt er sich namentlich über dramaturgische Fragen; denn er hatte für sich selbst die feste Absicht, sich dem Drama zu widmen. Seine Welt- und Lebensanschauung empfing ferner in Heidelberg eine ganz bestimmte Richtung und Formulirung durch die freigeistigen Vorträge Ludwig Feuerbach's über das Wesen der Religion. Diesem tiefsten inneren Erlebniß Keller's ging ein anderes parallel: seine Liebe zu Johanna Kapp, der geistvollen Tochter des Philosophen Christian Kapp, die ihn hochachtete, innerlich aber einem anderen angehörte. Einige von Keller's schönsten „Neueren Gedichten“ sind an die Verehrte gerichtet.
Keller's dramatische Thätigkeit schien zuerst sich auf eine „Gertrud von Wart“ richten zu wollen; dann aber entwarf er ein modernes Stück „Therese“. Es ist Fragment geblieben und ist Keller's einzige dramatische Arbeit. Es behandelt das Thema der Drei: Mutter und Tochter lieben denselben Mann. Er liebt Röschen, die Tochter. Wie er um sie wirbt, wird sich auch die Mutter, Therese ihrer Liebe bewußt. Sie fordert von der Tochter Verzicht; Röschen kann nicht gewähren, und Therese stürzt sich in die Fluthen eines Flusses, der im Frühlingssturm, dessen Wehen die Handlung symbolisch begleitet, angeschwollen ist. Was von der Ausführung vorhanden (die beiden letzten Acte), ist|zu stark lyrisch, um dramatisch zu sein; in der Breite der Ausmalung zeigt sich auch der Epiker deutlich. Psychologisch ist das Bruchstück von großer Feinheit. Als Epiker schrieb K. in Heidelberg an seinem Roman; doch war dieser noch weit von der Vollendung entfernt, und in Keller's Willen herrschte noch immer der Drang zum Dramatischen vor. Ja, eigentlich nur, um die richtige Anschauung vom großen Theater zu gewinnen, vertauschte er im April 1850 Heidelberg mit Berlin, nachdem im October 1849 die Zürcher Regierung ein zweites Stipendium (1000 Frcs.) gewährt hatte, dem im Mai 1852 ein drittes (600 Frcs.) folgte. Diese Summen reichten natürlich nicht weit, und K. hat in Berlin kaum weniger gedarbt als in München; nur belästigte er die Mutter nicht mehr mit seinen Geldsorgen; er hat sogar der für ihn so treu besorgten Frau, wohl aus Scham, noch immer nichts geworden zu sein, und um ihr Kummer zu ersparen, fast zwei Jahre lang nicht geschrieben. Berlin war seine eigentliche Lebensschule. Im nach und nach sich anbahnenden Verkehr mit litterarisch bedeutenden Persönlichkeiten bildete sich sein Charakter völlig aus. Eine gewisse Rauheit blieb zwar als Grundzug, neben ihr aber ein tiefes, ja weiches Gemüth, in welchem eine ganz besondere Sonne schien: der Humor, der sich allerdings erst im reifenden Menschen zu voller Klarheit geläutert hat. Wo darum K. hinkam, sah man ihn gern; die ausgesprochene Eigenart des ebenso tiefen wie wortkargen Schweizers gefiel allen intensiver Schauenden. Seine Arbeit in Berlin sollte vorerst noch immer dem Theater gelten; er machte Pläne zu Lustspielen wie zu Tragödien; aber keiner ist ausgeführt worden. Dabei unterhielt er sich brieflich mit Hettner über Dramatik und gab dabei so feine Urtheile ab, daß der von Heidelberg nach Jena berufene Gelehrte ganze Stellen aus Keller's Briefen direct in sein Buch „Das moderne Drama. Aesthetische Untersuchungen“ (Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1852) aufgenommen hat. Keller's Briefe an Hettner sind die gehaltvollsten in Bächtold's Bänden. Bei den oben genannten Braunschweiger Verlegern Friedrich Vieweg u. Sohn erschienen 1851 Keller's „Neuere Gedichte", d. h. das, was an Lyrik in den Jahren 1846—1849 bei ihm entstanden war. Politische Poesie findet sich da nicht mehr; fremde Anklänge sind völlig verschwunden; auch die Romantik tritt zurück; manches gehört ins Gebiet der Gedankendichtung. An reiner Lyrik gab also das zweite Bändchen weniger als das erste; aber es ist kaum minder reich. Noch immer finden sich wundersam empfundene, anschauungskräftige Naturbilder und Scenen: so etwa „Winternacht"; auch Idyllisch-Lyrisches in prachtvoller Eigenart, Bild- und Klangfülle steht da: „Der Taugenichts“, „Der alte Bettler"; dann „Sommernacht“, wo K. aus dem tiefsten Volksgemüthe schöpft, echt schweizerisch, dabei von einer Sprachbeseelung, kurz von einem Leben, wie es nur der echte Poet schaffen kann. Eine Abtheilung, die etwas junggesellenhaft burschikos „Von Weibern“ überschrieben ist, enthält 16 wie neu aus dem Geiste des Volksliedes geborene Lieder. Am wenigsten original, aber nicht ohne zarte poetische Reize ist die Abtheilung „Ghaselen"; aus Hafis-Stimmung ist ihm auch „Panard und Galet“ erwachsen: dem Stoffe nach aus Baron Grimm's „Correspondance littéraire“ geschöpft, in Keller's Hand aber zu einem der lustigsten Trinkgedichte aller Zeiten gewandelt. Eine Idylle mit satirischem Einschlag ist das köstliche Stücklein „Wochenpredigt“. Es steht in der Abtheilung „Aus dem Leben“, welche mit dem gewiß im Anschluß an die Feuerbach-Vorträge entstandenen tief gefühlten Gedicht eröffnet wird:
„Ich hab' in kalten Wintertagen, In dunkler, hoffnungsarmer Zeit Ganz aus dem Sinne dich geschlagen, O Trugbild der Unsterblichkeit.“
Auch ein erstes Schmuckstück deutscher Gedankenlyrik steht in diesem Theile:
„Die Zeit geht nicht, sie stehet still, Wir ziehen durch sie hin; Sie ist ein Karawanserai, Wir sind die Pilger drin.“
Das Gedicht schließt mit den lebensmuthigen Strophen:
„An dich, du wundervolle Welt Du Schönheit ohne End'! Schreib ich 'nen kurzen Liebesbrief Auf dieses Pergament. „Froh bin ich, daß ich aufgetaucht In deinem runden Kranz; Zum Dank trüb' ich die Quelle nicht Und lobe deinen Glanz.“
Das ist wie ein Vorklang auf Keller's schönstes Gedankengedicht hin: „Augen, meine lieben Fensterlein“, das Theodor Storm (1879) das „reinste Gold der Lyrik“ genannt hat.
Als Hauptwerk ist nun aber in Berlin „Der grüne Heinrich“ entstanden, in fünfjähriger Arbeit. Der Roman sollte also des Dichters eigene Jugendgeschichte sein; der Tod des in seiner Künstlerlaufbahn Gescheiterten sollte den Schluß bilden, nachdem sich an die Münchner Erlebnisse noch die Heidelberger inneren Erfahrungen angeschlossen hatten. Aber eben der Schluß! K. selbst stieg ja in langsamer, aber sicherer Entwicklung empor; und der biographische Roman sollte „cypressendunkel“ ausklingen. Da lag die Schwierigkeit; darum die Zögerungen, die zwischen Vieweg in Braunschweig und dem Verfasser einen Briefwechsel hervorriefen, der eine buchhändlerische Tragikomödie ersten Ranges darstellt. Vieweg, der gleich nach den ersten Proben an K. glaubte, Honorar zahlte und — wartete, bis der auf 30—35 Bogen geplante Roman komme; K., der bei Abschluß des Vertrages das Werk im Wesentlichen erst im Kopfe, nicht auf dem Papier hatte, dann zögerte und zögerte und schrieb und schrieb, fünf Jahre lang, bis aus den 30—35 Bogen deren 107 geworden waren, dabei, nach Bächtold's Ausdruck, der Verleger „nobel, von wahrer Himmelsgeduld, der Verfasser kurz angebunden, unwirrsch, saumselig, wortbrüchig bis zur äußersten Rücksichtslosigkeit": das ist das Bild, das wir aus den bei Bächtold gedruckten Briefen gewinnen. Der erste Band war im Herbst 1851 gedruckt, Ende 1852 der zweite, Ende 1853 der dritte; am Palmsonntag 1855 endlich „schmierte“ K., nach eigenem Ausdruck, „buchstäblich in Thränen", das letzte Capitel des vierten Bandes „hin“. Man hat nun für den „Grünen Heinrich“ nach Vorbildern gesucht; es gibt eigentlich nur Eines dafür, Goethe's „Wilhelm Meister"; aber K. ist nicht Nachahmer; sonst wäre sein Roman versunken wie hundert andere, die sich Goethe's Werk zum Muster genommen haben. Keller's künstlerische Art ist Goethisch: Wie die Jugenderlebnisse in Poesie aufgelöst sind, das stellt den „Grünen“ neben Wilhelm Meister. Außer Goethe, dem er in einer wunderbaren Stelle ("Gr. H.“ 1. Aufl., Bd. III, S. 4 ff.) gedankt hat, ist auch Jean Paul ein Seelenführer Keller's gewesen; auch ihn hat er in einer prachtvollen — später getilgten — Stelle (1. Aufl., Bd. II, S. 174 ff.) hoch gepriesen. Im J. 1878 hat dann K. als reifer Künstler den Roman nochmals in die Hand genommen und hat ihn namentlich im Schlusse verändert. Die erste Fassung ist sehr selten geworden; sie sei hier nur kurz skizzirt. Der Roman beginnt als „Er"-Erzählung. Ein junger Maler, Heinrich Lee, wandert aus seiner schweizerischen Vaterstadt nach München. Dort fällt ihm unter seinen Sachen ein Manuscript mit Erinnerungen an seine Jugendzeit in die Hände. Wir lernen es kennen; es behandelt in der Ich-Form bis tief in den 3. Band (S. 173) hinein Heinrich's Jugendgeschichte: jene Kindheitsschilderung ohne Gleichen, so wahr, so tief, so individuell und zugleich so allgemein menschlich ... Alles erlebt und doch Alles so traumhaft poetisch. Erfunden sind nur die Liebesgeschichten; zwar Anna, die so selig reine Figur, ist im Grunde Henriette, Keller's Jugendgeliebte, aber nur im Keim, aus dem die Phantasie dann lieblichste Blüthen entwickelt. Ganz aus der Phantasie ist die leidenschaftsvolle, lebenglühende Gestalt der Judith geschaffen. Sie und die Mutter wandeln mit dem Helden durch den ganzen Roman. Dieser droht dann und wann etwas zu zerfahren; aber der Dichter weiß ihn dann doch immer wieder zusammen zu halten und die Beziehungen auf den Helden zu gewinnen. Von diesem geht dann die Erzählung in der Er-Form weiter: Münchner Erlebnisse werden geschildert: die Freunde, das große Dürerfest (das K. allerdings nicht selbst miterlebt hat), dann die Zweifel am Malerberuf, die Anregungen zu innerer Klärung infolge des beim Anthropologen Gehörten. Endlich die Roth, die bittere Roth und — eine Folge von goldenen Heimathträumen — die Flucht zur Mutter. Noch ein Aufenthalt: beim Grafen, der Heinrich's Bilder beim Trödler gekauft hat; eine Liebe sogar: zu Dortchen Schönfund. Aber er darf an sein unfertiges Leben kein anderes binden; er flieht in die Heimath. Dort erfährt er den Tod der Mutter; der Kummer um ihn hat sie getödtet. Noch einmal blitzt Dortchen's Bild vor ihm auf: „Seine Blicke glaubten auf dem goldenen Wege, der zu einem schmalen Stückchen blauer Luft führte, die Geliebte und das verlorene Glück finden zu müssen. — Er schrieb Alles an den Grafen; aber ehe eine Antwort da sein konnte, rieb es ihn auf, sein Leib und Leben brach und er starb in wenigen Tagen“. — Dieser tragische Schluß fand keinen Beifall: der Verleger Vieweg, auch Hettner, Varnhagen u. A. empfanden ihn als Fehler. K. selbst sagt zwar ("Nachgel. Schr.“ S. 21): „Der einmal beschlossene Untergang wurde durchgeführt theils in der Absicht eines gründlichen Rechnungsabschlusses, theils aus melancholischer Laune.“ Später aber hat K. den Tadlern stillschweigend recht gegeben; denn in der zweiten Fassung des Romans bleibt Heinrich am Leben. Die Umarbeitung also fällt in die Jahre 1878—1880. K. wollte damit die alte Fassung absolut auslöschen; im Winter 1878 auf 79 mußte seine Schwester Regula mit 360 Bändchen der ersten Auflage den Stubenofen heizen, und „die Hand verdorre“, soll K. gesagt haben, „welche je die alte Fassung wieder zum Abdruck bringt“. Die neue nun hat er als bewußt feilender reifer Künstler zunächst von allen Geschmacklosigkeiten und einer Menge von Reflexionen befreit; in der Composition änderte er durchgreifend das Ganze in die Ich-Erzählung um; das gereicht dem Buche nicht immer zum Vortheil; aber größere Geschlossenheit hat er damit sicherlich erreicht. Einige reizvolle Capitel sind neu geschaffen worden. Am Schlusse erscheint Judith noch einmal: K. wollte sich, wie er selbst gesagt hat, „noch einmal am Abglanze dieses von keiner Wirklichkeit getrübten Phantasiegebildes erfreuen". Heinrich und sie finden sich — aber nicht zur Ehe, sondern zur Freundschaft, die ein sichereres Glück verspricht. Und Heinrich stirbt nicht; er lebt „in bescheidener und doch mannichfacher Wirksamkeit in der Stille" eines kleinen Amtes, und Judith hilft ihm diese Bescheidenheit tragen und „frei und gesund" zu bleiben. Dafür hat er ihr das geschriebene Buch seiner Jugend geschenkt. Nach zwanzig Jahren stirbt sie als Helferin bei einer verderblichen Kinderkrankheit. Er aber hat das Buch „aus dem Nachlaß wieder erhalten und den andern Theil dazu gefügt, um noch einmal die alten grünen Pfade der Erinnerung zu wandeln“. Gewiß, der zweite „Grüne Heinrich“ ist künstlerisch vollendeter als|der erste. Der tragische Schluß des ersten ist allerdings — trotz Hettner's, Vieweg's und Fr. Th. Vischer's Einwendungen — als Ende für den an seiner Halbheit leidenden, nicht-ganz-sein-könnenden, auch nicht-wollen-könnenden, dabei aber innerlich so tief leidenschaftlichen Heinrich consequenter als das beruhigte Ende des zweiten. Aber auch dieses hat seine Vorzüge und ist Trost für Viele, und nicht die schlechtesten, die mit Heinrich um sein Schicksal bangen, dabei ihr eigenes ansehen und froh sind, daß trotz der tragischen Anlage des Werkes es ein bescheidenes Ausklingen, ein zwar nicht bedeutendes, aber doch lebenswerthes Dasein auch nach dem Zusammenbruche gibt. Das höchste Kunstwerk im deutschen Roman des 19. Jahrhunderts ist dieser zweite „Grüne Heinrich“ doch, weil er, nach Karl Weitbrecht's Wort, nicht „Dichtung und Wahrheit“, sondern reine Dichtung ist, d. h. es ist ein Lebensschicksal völlig in reine, goldene Poesie aufgelöst. — Von dem gewaltigen Einfluß des Romans auf die neuere deutsche Dichtung zu reden, auch ihn als Culturbild allerersten Ranges näher zu betrachten, ist hier nicht der Ort.
Schon während der Arbeit am „Grünen Heinrich“ hatte Gottfried K. sich mit Novellenstoffen beschäftigt: u. a. waren der „Galatea"-(Sinngedicht-) Cyklus und „Die drei gerechten Kammmacher“ aufgetaucht (1851); aber es blieb bei flüchtigen Andeutungen. Im J. 1853 wurde dann aber eine neue Novellenreihe entworfen und 1854 und 1855 rasch niedergeschrieben: „Die Leute von Seldwyla“, I. Theil. Es waren 7 Novellen; 2 davon ("Der Schmied seines Glückes“ und „Die mißbrauchten Liebesbriefe") wurden für einen zweiten Band zurückgelegt. Der erste, bei Vieweg in Braunschweig 1856 erschienen, enthielt 5 Novellen. Sie zeigen uns K. als Künstler reifer, alser im Roman erschienen war, herausgewachsen aus der „subjectiven und unwissenden Lümmelzeit“, wie er die „Grüne Heinrich"-Periode nannte. Er war sich, wie auch A. Köster ("G. K. 7 Vorlesungen") hervorhebt, namentlich im mündlichen wie im schriftlichen Verkehr mit Hettner, über das Künstlerische klar geworden. Verzicht auf das Nebensächliche, Betonung des Nothwendigen, Klarheit der Charaktere und der aus ihnen allein sich ergebenden Conflicte, Einfachheit im Aufbau, so daß der Leser „voraussehe" und nicht durch Sensationen überrascht werde: das waren seine deutlich erkannten Mittel und Ziele geworden; dazu die schon im „Gr. H.“ so schön erfüllte Forderung, daß das Kunstwerk seinen „Anstoß aus dem äußeren oder inneren Leben“ des Dichters zu empfangen habe. So erfand er Seldwyla, einen Ort in seiner Phantasie, aber zugleich einen Ort, wie er nur in der Schweiz möglich wäre und ist: ein Stück satirisch-humoristisch geschauter Vaterlandswelt, aus der nun die fünf Novellen heraus sich entwickeln als eine poetisch gesehene Wirklichkeit. In den beiden ersten behandelt er noch, wie im „Gr. H.“, das Verhältniß von Mutter und Sohn; in der allerersten, „Pankraz der Schmoller“, finden wir die auf ihren Sohn harrende Mutter; der Held selbst, Pankraz, ist der starkköpfige, mürrisch schmollende Gottfried K. der Jugendzeit nach der Relegation aus der Schule; die kümmerliche Haushaltung der Mutter und der Schwester ist ganz diejenige, in der K. aufgewachsen war: aber nicht naturalistisch photo- und kinematographirt, sondern die Wirklichkeit ist durch Keller's Dichterkraft, die hier aus der Hand der Wahrheit den Schleier sänftigender und verklärender Erinnerung empfing, zu jenem poetischen Realismus gewandelt, der zu allen Zeiten das echteste Wesen gesunder Dichtung ausgemacht hat. Dann die Erziehung Pankrazens und seine Heilung vom Schmollen durch ein Weib und einen Löwen. Und diese seine Erziehungsgeschichte erzählt Pankraz, der einst im Unmuth dem Mutterhaus Entlaufene, als Officier der Fremdenlegion Heimgekehrte, selbst. Also Ich-Form, wie im „Gr. H.“, dem dadurch diese im Schulmeistersinne so unpädagogische und|doch so menschlich wahre, humorgesättigte Erziehungsnovelle am nächsten tritt. Pankraz wird denn auch infolge dieser Erziehung kein Seldwyler Lump und Schuldenmacher, sondern an einem andern Ort ein rechter Mensch. — In der zweiten Novelle „Frau Regel Amrain und ihr Jüngster“ erzieht Frau Regula — zu der Frau Dr. Regula Scheuchzer und Keller's brave Mutter die Modelle gewesen sind — ihren Fritz, den jüngsten ihrer drei Buben, mit denen sie ihr Mann, ein echt seldwylerischer leichtsinniger Schwächling, hatte sitzen lassen, zum Manne, indem sie ihm in wundervoll wahren Situationen den Geschmack am Seldwyler Lumpenleben und am hohlphrasigen Politisiren abgewöhnt, ja ihn schließlich zum pflichtbewußten Demokraten und Bürger, im Ganzen also zum tüchtigen biderben Schweizer macht. Der erzieht dann sogar noch seinen Vater, den seiner Zeit der Frau und der Vaterpflicht Davongelaufenen, zum brauchbaren Menschen. Auch in dieser Novelle ist das Praktisch-Pädagogische völlig im Poetischen aufgegangen. — Für die dritte Erzählung „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ hat K. ausdrücklich auf einen „wahren Vorfall“ als Grundlage hingewiesen (confer, vergleiche Bächtold II, S. 65). Er dachte zuerst an ein kleines Epos (Bächtold II, S. 67 f.), hat dann aber zur Prosa gegriffen und das hohe Kunstwerk dieser Novelle geschaffen, in dem, in reiner und großer Erfüllung der von ihm erkannten Gesetze, das Tragische mit einer Sicherheit ohne Gleichen, rein aus den Charakteren und den durch sie geschaffenen Situationen heraus, erreicht wird. Alles Detail und „Milieu“ ist nur insoweit behandelt, mitgegeben, angedeutet, als es zur Gesammtstimmung und zur Klarheit nöthig ist. Und lebendig steht Alles vor uns: die spielenden Kinder, die Väter an den Pflügen; dann der Streit der Alten, die Liebe der Kinder, tragisch vom ersten Anfang an; darauf der Entschluß Salis' und Vrenchen's, sich zu trennen, zuvor aber noch einmal fröhlich zu sein; dann ihre gemeinsame Sonntagswanderung, der Tag, die Mondnacht, die Hochzeit auf dem Heuschiff, das Ende im Wasser. Dazu die schlichte und doch so tiefe psychologische Führung; die tragische Consequenz als unentrinnbar, als Nothwendigkeit. „Ich habe“, sagt ein Dichter, zugleich einer der schärfsten Kritiker eigener und fremder Werke, Otto Ludwig, „unmittelbar vorher Romane gelesen, unmittelbar nachher Novellen von Heyse und Grimm, auch eigene Pläne derart gemacht; aber all das ist wie bemalte Florvorhänge vor einem gemalten Kirchenfenster; das tiefe und glühende Giorgionische Colorit, die compakte Tizianische Leiblichkeit der Keller’schen Novelle strahlt siegend durch und läßt das Blaßträumerische der Behänge noch aquarellhaft körperloser erscheinen“. K. selbst aber hat unter seinen Seldwyler Novellen nicht „Romeo und Julia auf dem Dorfe", sondern „Die drei gerechten Kammmacher" am höchsten geschätzt, wohl weil darin sein Humor die Wirklichkeit am eigenartigsten umspielt. Die drei „Gerechten“, schofel Gerechten, die drei Kammmachergesellen, die „alle recht thaten und desnahen nicht neben einander existiren können“, die durch ihr Rechtthun, d. h. dadurch, daß sie beim Meister liebedienern, das Anrecht auf die Meisterschaft und Nachfolge erkriechen wollen ... das sind Prachtgestalten Keller’scher humorvoller Satire; dann ihr Kampf um die eigennützige Jungfrau Züs Bünzlin, ihr tragisch-komisches Geschick: der Selbstmord des Jobst, der Wahnsinn des Fridolin, der Erfolg Dietrich's, der aber kein Erfolg ist, weil Züs ihn als Frau regiert und unterdrückt und sich selbst als die alleinige Quelle alles Guten betrachtet ... Das alles ist so komisch grausig, dabei so real und doch wieder so ironisch lebenverhöhnend, gleichzeitig so tragisch, auch so originell, daß wirklich nur, wie Paul Heyse dem Dichter schrieb, Cervantes und Rabelais zum Vergleich herangezogen werden können. Die letzte Geschichte „Spiegel das Kätzchen“ schreitet aus der Gegenwart|heraus in Märchenzeiten, ist auch mit ihrem Zauberer Pineiß und ihrer Katzenpoesie ein echtes romantisches Märchen, nicht seldwylerisch, sondern einfach zeitlos anmuthsvoll; manchmal etwas überkeck, aber Romantik lustigster Art, mit einem ihrer Schnörkel an der Wirklichkeit festgerankt. — Die „Leute von Seldwyla“ fanden jedoch nur bei feingeistigen Kennern Beachtung. K. machte weitere Pläne: „Dietegen", „Ursula“, die „Legenden“ wurzeln in seiner Berliner Zeit; er schloß auch bereits mit dem Berliner Verleger Franz Duncker, in dessen Hause er, besonders beschützt durch Frau Lina Duncker, viel anregenden Verkehr fand, einen Vertrag für zwei Bände Novellen ab, empfing Honorar als Vorschuß, hat aber, wie an Vieweg zur Zeit des „Gr. H.“, nichts geliefert, weil die Sachen erst „ausgeheckt“, noch nicht geschrieben waren. (Er hat 1876 Vorschuß sammt Zinsen zurückbezahlt.) Außer Duncker nahmen sich Varnhagen von Ense und dessen schöngeistige, aber excentrische Nichte Ludmilla Assing, auch Jul. Rodenberg, sein späterer „rundschaulicher Brotherr“, des Dichters an. Um ihn aus ökonomischen Bedrängnissen zu befreien, schossen Freunde in der Schweiz, Jakob Dubs voran, 1800 Frcs. zusammen; sie reichten zur Tilgung der Verbindlichkeiten. Aber K. blieb in Berlin; auch eine Berufung an das zu gründende Polytechnikum in Zürich lehnte er ab und empfahl Hettner; statt dessen, der nach Dresden ging, wurde Fr. Th. Vischer gewählt. In Berlin hielt den Dichter eine neue Liebe zurück; sie war „unglücklich“. Endlich folgte er den wiederholten Rufen seiner Mutter und seines Freundes Wilhelm Schulz in Zürich und reiste heim, nachdem ihn Frau Elisabeth mit 1000 fl., die sie hatte aufnehmen müssen, losgeeist hatte. „Berlin“, sagt K. selbst, „hat mir viel genützt, obgleich ich es nicht liebe ... Ich bin mit vielen Schmerzen ein ganz anderer Mensch und Litterat geworden!“ In der Heimath gefiel es ihm; er fand hochgebildete Freunde: Fr. Th. Vischer, Gottfried Semper, Jacob Burckhardt, Jak. Moleschott, Hermann Köchly; er ging auch im Hause Wesendonck aus und ein und lernte Richard Wagner kennen. Auch Besuche aus Deutschland (Adolf und Fanny Stahr-Lewald, Varnhagen) erfreuten ihn; hauptsächlich aber fühlte er sich als Schweizer wohl an den Festen der Eidgenossen und hat zu mehreren prachtvolle, tiefempfundene Lieder gedichtet, u. a.| das tüchtige „Marschlied“, und die Krone dieser Dichtungen, das „Tischlied am Jahresfest (1857) der schweizerischen Militärgesellschaft:
„Heißt ein Haus zum Schweizerdegen, Lustig muß die Herberg sein; Denn die Trommel spricht den Segen Und der Wirth schenkt Rothen ein! Kommen die Gäste, schön' Wirthin, sie lacht, Sie hat schon manchen zu Bette gebracht!“
Am allerwohlsten war ihm bei Schweizerfreunden, dem Maler Rud. Koller und dem Componisten Wilh. Baumgartner; auch bei C. F. Meyer's Freunden François und Eliza Wille auf Mariafeld, war er gern zu Gast. Zum Schillerfest 1859 hat K. für die Musikgesellschaft in Bern jenen herrlichen Prolog gedichtet, der das beste von dem vielen Guten war, was zu des großen Schwaben, Keller's erklärten Lieblingsdichters, Geburtstag gesprochen worden ist. Im J. 1861 entstand die farbenreiche Schilderung des Festes am Mythenstein, in welcher das bis heute unerreichte Ideal eines nationalen Festspieles aufgestellt wird (Nachgel. Schr. S. 34 ff.). Im selben Jahre 1861 wurde K. auf Vorschlag seines Freundes, des Finanzdirectors Franz Hagenbuch, zum ersten Staatsschreiber von Zürich gewählt: zur Verwunderung aller Parteien, die sich nichts Gutes von dieser Ernennung versprachen. Sie hat aber erstens den Dichter an ruhiges, sicheres Arbeiten gewöhnt; zweitens ist K. einer der|besten, gewissenhaftesten Beamten gewesen, 15 Jahre lang, eine Zeit, in der er innerlich stille reifer und reifer geworden ist. Veröffentlicht hat er in diesen Jahren wenig. Vorher schon war in Berthold Auerbach's „Volkskalender" (Jahrgang 1861) „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“ erschienen, seine populärste Erzählung, voll von der Frische echten schweizerischen Volksthums: die Geschichte von den sieben „alten Krachern“, die zum eidgenössischen Schützenfest ziehen und für die dann der junge Karl Hediger, der Sohn des einen der sieben, jene Festrede hält, die ihm nicht nur alle Herzen, sondern auch die Zustimmung des Vaters der Geliebten zur Verlobung gewinnt und die außerdem die einzige Schützenfestrede auf Erden ist, die man mehr als einmal lesen kann. Und ein Humor liegt über Allem, reif und klar, kellerisch einzigartig. Zwei andere Beiträge Keller's zu Auerbach's Kalender: „Verschiedene Freiheitskämpfer“ (1863) und „Der Wahltag“ (1866) gehören nicht zu seinen beachtenswertheren Werken (Nachgel. Schriften S. 245 u. 277). Im J. 1860 hatte K. auch den schon früher geschriebenen „Apotheker von Chamounix“, ein Buch Romanzen, zur Herausgabe vorbereitet; der Plan stammte aus dem Jahre 1851, als H. Heine's „Romanzero“ erschienen war; es sollte die Bizarrerie des Dichters oder seiner Nachahmer verspottet bezw. übertrumpft werden. Die Dichtung, zumeist Litteratursatire, hätte schon 1853 der 2. (Titel-)Auflage der „Neueren Gedd.“ beigegeben werden sollen; das unterblieb aus Platzmangel. Beim Tode Heine's (1856) erschienen geschmacklose Parodien auf dessen Werke, und K. wollte sein Gedicht nicht damit zusammen genannt wissen; aber auch 1860 erschien die Dichtung noch nicht, sondern ist erst 1883 mit den „Gesammelten Gedd.“ veröffentlicht worden (die erste Fassung hat Bächtold im Ergänzungsheft zum „Euphorion“ [Bd. II] abgedruckt). Der erste Theil schildert den Tod des Apothekers Titus von Chamounix durch seine eifersüchtige Geliebte Rosalore unter den bizarrsten Umständen. Im II. Theil wird Heine nach dem Erscheinen seines „Romanzero" im Traume zu den Schatten der großen Dichter getragen. Er streitet sich mit Börne und wird ins große Tintenmeer gestoßen, in welchem (in der ersten Fassung) als „großer Tintrich" Gutzkow herumschwimmt. Heine stirbt dann und muß in einem der Felszacken des Montblanc, dem Reinigungsort armer Seelen, die Verleugnung seines Herzens büßen. Die erste Fassung schloß mit dem Hinweis auf das große Schillerfest von 1859. Dieser Schluß ist dann unter dem Titel „Das große Schillerfest“ in die „Ges. Werke“ (Bd. X, S. 153) aufgenommen worden. Als Staatsschreiber hatte K. dann und wann die Bettagsmandate, d. h. die Ansprachen der Regierung an das Volk zum eidg. Dank-Buß- und Bettag zu verfassen; eines (von 1862, das ihm übrigens die Behörde nicht annahm) ist abgedruckt in den „Nachgel. Schr.“ (S. 235). Während Keller's Beamtenzeit starb (5. Februar 1864) seine Mutter, der das Glück, mit dem wohlbestallten Sohne sorgenlos in der großen alten Staatskanzlei wohnen zu können, die letzten Jahre verschönert hatte. K. hat von da an seine Geselligkeit noch mehr als sonst außer dem Hause gesucht; auf der „Meise“ fand er jenen lieben Bekanntenkreis, dem Alfred Escher, der Philologe Köchly, Fr. Th. Vischer u. A. angehörten. Zum 50. Geburtstage (19. Juli 1869) veranstaltete die akademische Jugend Zürichs eine großartige Ehrung des Dichters. Man betonte dabei vornehmlich zwei Dinge: daß das Vaterland K. besser sollte kennen lernen, und daß er zur Dichtkunst zurückkehren möge. Unter dem Eindruck des zweiten dieser Wünsche gab K. 1872 bei Goeschen in Stuttgart die „Sieben Legenden“ heraus. Er nannte diese, ursprünglich für den „Galatea"-("Sinngedicht"-)Cyklus bestimmten Umarbeitungen von Legenden Joseph Theobul Kosegarten's „ein kleines Zwischengericht, ein lächerliches Schälchen|eingemachter Pflaumen". In Wirklichkeit sind sie graziöseste Poesie, von unnachahmlichem Zauber der liebenswürdigsten Erzählungskunst. Aus den mittelalterlichen, bei Kosegarten ungelenk nacherzählten Heiligengeschichten ist das rein Menschliche mit feinstem Sinn und sicherer Poetenhand herausgeholt, „wobei ihnen freilich zuweilen das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend hingewendet wurde, als nach welcher sie in der überkommenen Gestalt schauen“. Da ist „Eugenia“, die pedantisch nach Männerwissenschaft strebt, sogar Abt eines Klosters wird, dann aber durch reine Weiblichkeit ihr Menschenthum rettet. K. läßt sie nämlich die Gattin eines ehrbaren Mannes werden, während die Originallegende es beim Preise der christlichen Gelehrsamkeit bewenden ließ. Dann werden drei herzige Marienlegenden geboten: erstens „Die Jungfrau und der Teufel": da ringt Maria mit dem Bösen, dem ein verlumpter Graf seine holde fromme Gemahlin Bertrade versprochen hat, und bringt ihn zum Verzicht auf die Beute. Der böse Gemahl aber kommt um. In der folgenden Legende: „Die Jungfrau als Ritter“ ist Bertrade Wittwe. Um ihre Hand muß turnirt werden. Der etwas linkische, aber treuherzige, brave Zendelwald gewinnt sie; doch nicht er selbst hat gefochten, sondern in seiner Gestalt Maria, während er bei dem Kirchlein eingeschlafen war, bei dem einst die Jungfrau mit dem Teufel um Bertrade gerungen hatte. „Die Jungfrau und die Nonne“ ist die Erzählung von der Klosterküsterin Beatrix, die in die Welt geht, heirathet, Mutter wird, während Maria das Küsteramt versieht. Beatrix kehrt dann reuig zurück. Damit schließt die alte Legende. K. aber „wendet ihr das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend hin", wieder ins Rein-Menschliche: Eines Tages kommt — als Greis — Wonnebold, der Mann der Beatrix, mit acht Jünglingen, „welche wie ebensoviel geharnischte Engel anzusehen waren", ins Kloster. Beatrix erkennt ihre Kinder, bekennt sich zu ihnen und bringt somit der Jungfrau die reichste Gabe dar. — Fast gewagt, aber in der schlichten Erzählung doch unschuldig ist die Geschichte vom „Schlimm-heiligen Vitalis", der in die verrufenen Häuser geht, um verlorene Seelen zu retten. Wie er dann weltlich wird und wie ihn die schöne Jole zu „einem ebenso trefflichen und vollkommenen Weltmann und Gatten" macht, „als er ein Märtyrer gewesen war", das ist so lieblich und naiv geschildert, daß der Zweifel über „erlaubt" oder „nicht erlaubt" eines solchen Stoffes schwindet. Die unübertreffbar graziöse Form adelt Alles. „Dorothea's" Blumenkörbchen“, die Geschichte des Mädchens, das den geliebten Jüngling, den es nicht besitzen kann, in den Märtyrertod mit hineinzieht, ist von einer wonnesamen Süßigkeit: nicht sentimental, aber ganz eingetaucht in Poesie, mit einem Schlusse, dessen himmlischer Glanz Alles überstrahlt. — Am Ende dann „Das Tanzlegendchen“, vom Allerlieblichsten, was je auf Deutsch geschrieben worden ist: voll Einfachheit, voll Empfindung und in jedem Erzählerschritt so duftig rhythmisch, daß nur das Leiseste und Zarteste etwa in Arnold Böcklin's Phantasiekunst zum Vergleiche herangezogen werden könnte. — Die „Sieben Legenden“ hatten den vollsten Erfolg. Schon nach wenigen Wochen wurde eine zweite Auflage nöthig. Die Legenden blieben dem Dichter lieb. Er feilte noch mehrmals daran und hat z. B. das „Tanzlegendchen“ feinfühlig mit einem anderen Schluß versehen: derjenige der ersten Fassung, wo der Stadttambour des himmlischen Jerusalems Ruhe stiftete, mußte der grandios einfachen Scene weichen, wo „die allerhöchste Trinität selber“ den herzergreifenden Sehnsuchtsgesang der neun Musen zum Schweigen bringt.
Im Herbst 1872 reiste K. nach München und frischte alte Erinnerungen auf; den Trödler jedoch, dem er einst in bitterer Roth seine Cartons verkauft hatte, vermochte er nicht mehr ausfindig zu machen. Der nächste Herbst (1873)|führte ihn ins Salzkammergut zu lieben Freunden: Prof. Adolf Exner und Marie Exner (später Frau v. Frisch); die Bekanntschaft mit diesen vortrefflichen Menschen ging auf sein 50. Geburtstagsfest (1869) zurück. Exner war dann 1872 nach Wien gegangen und zwischen ihm und K., auch zwischen Marie v. Frisch-Exner und dem Dichter, entwickelte sich ein Briefwechsel, in dem K. vom Köstlichsten seines Humors gibt. Ueberhaupt Keller's Briefe! Sie sind (confer, vergleiche Bächtold I—III passim) einzigartig in Originalität und Frische. K. ist einer der originellsten Epistolographen des Jahrhunderts gewesen. Im J. 1874 reiste er den Freunden Exner zu Liebe sogar nach Wien. Beide Male lebte er wohl an froher Geselligkeit; dabei hat er auch gearbeitet: 1873 an „Dietegen“, 1874 am „Verlorenen Lachen“. Im J. 1874 erschienen bei Goeschen in 4 Bänden „Die Leute von Seldwyla“, in Band I und II die fünf alten Erzählungen, in Bd. III und IV fünf neue. In der Einleitung nannte K. noch immer „Freude am Lande, mit einer heilsamen Kritik verbunden", den Grund für seine Dichtung. Seine Seldwyler sind zwar etwas ernster geworden; aber noch gibt es aus der guten lustigen Vergangenheit eine kleine Nachernte. Da ist zuerst „Kleider machen Leute“ eine Geschichte, die in Wädensweil passirt ist und die nun der Dichter ins Realistisch-Poetische wendet: vom Schneidergesellen, der sich, vom Zufall und der Leichtgläubigkeit der Menschen begünstigt, für einen großen Herrn ausgibt, dann aber, entlarvt und gedemüthigt wieder in die Niedrigkeit fallen soll. Das ist mit prächtigem Humor erzählt, und die Schlußwendung, daß Werner Strapinski nicht der elende Schwindler ist, für den man ihn hält und daß er darum sein Nettchen bekommt, ist von freundlich versöhnender milder Menschlichkeit. — Darauf „Der Schmied seines Glückes“, der schon in Berlin geschriebene Schwank: stellenweise fast ein bischen zu verwegen, aber mit seiner Schilderung des allzu klugen Herrn John Kabys „doch wohl“, wie R. M. Meyer treffend sagt, „die glänzendste Humoreske unserer Litteratur, deren sich Boccaccio so wenig zu schämen hätte, wie Ariost des 'Apothekers von Chamounix'". „Die mißbrauchten Liebesbriefe", ebenfalls altes Berliner Produkt, von Vieweg 1865 in der „Deutschen Reichszeitung" veröffentlicht, sind eine famose Satire auf ein gewisses trauriges Litteratenthum, daneben eine feine Liebesgeschichte: wie Viggi Störteler seine brave, kluge Frau an den „sinnigen“ Schulmeister verliert und dafür eine wüste zweite Gattin bekommt. Es folgt „Dietegen“, eine Novelle, die, ebenfalls schon in Berlin erdacht, seit 1862 im Manuscript unter dem Titel „Leben aus Tod“ bei den Freunden cirkulirte und 1873 im Salzkammergut zu einem Drittel neu gearbeitet worden war. Der Stoff ist einer alten Chronik entnommen und bizarr genug: das Mädchen, das Dietergen vom Galgen holt, und Dietergen, der Jahre nachher dieselbe Küngold vom Schafotte weg heirathet. Das ist nun aber trotz aller Schauerlichkeit so menschlich natürlich erzählt und ist außerdem so geschickt mit den Ereignissen der größten Schweizer Heldenzeit, den Burgunderkriegen, verbunden, daß man nicht Unrecht thun wird, wenn man dieses Stück den besten deutschen historischen Novellen aller Zeiten zuzählt. — In Berlin als „Sängerfestnovelle“ geplant, 1868 aber ins Politische gewandt, 1874 (in Wien) dann noch um das religiöse Element vermehrt, ist „Das verlorene Lachen“. Die Novelle ist in ihrem Tiefsten wol nur für Schweizer ganz und sofort verständlich, weil Verfassungskämpfe mit ihren Umwälzungen nur in der Schweiz den Bürger bis ins Innerste seines Herzens und seines Hauses hinein bewegen und weil gerade die Schweiz, oder doch vornehmlich sie mit ihrer unbeschränkten Denk- und Sprechfreiheit, eine religiöse Richtung hervorgebracht hat, welche einige ihrer extremsten Vertreter zu einer von Religion und Innerlichkeit weit entfernten phrasenreichen Schöngeisterei führte. Schweizerisch-culturhistorisch ist „Das verlorene Lachen“ also von größtem Werthe; mit ihrer lebendigen Darstellung steht die Novelle aber auch künstlerisch hoch; doch fehlt ihr ein wenig die volle Rundung der Composition um einen menschlichen Mittelpunkt — hier Jukundus Meyenthal und Justine Glor — herum, die sonst Keller's Werke auszeichnet. Sie hat dem Dichter viel Unangenehmes gebracht, eben weil sie, nach J. V. Widmann's gutem Wort, „zur glühenden Pracht voller Sommerrosen auch die Dornen eines Rosenhags zeigte und diese Dornen mit großer Schärfe gegen die Reformtheologie richtete“. Man hielt K.'s Angriffe auf religiöse Auswüchse für persönliche Gehässigkeit gegen einen bestimmten Pfarrer und befehdete ihn so, daß er sich „gegen die aufgebrachte Kurie des Freisinns“ 1879 mit einem Artikel „Ein nachhaltiger Rachekrieg“ (Nachgel. Schriften S. 202 u. 343) glaubte wehren zu müssen.
Diesmal war der Erfolg der „Leute von Seldwyla" ein großer, und es wuchs in dem Dichter der Wunsch, „jetzt kein Jahr mehr vorbeigehen zu lassen, ohne etwas zu Tage zu fördern". Er gab darum 1876 sein Amt auf und lebte auf dem „Bürgli" in der Vorstadt Enge, wohin er schon 1875 aus der Staatskanzlei gezogen war, nach eigenem Geständniß „seine glücklichste Zeit“. — Schon 1860 hatte der Dichter an „Zürcher Novellen“ gedacht, welche „im Gegensatz zu den 'Leuten von Seldwyla' mehr positives Leben enthalten“ sollten. Sie erschienen aber erst vom November 1876 bis zum April 1877 in Julius Rodenberg's „Deutscher Rundschau“. K. macht in ihnen die Vergangenheit seines Zürich ebenso lebendig wie er die Gegenwart Seldwyls geschildert hat. Er schuf zunächst die originelle Rahmenerzählung, in der ein älterer Zürcher seinem jungen Neffen, Herrn Jacques — der ein Original werden möchte —, drei Geschichten darbietet: Zuerst „Hadlaub“, d. i. die liebenswürdig poetische Schilderung von der Entstehung der „Manessischen“ Liederhandschrift, deren Niederschreibung den frischen jungen Bauernsohn Johannes Hadlaub zum Dichter macht. Aufs geschickteste ist dessen eigene Liebe zu einer vornehmen Dame hineinverflochten, und ganz besonders zart und eigenartig ist es, wie K. Motive aus Hadlaub's eigenen Liedern in die Hand nimmt, sie verlebendigt und als farbenfrische Existenzzüge seiner Geschichte einverleibt. Für die Buchausgabe hat K., einer Bitte Theodor Storm's folgend, den Schluß, nämlich den Bericht von der Vereinigung der Liebenden, Hadlaub und Fides, etwas erweitert (Briefwechsel zw. Th. Storm u. Gottfr. K. ed. A. Köster S. 11, 13, 23). Auch die zweite Erzählung „Der Narr auf Manegg“ handelt noch von der Manesse-Handschrift. Ein illegitimer Abkömmling der Familie Manesse, der Narr Buz Falätscher, der auf der alten Burg Manegg wohnt und mit dem, wenn er nach Zürich kommt, die Ritter ihren Spaß treiben, hat sie dem letzten richtigen Manesse gestohlen. Sie wird aber von fröhlichen Gesellen, die seine Burg überfallen, wieder geholt und gelangt in den Besitz des Freiherrn v. Sax. — Die dritte Erzählung „Der Landvogt von Greifensee“ ist nicht nur in der deutschen Novellistik, sondern auch in Keller's Werken ein Juwel. K. hat dabei nach der Schilderung gearbeitet, die dem Landvogt Salomon Landolt durch David Heß (1820) zu Theil geworden war. Viele Züge entnahm er direct dieser Vorlage; die Hauptidee aber, den alten Junggesellen eine Versammlung seiner alten „Flammen" abhalten zu lassen, ist Keller's Eigenthum, ihre Ausführung in den Capiteln „Distelfink", „Hanswurstel", „Kapitän", „Grasmücke und Amsel“ das originellste Capriccio des Dichters, der es „die lieblichste der Dichtersünden“ genannt hat,
„Süße Frauenbilder zu erfinden Wie die bittre Erde sie nicht hegt.“
Wir erfahren dann die weiteren Schicksale des Herrn Jacques und bekommen noch, außerhalb des damit geschlossenen Rahmens, „Das Fähnlein der sieben Aufrechten" und die farbensatte Novelle „Ursula“. Diese hätte ursprünglich „Hansli Gyr“ heißen und eine Seldwyler Geschichte werden sollen. Mit voller Darstellungskraft wird darin das Zürcher Wiedertäuferwesen im Beginne der Reformationszeit geschildert, und mitten drin stehen Ursula und Hans Gyr: sie seine Retterin auf dem Kappeler Felde, seine Liebe Ursula's Erlöserin aus Banden des religiösen Irrwahns. Die Erzählung enthält eine Scene von monumentaler Kraft: Zwingli's Tod. Sie ist, aus der Hand eines Schweizers, ein Denkmal des schweizerischen Reformators aere perennius. — Zum Dank für die Zürcher Novellen schenkte Zürich dem Dichter das Ehrenbürgerrecht. Er hatte auch thatsächlich die Vergangenheit seiner Heimath dargestellt, wie kein „Heimathkünstler“ vor, neben und nach ihm sein Land poetisch behandelt hat. Es war „Leben aus Tod“. Leben, das die Schweizer als einen lebendigsten Theil des ihrigen empfinden, war ihnen da aus Künstlerhand neu vor Augen geschaffen und geschenkt worden.
Auch zur Lyrik fand K. auf dem „Bürgli" neue Stimmung: im Januar 1879 entstand das „Abendlied": „Augen meine lieben Fensterlein", wo die Resignation des Alternden restlos in Poesie aufgeht. „Das reinste Gold der Lyrik“ hat, wie schon erwähnt, Storm dieses Gedicht genannt, und er ist nicht müde geworden, es den Seinen vorzulesen. Dann die phantasievolle Duett-Ballade „Tod und Dichter“, ferner „Der Narr des Grafen von Zimmern", wo Keller's Humor Heiliges umklingelt, ohne es zu profaniren: ein Seitenstück in Versen zu den Prosa-Kleinoden der „sieben Legenden“. Daneben gab's kurze poetische Satiren wie „Venus von Milo“ und „Ratzenburg": da nimmt K. die ganzen Kunstwartkämpfe für Haus- und Städte-Aesthetik voraus und zwar gleich mit jenem souveränen Humor, der wirksamer ist als die ernsteste Predigt. — Nochmals sei hier kurz der Umarbeitung des „Grünen Heinrich" (1878—1880) gedacht; von komischer „Consequenz" des Dichters zeugt es, daß auch diesmal der vierte Band auf sich warten ließ und erst 1880 nachgeliefert werden konnte. Fast gleichzeitig erschien der schon 1851 geplante, 1855 erstmals in Angriff genommene „Galatea-Cyklus“ unter dem Titel „Das Sinngedicht“. K. schrieb ruhig da weiter, wo er 25 Jahre vorher abgebrochen hatte, um, wie er sagte, die Conceptionen des Dreißigers als Fünfziger auszuführen, nachdem „die Lebenstrübe sich gesetzt“ habe. Aus dem Duncker’schen Verlag gelöst, erschienen die 6 Novellen zuerst in der „Deutschen Rundschau“ (Juni—Mai 1881), dann (1882) als Buch (mit nicht allzu glücklich erweitertem Schlüsse) bei Wilh. Hertz in Berlin. Es sind eigentlich 7 Geschichten; denn die Rahmenerzählung von dem jungen Naturforscher Reinhart, der auszieht, um die Wahrheit des Logau’schen Sinngedichtes zu erproben,
„Wie willst du weiße Lilien zu rothen Rosen machen? Küß eine weiße Galathee: sie wird erröthend lachen.“
ist selbst eine Novelle, die mit ihrem romantischen Ductus, mit ihrer Poesie vor allem, sich, ohne zu verblassen, direct neben Eichendorff's „Taugenichts" stellen läßt. Reinhart kommt auf das Landhaus Luciens und dort werden nun die 6 Novellen erzählt, theils von ihm, theils von ihr: sie behandeln das Thema der Ehe. In der ersten „Von einer thörichten Jungfrau" erzählt Lucie von dem aus Eigensinn und Thorheit gelösten Verlöbniß der Wirthstochter Salome, die allzuhoch hinaus wollte. „Gleichheit des Standes und des Geistes“, meint Lucie, seien unentbehrlich zum Glück der Ehe. Sie zu widerlegen, erzählt Reinhart die Geschichte „Regine“. Regine ist ein Bauernkind und Magd in der Stadt; ihr Liebhaber und Gemahl, Erwin|Altenauer, ist Gesandtschaftssecretär. Sie leben glücklich, bis, herangeführt durch Welt und Bildung, der Zweifel zwischen die beiden Gatten tritt. Das Vertrauen schwindet; Regine wird innerlich tief unglücklich und gibt sich den Tod. Lucie schreibt dem Manne allein die Schuld zu. Herr Altenauer habe nicht verstanden „seiner Frauenausbildung den rechten Rückgrat zu geben". Reinhart „beweist“ weiter, indem er die Geschichte von der „Armen Baronin“ Hedwig v. Lohausen erzählt, d. h. von der verschämten Armen, die von einem ihre streng verborgenen Herzensvorzüge fast zufällig entdeckenden Manne dem Leben und dem Glücke zurückgegeben wird. Bei der Hochzeit läßt dann K. den Lump von früherem Gemahl der Baronin und ihre verkommenen Brüder auf fürchterlich drastische Art verspotten. Man hat den Dichter darum scharf getadelt. Er hat aber auch einem Storm gegenüber (Briefwechsel ed. Köster S. 111 und 125) daran festgehalten: „Die Geschichte mit den verlumpten Baronen, die Sie so geärgert hat, bleibt stehen, wie einer jener verwünschten Dachziegel in einem Hause, in dem es spukt“. K. hat recht gehabt: sein Humor ist so, daß er manchmal barocke Capriolen machen muß, hart bis an die Grenze des guten Geschmacks; aber das gehört zum Leben und Wesen gerade dieses Humors, und wer möchte ihn im Grunde anders haben? Er ist und bleibt eben Kellerisch, d. h. Nummer Eins. Lucie ist nicht zufrieden, daß die Frauen so ohne einen „Rest von eigenem Willen" geheirathet werden sollen. Es geht auch manchmal umgekehrt. Um dies zu erweisen erzählt Lucie's Oheim, der alte Oberst, aus seinem Leben die Geschichte „Die Geisterseher", wo eine von zwei jungen Männern geliebte Dame den Gefühlsüberschwänglichen verschmäht und den Nüchternen heirathet, weil dieser sich bei einem zur Prüfung veranstalteten Geisterspuk kaltblütig gezeigt hat. Der glückliche Brautgewinner war Reinhart's Vater. Der Sohn revanchirt sich mit der Novelle von „Don Correa", dem portugiesischen Admiral, der, von einer schlimmen Frau vornehmen Standes betrogen, sie aufhängen läßt und dann eine Afrikanerin heirathet, mit der er glücklich wird. Lucie ist endlich zufrieden; aber sie antwortet noch mit einer Geschichte, wo der Mann, der frei und originell zu wählen glaubt, heillos genasführt wird; sie erzählt die Posse „Die Berlocken": Da meint Herr Thibaut v. Vallormes er werde von der Indianerin Quoneschi geliebt und schenkt ihr seine Berlocken als Brautgabe. Andern Tages aber muß er einem Feste beiwohnen, bei welchem Quoneschi's wirklicher Verlobter, ein junger Indianer, der „Donner-Bär", die Verlocken Thibaut's als Nasenschmuck trägt. Der Schluß der Rahmenerzählung, in welche die 6 Novellen so geschickt verflochten sind, daß sie nur wie Theile eines reichorganisirten Ganzen erscheinen, ist wieder vom Anmuthigsten, was je auf Deutsch geschrieben worden ist: das Experiment auf das Recept des alten Logau gelingt nämlich Reinhart und zwar bei Lucien: er küßt sie; sie lacht und erröthet, und um diesen Kuß und dieses erröthende Lachen herum glüht ein goldener Herbst und steht das Idyll einer Schusterstube voll Glück, Gesang und Liebe. Reife Meisterschaft ist die Signatur dieses Cyklus. Sind auch nicht alle Novellen darin von gleichem künstlerischem Werthe ("Don Correa" und „Die Berlocken" sind eher nur gute „Winterschwänke“ als psychologisch tiefgründige Lebensschilderungen), so leuchtet der ganze Cyklus doch von satten Farben; aus seinen Seelenzügen und trefflich gekennzeichneten Charakteranlagen wachsen die Handlungen hervor, und ein Humor, überhaupt ein klares Licht, scheint so hell und goldig über Allem, namentlich über der frei und leicht erfundenen echt romantischen Rahmenerzählung, daß die Vorliebe, die gerade dieser Band bei vielen Keller-Verehrern genießt, recht wohl zu begreifen ist. In der Gesammtausgabe ist er (als Bd. VII) außerdem mit den „Legenden“ verbunden.
Seit 1881 sichtete der Dichter seine Lyrik. Seinem gereiften Kunstgeschmacke, dem das Objectiv-Epische höchste künstlerische Forderung geworden war, opferte er dabei alles zu Subjective, zu Leidenschaftliche, nach seiner ruhig und klar gewordenen Empfindung zu Maßlose. Er hat damit seine „Gesammelten Gedichte“ von 1883 künstlerisch gewiß gehoben; es ist auch sicherlich Manches ohne Schaden weggefallen, und mehr als eine Umarbeitung war recht wohl angebracht; aber — das rein Lyrische, das subjectiv Empfindungs-Unmittelbare hat darunter gelitten; der allerfeinste Duft der Seelenstimmung ist dann und wann von dem glättenden Finger weggewischt worden. Dennoch ist Keller's Lyrik — auch in der neuen Form — von edler Tiefe und Reinheit in Gefühl und Ton, und den Kennern des Echten wird K. immer zu den wenigen ganz großen deutschen Lyrikern, d. h. zu den Goethe, Kerner, Mörike und Storm, gehören. Im October 1876 hatte K. seine letzte größere Reise unternommen: er war, speciell auf P. Heyse's Betreiben, nochmals in München gewesen; im Herbst 1881 machte er dann mit zwei Freunden, den Malern Rud. Koller und Emil Rittmeyer, das „bescheidene Kunstreischen“, das er in der „Neuen Zürcher Zeitung“ so ruhevoll und doch so lebendig beschrieben hat (Nachgelass. Schr. S. 218). Zu Keller's auswärtigen Freunden gesellten sich in jener Zeit zwei Norddeutsche: Regierungsrath Wilh. Petersen in Schleswig und Theodor Storm in Husum; mit Beiden hat K. in intimem Briefwechsel gestanden (ed. Bächtold und — für Storm — A. Köster). Im Herbst 1882 zog K. aus dem luftigen „Bürgli“, wo sich namentlich seine kränkelnde Schwester, die ihm den Haushalt führte, nicht wohl befand, nach dem Thaleck am Zeltweg in Hottingen, in eine gewöhnliche Miethswohnung, in der es ihm nie recht gefallen hat. Um so wohler war ihm an Samstag- und Sonntag-Abenden auf der „Meise“ in gemüthlicher Gesellschaft. Bächtold erzählt da (Bd. III, S. 293 ff.) viel von Keller's Sympathien und Antipathien: von seinen Freunden, mit denen er heimelig war, aber auch von unbequemen Anreisern, die er manchmal recht grob abtrumpfte.
Keller's Schlußdichtung war „Martin Salander“, ein Familienroman, der sich aber zum schweizerischen Sittenbilde großen Stiles erweitert, ja mehr als das: der zum politischen und ethischen Erziehungsbuche für das Schweizervolk wird, dessen Lebensäußerungen Keller's eigenes tiefes Interesse ein ganzes Leben lang gegolten hat. Der alternde Mann sah in politischen und gesellschaftlichen Dingen Vieles wanken, sah die Streber emporkommen, sah ihre Charakterlosigkeit, und davor sein geliebtes Volk zu warnen, das war seine Absicht. Der Roman erschien — langsam — im J. 1886 in Rodenberg's „Deutscher Rundschau“. Er ist nicht in freudigem Zuge entstanden, sondern unter vielem Schimpfen von des Verfassers, unter freundlichem Drängen von des Herausgebers Seite. Und als er fertig war, befriedigte er nicht. Die Schweizer nannten ihn pessimistisch, das Ausland fand ihn zu speciell schweizerisch. Der Held, Martin Salander, ist ein Optimist, aber er ist nicht klug genug für den neuen Kurs. Ein Schlauer, Louis Wohlwend, bringt ihn um sein Geld; er wandert aus und kehrt erst nach sieben Jahren heim, wohlhabend, aber nicht gewitzigter, so daß ihn derselbe honigsüße Schönredner Wohlwend nochmals um sein Geld betrügen kann. Er geht neuerdings auf drei Jahre übers Meer. Nach seiner abermaligen Rückkehr will er sich an den neuen Zuständen im Vaterlande freuen; aber er muß sehen, wie Alles corrumpirt ist. Zwei Streber geringster Sorte, die Brüder Weidelich, heirathen seine Töchter; die Schufte von Gatten kommen aber ins Zuchthaus. Doch Salander's Idealismus zerbricht nicht; er verliebt sich sogar ein bischen. Da kommt sein Sohn Arnold aus der Fremde heim, ein tüchtiger Mensch. Unter|dessen Einfluß gehen ihm die Augen auf; aber er bleibt ein Optimist: Sein „Schifflein fuhr ruhig zwischen Gegenwart und Zukunft dahin, des Sturms wie des Friedens gewärtig, aber stets mit guten Hoffnungen beladen“, heißt es schließlich von ihm. Einen rechten Schluß hat das Werk trotz den beiden in der Buchausgabe hinzugefügten Capiteln, 20 und 21, nicht, und K. hat bis an sein Ende an einem neuen, besseren Schluß herumgedacht. An Charakteristik lebendiger Menschen aber: Salander's, seiner wackeren Frau und seines Sohnes Arnold, der Weidelichs und ihrer Eltern ist das Buch so reich wie irgend ein früheres des Dichters. Auch der kräftige, männliche Stil ist so „kellerisch" wie je. Der Humor allerdings hat einen etwas säuerlichen Beigeschmack, und die Composition leidet an Längen. Pessimistisch ist das Buch im Grunde nicht; es ist im Gegentheil, nach Bächtold's treffendem Ausdruck, „eine That. Es ist das große Vermächtniß des Dichters für seine Heimath ... Ein politisches Erbauungsbuch! Und doch ein Poesiebuch!“ Nach dem „Salander“ schrieb K. für den Druck nur noch eine kleine autobiographische Skizze für die Chronik der Kirchgemeinde Neumünster (Nachgel. Schr. S. 1); das dort statt des Schlusses des „Salander“ in Aussicht gestellte „selbständige Buch“ ist nicht mehr geschrieben worden. Im März 1885 ging der Gesammtverlag von Keller's Schriften an Wilh. Hertz in Berlin über. (Seit 1901 ist der Verlag in den Händen der J. G. Cotta’schen Buchhdlg. Nachf. in Stuttgart.)
Keller's Wanderung
„auf dem Abendfeld, Nur dem sinkenden Gestirn gesellt“
wurde beschwerlicher. Noch allerdings trat ihm ein neuer Freund nahe: Böcklin, der damals in Zürich wohnte und mit seiner olympischen Heiterkeit den oft Launenhaften und Mürrischen aufheiterte; der mit nie versagender Freundlichkeit die Ausbrüche übler Laune ertrug, und der froh war, wenn auch bei K. wieder auf Augenblicke die Sonne schien. K. hat dafür dem Maler-Freunde zum 60. Geburtstage ein prächtiges, leuchtend schönes, in milder Resignation ausklingendes Gedicht geschrieben (bei Bächtold III, S. 647). Böcklin hat den Freund mehrmals gemalt; aus seiner Hand stammt die Radirung, die den 1889 bei Hertz erschienenen „Gesammelten Werken“ vorgeheftet ist. Am 6. October 1838 starb dem Dichter die Schwester Regula, die ihn so lange treu gepflegt hatte. Er war nun ganz einsam. Seinen 70. Geburtstag verbrachte er auf dem Seelisberg in Gesellschaft zweier Freunde, Arnold Böcklin's und des Bundesrichters Hans Weber. Die von Böcklin modellirte Medaille nannte er „das Zeichen für das Ende vom Lied“. Nach Neujahr 1890 erkrankte er an Influenza; er machte sein Testament und setzte darin zu Erben den Hochschulfonds der Universität Zürich, die Zürcher Stadtbibliothek und die eidgenössische Winkelriedstiftung ein. Am 15. Juli 1890 starb er; am Vorabend seines 71. Geburtstages (18. Juli 1890) wurde er durch Feuer bestattet. — K. ist in Vielem ein „Heimathkünstler“ gewesen; aber er hat zugleich weit über das Heimathliche hinaus, ins rein Menschliche hinein geschaffen. Seine Werke sind die schönste Frucht jenes deutschen Realismus, der auch das Ideale in sich schließt, d. h. sie sind echte große Kunst. Diese ist Offenbarung: nicht „von dieser Welt“ wenn man will; aber sie steht doch auf dem Boden der Erde, ist Wahrheit im Lichte des Ewigen.
-
Literatur
Die Litteratur über Keller ist verzeichnet bei Richard M. Meyer, Grundriß der neuern deutschen Litteraturgeschichte (Berlin 1902), Nr. 2662 bis 2636. Neu hinzugekommen sind: Ricarda Huch, „G. K.“ i. d. Samml. „Die Dichtung“ Bd. IX, Berlin; Otto Stoeßl, „G. K.“ i. d. Samml. „Die Literatur“ Bd. X, Berlin. Ferner zu beachten: „Der Briefwchsel zwischen|Theod. Storm u. G. K.“, hrsg. u. erläut. v. Albert Köster, Berlin 1904. Hnr. Driesmanns, „Der Erziehungsroman“ ("Grün. Heinr.") Literar. Echo 1902/3, S. 1525; Ernst Trautmann, „G. K. in Heidelberg“ (Frkf. Ztg. 1903, Nr. 108). Emil Jakobs, „Aus G. K.s Berliner Zeit“ (Westermanns Monatsh. Oct. 1904); „Emil Kuh's Briefe an G. K.“ ed. Alfr. Schaer i. Zürch. Taschenb. auf 1904; A. Schwab, „Das Sinngedicht von G. K.“ (Monatsbl. f. dtsch. Lit. IX, 9); F. Wichmann, „G. K.s Frauengestalten“ (Propyläen, München 87, 88); Max Nußberger, „Der Landvogt von Greifensee u. seine Quellen" (Frauenfeld 1904); Marie Strinz, „Irdische u. himmlische Liebe“ ("Die Frau“, Berlin, XI, 10); Emil Geiger, „Beiträge zu einer Aesthetik der Lyrik“ (Halle 1905); Felix Rosenberg, „Der schlimm-heilige Vitalis“ von G. K. und „Thais“ von Anatole France (Archiv f. d. Stud. d. neueren Sprachen u. Literaturen, Bd. 112 [neue Serie 12], Heft 3/4.) Hauptwerk bleibt immer: G. K.'s Leben. Seine Briefe und Tagebücher. Von Jakob Bächtold. 3 Bde. Berlin 1894—97. Auch die gegenwärtige Biographie ruht auf diesem festen Fundamente.
-
Autor/in
Geßler. -
Zitierweise
Geßler, Albert, "Keller , Gottfried" in: Allgemeine Deutsche Biographie 51 (1906), S. 486-505 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd11856109X.html#adbcontent