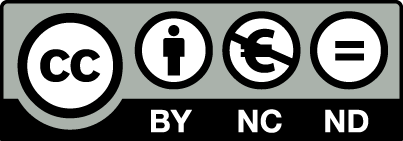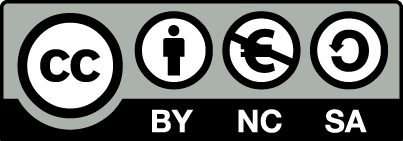Lassalle, Ferdinand
- Lebensdaten
- 1825 – 1864
- Geburtsort
- Breslau
- Sterbeort
- Genf
- Beruf/Funktion
- Theoretiker und Organisator der deutschen Arbeiterbewegung ; Politiker ; Nationalökonom ; Arbeiterführer ; Volkswirt ; Publizist ; Schriftsteller
- Konfession
- jüdisch?
- Normdaten
- GND: 118569910 | OGND | VIAF: 12310979
- Namensvarianten
-
- Lassal, Ferdinand (bis 1846)
- Lassalle, Ferdinand
- Lassal, Ferdinand (bis 1846)
- lassal, ferdinand
- Lassalle, Ferdinand Johann Gottlieb
- Lassal, Ferdinand Johann Gottlieb
- Lassalle, Ferdinand J.
- Lassalle, Ferdynand
- Lassalle, Ferd.
- Lassalle, Fernando
- Lassale, Ferdinand
- Lassalʹ, Ferdinand
- Lassal, F.
- Lasalle, Ferdinand
- Lasal, Ferdinand
- Lasaer
- Lasa'er
- La sa er
- La-sa-erh
- Ljassal', Ferdinand
- לאסאל, פערדינאנד
- לאסאל, פרידנאנד בן חיים
- Лассаль, Фердинанд
- ラサール
- フェルディナント・ラッサール
- 拉萨尔
- 拉撒尒
- 拉撒爾
Vernetzte Angebote
- LeMO - Lebendiges Museum Online [1998]
- Frankfurter Personenlexikon [2014-]
- Verbannte und Verbrannte. Die Liste der im Nationalsozialismus verbotenen Publikationen und Autoren. [2013]
- * Filmportal [2010-]
- Personen im Wien Geschichte Wiki [2012-]
- * Sächsische Biografie [1999-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1982] Autor/in: Fetscher, Iring (1982)
- R. Eisler: Philosophen-Lexikon. 1912 (zeno.org) [1912]
- I. Singer (Hg.): Jewish Encyclopedia. 1901-1906 [1901-1906]
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Plener, Ernst Freiherr von (1883)
- Blue Mountain. Historic Avant-Garde Periodicals for Digital Research [2017-]
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Personen im Personenverzeichnis der Fraktionsprotokolle KGParl [1949-]
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte
- Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- * Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
- * Ferdinand Lassalle - Briefe aus dem Nachlass
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Archivportal - D
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Frankfurter Personenlexikon [2014-]
- Personen im Wien Geschichte Wiki [2012-]
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
- NDB 4 (1959), S. 27 (Dönniges, Marie Josephine Helene, von,)
- NDB 5 (1961), S. 454* (Friedländer, Max)
- NDB 16 (1990), S. 338 (Marx, Karl)
- NDB 16 (1990), S. 343 (Marx, Karl)
- NDB 16 (1990), S. 624 (Mehring, Franz)
- NDB 17 (1994), S. 45 (Mendelssohn)
- NDB 20 (2001), S. 529 (Plener, Ernst Freiherr von)
- NDB 21 (2003), S. 689 in Artikel Rodbert (Rodbert, Johann Karl)
- NDB 22 (2005), S. 71 in Artikel Rosenkranz (Rosenkranz, Johann Karl Friedrich)
- NDB 22 (2005), S. 228 (Rüstow, Friedrich Wilhelm)
- NDB 22 (2005), S. 657 (Schelling, Ludwig Hermann von)
- NDB 23 (2007), S. 394 in Artikel Schönberg (Schönberg, Gustav Friedrich von)
- NDB 23 (2007), S. 198 (Schmidt, Heinrich Julian Aurel)
- NDB 23 (2007), S. 731 (Schulze-Delitzsch, Franz Hermann)
- NDB 23 (2007), S. 740 (Schumacher, Kurt Ernst Karl)
- NDB 24 (2010), S. 60 in Artikel Schweitzer
- NDB 25 (2013), S. 100 in Artikel Steck
- NDB 26 (2016), S. 321 in Artikel Tölcke (Tölcke (Tölke, Töllcke), Carl Wilhelm)
- NDB 26 (2016), S. 690 in Artikel Vahlteich (Vahlteich, Carl Julius)
- NDB 27 (2020), S. 328 (Walesrode, Ludwig Reinhold)
- NDB 28 (2024), S. 561 in Artikel Wuttke (Wuttke, Johann Karl Heinrich)
- NDB 28 (2024), S. 571-572 in Artikel York
- NDB 28 (2024), S. 571 (York, Carl Theodor)
- NDB 28 (2024), S. 614 (Zeeden, Ernst Walter)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Lassalle (Namensänderung 1846), Ferdinand
Theoretiker und Organisator der deutschen Arbeiterbewegung, * 11.4.1825 Breslau, † 31.8.1864 Genf, ⚰ Breslau, Alter Jüdischer Friedhof.
-
Genealogie
V →Heyman Lassal (1791–1862), Seidenhändler, Stadtrat in B., S d. Feitel Wolfsohn (Braun) in Berun b. Pleß;
M Rosalie Heitzfeld (1797–1870), T d. Mendel Oppenheim, aus Heidingsfeld b. Würzburg (jüd. „Heitzfeld“ gen.), Handelsmann in Glogau;
Schw Friederike (⚭ Ferdinand Friedländer, 1865 österr. Adel als Rr. v. Friedland,|1810-68, Gründer d. Neuen Freien Presse u. Kurator d. Österr. Mus. f. Kunst u. Industrie, Gründer e. Gasges. in Prag); - ledig. -
Biographie
Die geistige Entwicklung L.s wurde außerordentlich früh abgeschlossen. Als ihm zu Ostern 1842 das Zeugnis der Reife aus bürokratischer Willkür verweigert wurde, stürzte er sich für ein Jahr auf die intensive Lektüre philosophischer Schriften, vor allem derjenigen Hegels, und übernahm die – revolutionär gewendete – Geschichtsphilosophie Hegels als unverrückbaren Maßstab seiner Orientierung. In einem Brief an den Vater, der ihn – wenn auch widerstrebend – seinen eigenen Weg gehen ließ, schreibt er: „Es gibt keine (gemeint: neue) Phase mehr für mich, denn ich habe die höchste des gegenwärtigen Geistes erreicht und kann mich nur innerhalb dieser, d. h. quantitativ, ausbilden.“ Diese Einschätzung verdanke er der Philosophie Hegels, sie habe ihm „alles gegeben, Klarheit, Selbstbewußtsein, zum Inhalt die absoluten Mächte des menschlichen Geistes, die objektiven Substanzen der Sittlichkeit, der Vernunft etc.“, kurz, sie habe ihn zum selbstbewußten Gott, d. h. zu dem sich als Erscheinungsform und Verwirklichung des Göttlichen begreifenden Geist gemacht. Und „wer einmal Gott war, wird nie wieder ein dummer Junge“. L. akzeptierte nicht nur die Hegelsche Philosophie, er identifizierte sich auch mit ihr und verstand sie – in enthusiastischem Überschwang – als Bestätigung für die Übereinstimmung seines subjektiven Selbstbewußtseins mit dem „objektiven Geist“.
Während der ersten Semester des Studiums der Philosophie und Geschichte in Breslau (1843/44) entwarf L. den Plan einer Reformbewegung des Judentums, die dessen Partikularität – im Geiste Hegels – in der allgemeinen Philosophie überwinden und aufheben sollte. Trotz einer oft zitierten Tagebuchstelle aus dem Jahre 1840, in der L. davon gesprochen hatte, es sei immer seine Lieblingsidee gewesen, „an der Spitze der Juden, mit der Waffe in der Hand, sie selbständig zu machen“, hat sich L. für die Judenemanzipation nur wenig interessiert. Ähnlich wie Marx kam es ihm bei seiner demokratisch-revolutionären Zielsetzung letztlich auf die „Befreiung der Menschheit“ an, wobei er allerdings – analog zu Fichte – die Hoffnung hegte, die Deutschen würden zu den erfolgreichen Wegbereitern dieser Befreiung werden. In Breslau suchte L. – im Rahmen der Burschenschaft – für die Demokratie zu agitieren und bildete einen ersten Freundeskreis. 1844/45 studierte er in Berlin und kam in ausführlichen Manuskriptbriefen an die Eltern zu einer Art Abschluß seiner Bildung. Im Sommersemester 1845 studierte er wieder in Breslau. Grundzüge der erst 1857 publizierten Schrift „Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos, nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten“ entstanden in dieser Zeit. In einem „Kriegsmanifest an die Welt“ formulierte er erstmals seine Vorstellung vom „Reich des freien Geistes“ – seinem Reich – und schwor einige Freunde auf es ein.
Da L. als Jude an eine Universitätslaufbahn nicht denken konnte (er wäre lebenslänglich Privatdozent geblieben) und da er sich nicht (etwa als Journalist) „verkaufen“ wollte, strebte er zugleich nach finanzieller Unabhängigkeit. Der beginnende Industrialismus sollte ihm die Mittel liefern, sich in voller Freiheit der Sache der entschiedenen Demokratie widmen zu können. Aus diesem Grunde wirkte er auch am Zustandekommen der Prager Gasgesellschaft (im Winter 1845/46) mit und suchte bei einem Besuch in Paris, zusammen mit seinem Schwager Friedländer, →Heinrich Heine für seine Beteiligung zu gewinnen. Heine, der durch den Tod seines Onkels →Salomon Heine, von dem er eine testamentarisch nicht abgesicherte Rente bezogen hatte, in Schwierigkeiten gekommen war, wollte sich gern der Hilfe des aktiven jungen Mannes in seinen Erbschaftsangelegenheiten bedienen und schickte ihn mit einem berühmt gewordenen Empfehlungsschreiben an Varnhagen von Ense. Anfang 1849 – als L. inhaftiert war – hat Marx diesen Brief in der „Neuen Rhein. Zeitung“ zusammen mit einem Kommentar publiziert und damit ungewollt wesentlich dem späteren Lassalle-Kult die Wege geebnet. Heine schrieb u. a.: „Herr Lassalle, der Ihnen diesen Brief bringt, ist ein junger Mann von den ausgezeichnetsten Geistesgaben: mit der gründlichsten Gelehrsamkeit, mit dem weitesten Wissen, mit dem größten Scharfsinn, der mir je vorgekommen; mit der reichsten Begabnis in der Darstellung verbindet er eine Energie des Willens und eine Habilité im Handeln, die mich in Erstaunen setzen.“ Zugleich spürte Heine freilich auch in diesem jungen Mann den Boten einer Zeit, mit der er sich – bei allem Wohlwollen – doch nicht ganz einverstanden wußte: „Herr Lassalle ist nun einmal so ein ausgeprägter Sohn der neuen Zeit, der nichts von jener Entsagung und Bescheidenheit wissen will, womit wir uns mehr oder minder heuchlerisch in unserer Zeit hindurchgelungert und hindurchgefaselt. Dieses neue Geschlecht will genießen und sich geltend machen im Sichtbaren; wir die Alten waren doch vielleicht glücklicher als jene harten Gladiatoren, die so stolz dem Kampftode entgegengehen.“
L.s Wirken für Heine war nicht ganz ohne Wirkung; da Heine jedoch selbst immer wieder taktische Wendungen machte, von denen L. nichts wußte, hatte er keinen durchschlagenden Erfolg, auch gelang es ihm nicht, Heine nach Berlin zu bringen. Immerhin kam durch L. eine Versöhnung mit →Giacomo Meyerbeer zustande, der bereit war, eine Rentenzusage des reichen Onkels zu beeiden, und Hermann Fürst Pückler-Muskau schrieb einen ausgezeichneten, hochherzigen Brief an den Erben Karl Heine, den er auch zur Veröffentlichung freigab. L. hat die Angelegenheit der Heineschen Erbauseinandersetzung immer auch als politisch angesehen. Die Art und Weise, wie das wohlhabende, liberale Bürgertum mit dem größten lebenden deutschen Dichter umging, war ihm ein Lehrstück, das der Aufklärung des Volkes und seiner Abkehr von den Liberalen dienen sollte.
Der Heinesche Erbschaftsstreit war noch nicht vergessen, da nahm sich L. der Auseinandersetzung der Gräfin Sophie Hatzfeldt mit ihrem Gatten Edmund an. Die zahlreichen Prozesse, in denen L. als Bevollmächtigter der Gräfin fungierte, und die Verfolgungen, denen er ihretwegen ausgesetzt war, haben ihn im Rheinland populär gemacht. Motiv für dieses – erst mit einem im Aug. 1854 abgeschlossenen Vergleich beendete – Engagement war einmal die Möglichkeit, am Beispiel des skrupellosen Lebemanns und geldgierigen Grafen die „Fäulnis“ der bestehenden Gesellschaft aufzuzeigen und zum anderen durchaus auch die finanzielle Sicherung der eignen Existenz, die L., der bis dahin vom Vater geldlich unterstützt worden war, schließlich auf diesem Weg erreicht hat. Im Verlauf dieser Prozesse erwarb sich L. eine profunde Kenntnis der existierenden Rechtsordnung und -praxis und wurde zum brillanten Verteidigungsredner in fremder wie in eigener Sache. Als im Zusammenhang mit dem Versuch, Belege für finanzielle Zusicherungen des Grafen an seine Mätresse Meyendorf(f) zu beschaffen, Felix Alexander Oppenheim, ein Freund und zeitweiliger „Jünger“ L.s, eine Kassette aus deren Besitz entwendet hatte, wurde L. selbst wegen „intellektueller Urheberschaft des Kassettendiebstahls“ vor Gericht gestellt. Von Februar bis August 1848 war L. wegen dieses angeblichen Delikts in Untersuchungshaft. Die Gräfin Hatzfeldt, ihr Sohn Paul und die Neue Rhein. Zeitung sowie demokratische Vereinigungen in Düsseldorf und Köln bemühten sich um eine Beschleunigung des Verfahrens, das – wie man gewiß war – mit dem Freispruch enden mußte. In seiner Gerichtsrede suchte L. den Tendenzcharakter der Anklage und ihre politische Bedeutung herauszuarbeiten, während es dem Staatsanwalt wie dem Gericht darauf ankam, ihn als „gewöhnlichen Verbrecher“ abzustempeln. Während die Geschworenen zu keinem eindeutigen Entlastungsspruch kamen, mußte das Gericht schließlich auf Freispruch erkennen. Der Makel eines zweifelhaften Ehrenmannes sollte L. jedoch zeitlebens bleiben. Daran hatten auch die besten Zeugenaussagen zu seinen Gunsten und die Selbstwidersprüche der Belastungszeugen nichts ändern können.
Während der Revolution von 1848/49 stand L., wie auch die Gräfin Hatzfeldt und ihr Sohn, eindeutig auf Seiten der entschiedenen Demokratie, wie sie auch die Neue Rhein. Zeitung von Marx vertrat. L. lernte Marx damals kennen und wurde einer seiner wenigen Duzfreunde, was jedoch die spätere Entfremdung nicht verhindert hat. Beide waren überzeugt, daß in Deutschland erst die „bürgerliche Revolution“ auf der Tagesordnung stehe, daß es aber nötig und nützlich sei, wenn „das Volk“ (Kleinbürger und Arbeiter) einen entsprechenden Druck auf Volksvertretung und Regierung ausübte. In Düsseldorf arbeitete L. eng mit dem angesehenen Kaufmann und Kommandanten der Bürgerwehr Lorenz Cantador (1810–83) zusammen. Im Herbst 1848 lag die reale politische Macht in Düsseldorf vorübergehend ganz in den Händen der Demokraten und ihrer Bürgerwehr, selbst der Regierungspräsident nahm die Anordnungen der Bürgerwehr hin, die Sache der Demokraten und ihres Widerstands gegen „illegale Maßnahmen der preuß. Regierung“ wurde sogar von einer Reihe leitender Beamter unterstützt. Mit der Verhängung des Belagerungszustands und der Verhaftung L.s am 22.11. war alles zu Ende. Auf einer Massenversammlung unter freiem Himmel in Neuß hatte L. noch am Tag zuvor Unterstützung für die Düsseldorfer Demokraten zu mobilisieren gesucht. Erst im Mai 1849 wurde er von der Anklage, „die Bürger zur Bewaffnung gegen königliche Gewalt“ aufgereizt zu haben, freigesprochen, jedoch sofort „wagen Beleidigung des Generalprokurators“ erneut in Untersuchungshaft genommen sowie schließlich zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, deren Vollzug zeitweilig ausgesetzt wurde.
Durch seine Reden und mehr wohl noch durch die Verfolgungen, denen er ausgesetzt war, ist L. zu einer Art Volksheld der demokratischen Revolution im Rheinland geworden. Obwohl er bereits seit langem zutiefst von der Sache des „Kommunismus“ überzeugt war, hat er sich während dieser Jahre jeder über das Ziel der Demokratie und des „allgemeinen und gleichen Wahlrechts“ hinausgehenden Forderung enthalten. Seine Plädoyers verbanden stets die Respektierung geltenden Rechts mit geschichtsphilosophischen Reflexionen, deren Tragweite freilich viele seiner Zuhörer nicht verstanden haben dürften. So lehnte L. die Legitimität der gegen ihn erhobenen Anklage im Mai 1849 mit der Begründung ab, die vom König faktisch – wider geltendes Recht – oktroyierte Verfassung vom 18.3.1849 sei eine Revolution gewesen. Daher sei er auch nur bereit, einem Revolutionstribunal Rede zu stehen. Auf diesem demokratischen Rechtsformalismus beharrte L. auch in den folgenden Jahren. Jede Wahl, die nach dem oktroyierten Dreiklassen-Wahlrecht erfolgte, blieb für ihn ein Verrat an der Demokratie und stand nicht auf dem Boden des Rechts.
Während seiner Haft zwischen Okt. 1850 und April 1851 arbeitete L. eine „Geschichte der sozialen Entwicklung“ aus, die er wenig später Arbeitern in Düsseldorf vortrug. In dieser Arbeit sind zweifellos Gedanken des „Kommunistischen Manifestes“ von Marx und Engels verarbeitet, aber im Unterschied zu Marx hält L. an „einem Begriff des Rechts und Staats überhaupt“ fest, der mit seinem jeweiligen zeitbedingten Inhalt in Widerspruch stehe. Während Staat und Recht „Selbstverwirklichung des menschlichen Geistes“ sein sollten, sind sie – bislang – „Unrecht“ und „Unfreiheit“. Vor allem sei die Bourgeoisie nicht imstande, den „sittlichen Staat“ zu realisieren, weil in ihr „jeder für sich lebt“ und "die Unbeschränktheit des einzelnen das Höchste“ ist. Aus diesem Grunde konnte die bürgerliche Revolution die Freiheit und Unabhängigkeit des Volkes, der ärmeren Mehrheit der Bevölkerung, nicht realisieren. „Diese Freiheit selbst, welche die Aufhebung aller Privilegien zu sein vorgibt und auch zuerst zu sein glaubt, ist selbst nichts als die Errichtung eines neuen, und zwar des härtesten Privilegs, des Kapitalbesitzes“. Die Entwicklung werde daher erst dann ihr Ziel erreichen, wenn durch den „Arbeiterkommunismus“ die Solidarität aller verwirklicht sei. Ein König könne die soziale Gleichheit – auch wenn er wollte – nicht realisieren, weil mit der Beseitigung aller anderen Privilegien „der Thron als das einzige Privileg“ übrigbliebe, „gegen den sich nun alle Angriffe des neuen Gleichheitsprinzips richten müßten“. Das Volk könne daher seine Freiheit nur „aus seinen eignen Händen und eigner Machtvollkommenheit erhalten“.
L. korrigiert in dieser Arbeit Hegels Geschichtsphilosophie dahingehend, daß die von Hegel als bereits realisiert unterstellte Verwirklichung der Sittlichkeit im modernen, konstitutionellen Staat erst im künftigen demokratischen Staat erreicht werden wird und daß dann an die Stelle der zeitgenössischen bürgerlichen Klassengesellschaft eine solidarische Gesellschaft von Gleichen treten wird, wie sie von den utopischen Sozialisten erträumt wurde. L. fühlt sich im Besitz der Einsicht in den objektiv notwendigen Gang der historischen Entwicklung jenen Träumen und Spekulationen, aber auch den liberalen Kompromißlern überlegen. Die „sozialökonomische Basis“ der historischen Entwicklung, die Marx herausgearbeitet hat und die schon im „Manifest“ von 1848 skizziert wird, tritt bei L. hinter dem ideellen Widerspruch zwischen der „Idee des sittlichen Staates“ und des „Rechts“ und den historischen Realitäten zurück. Dieser ideelle Widerspruch ist es aber, der nach L. sowohl die Dynamik der Geschichte bewirkt als auch die Garantie der Erreichung des Zieles darstellt. Gerade weil ihm das Ziel der Entwicklung, die egalitäre Demokratie in Gestalt einer „Diktatur der Einsicht“, so klar vor Augen stand, glaubte er sich in der praktischen Tagespolitik alles erlauben zu können. Hierher gehören seine Geheimgespräche mit →Bismarck (1863, 1864) und seine Propagierung des „sozialen Königtums“ (1864), dessen Realisierung er schon aus begrifflich-logischen Gründen für unmöglich hielt, das aber Hoffnungen erwecken sollte, die zur Revolution der Enttäuschten führen konnten.
In den Jahren nach der Niederlage der Revolution von 1848/49 war L. – nicht nur in seinen eigenen Augen – einer der wenigen, die den alten Idealen der Demokratie treu blieben. Trotz seiner wiederholten Verhaftungen und Gefängnisstrafen dachte er nicht an Auswanderung. Vielmehr zog er – aus der Erkenntnis der definitiven Niederlage der Revolution im Rheinland und der Konsolidierung Preußens in der „Neuen Ära“ – die Folgerung, das Zentrum der Auseinandersetzung müsse nun nach Berlin verlegt werden. Ähnlich wie Marx kam es ihm dabei zunächst auf die Bildung und Schulung einer „Kadertruppe“ überzeugter Anhänger an. Diesem Zweck dienten auch die Vorträge, die L. auf der Basis der „Geschichte der sozialen Entwicklung“ vor Düsseldorfer Arbeitern hielt. Wenn er nunmehr offen vom „Arbeiterstand“ (oder gelegentlich auch vom „Proletariat“) und nicht mehr einfach vom „Volk“ redete, so entsprach diesem terminologischen Wechsel keine begriffliche Änderung. Gemeint war nach wie vor die Mehrheit der handarbeitenden Bevölkerung, die – angesichts des wachsenden Reichtums der industriellen Unternehmer – allerdings immer weniger Chancen hat, zu wirtschaftlicher Selbständigkeit sich emporzuarbeiten. L. hat zweifellos die Bedeutung der Ökonomie für die politischen Auseinandersetzungen erkannt und sich um eine eigene Kritik der Ökonomie bemüht, ist aber erst in seinem Todesjahr 1864 mit seiner Schrift „Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian oder: Kapital und Arbeit“ hervorgetreten. Der Kern der ökonomischen Auffassungen von L. läßt sich auf die Behauptung des sogenannten „ehernen Lohngesetzes“ und die logische Ableitung der Notwendigkeit von Arbeiterassoziationen als einzig mögliches Rettungsmittel der Lohnarbeiter reduzieren. Als „ehernes Lohngesetz“ hat L. seine Auffassung der ricardianischen Lohntheorie bezeichnet. Ihr zufolge kann die Arbeiterklasse prinzipiell keinen höheren Anteil am Sozialprodukt erhalten, als ihren reinen Selbsterhaltungskosten entspricht. Auch wenn es einen gewissen „kulturellen Spielraum“ für dieses Minimum gibt, bleibt die Schranke als solche unter der gegebenen Eigentumsordnung absolut. Der Liberalismus und sein „Nachtwächterstaat“ können daher niemals eine wirkliche Abhilfe schaffen. Nur wenn die Arbeiter als Genossenschafter zu ihren eigenen Unternehmern werden und ihnen der Staat dabei die notwendige Starthilfe gibt, kann das „eherne Lohngesetz“ gebrochen werden. Bei der Präzisierung dieser Gedanken stützte sich L. zum Teil auf Mitteilungen und Ratschläge des radikalen Politikers und Ökonomen →Johann Karl Rodbertus, der ihn allerdings vergeblich vor der Gefahr des genossenschaftlichen Egoismus warnte und auf die Notwendigkeit staatlicher zentraler Organisation der Wirtschaft verwies.
Während der 50er Jahre bemühte sich L. durch eine Reihe von schriftstellerischen und wissenschaftlichen Arbeiten um Festigung seines Ansehens in der Öffentlichkeit. Im November 1857 erschien seine schon erwähnte Arbeit über Heraklit, die ihm die Zustimmung der Berliner Hegelianer und die Mitgliedschaft in der dortigen Philosophischen Gesellschaft einbrachte. Im Oktober 1858 erhielt er die „bedingte Aufenthaltserlaubnis“ für Berlin, die er u. a. auch der Fürsprache Alexander v. Humboldts verdankt haben dürfte, den er seit dem Heine-Erbschaftsstreit kannte. Im Jahr darauf war er an der Edition der Briefe Humboldts an Varnhagen von Ense beteiligt. In einem Vortrag über „die Hegelsche und die Rosenkranzsche Logik“ in der Philosophischen Gesellschaft zeigte L. die Bedeutung der Kategorien Mechanismus, Chemismus und Zwecktätigkeit (Teleologie) in Hegels objektiver Logik für dessen Geschichtsphilosophie und kritisierte deren Eliminierung durch Rosenkranz. Die „Gültigkeit“ dieser logischen Kategorien war für L. Garant der historischen Entwicklung, ein absoluterer Garant offenbar als die bloß als Tendenz wirksamen Gesetze der „sozialökonomischen Entwicklung“ in der Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Karl Rosenkranz (1805–79) hat sich in einer besonderen Schrift mit L.s Kritik auseinandergesetzt und ihr gegenüber derjenigen von K. L. Michelet entschieden den Vorzug eingeräumt. Offenbar hat L. von allen seinen Arbeiten mit den philosophischen am meisten Zustimmung und Anerkennung gefunden.
Weit weniger Anerkennung fand L. mit seinem großen Bauernkrieg-Drama „→Franz von Sickingen“, dessen Bühnenausgabe 1858 erschien. Vor allem dürfte bei einem Teil des ihm nahestehenden Publikums die doktrinäre Ablehnung des revolutionären Charakters des Bauernkrieges Befremden erregt haben. Der Fortschritt jener Zeit lag nach L. in der Verwirklichung des einheitlichen Territorialstaates und der Überwindung des feudalen Partikularismus. Ihm gegenüber hätten die Bauern auf ihrer „an den Boden gebundenen Partikularität“ festgehalten. Aus diesem Grunde konnte sich L. auch ein Zusammengehen der aufständischen Bauern mit dem städtischen Bürgertum nicht vorstellen, wohl aber mit einzelnen Rittern wie Sickingen, die gleichfalls ein untergehendes Prinzip vertraten. Die zwischen Marx und Engels auf der einen Seite, L. auf der anderen, geführte Sickingen-Debatte betrifft diese inhaltlichen wie auch künstlerische Fragen und ist für die veränderten Beziehungen zwischen beiden Seiten aufschlußreich.
Auch wenn das Schema des objektiv-idealistischen Hegelschen Geschichtsdenkens für L. verbindlich blieb und er Fichte entsprechend historisch einordnete, hat er doch wiederholt – unmittelbar und aktualisierend – an Fichtesche Thesen angeknüpft. So z. B. besonders eindrucksvoll in dem Artikel „Fichtes politisches Vermächtnis und die neueste Gegenwart“ (1860). Der Kerngedanke dieses Aufsatzes ist, daß Deutschland nur als Einheitsstaat zu einer historischen Nation werden und kein deutscher Territorialfürst diese einheitsstiftende Rolle übernehmen kann. Eine preuß. Spitze würde nur eine der Besonderheiten Deutschlands zur herrschenden machen “und indem so auch noch diejenige Ausgleichung fortfiele, welche jetzt noch in dem Dasein der verschiedenen Besonderheiten liegt, würde grade dadurch das deutsche Volk auch noch in seiner geistigen Wurzel aufgehoben“. Wie für Fichte war „Deutschland“ auch für L. weit mehr ein Gedanke, ein philosophisches Ideal, als eine existierende Realität. Dieses letztlich abstrakte Gebilde soll aber zugleich den „sittlichen Staat“ vorbildlich verwirklichen und damit beispielgebend und ansteckend wirken. Mit Recht hat ein neuer Autor bemerkt, daß der L.sche – wie auch der Fichtesche – Gedanke eines idealen sittlichen deutschen Staates in keiner Weise als Prophetie des kommenden Bismarckschen Deutschland interpretiert werden dürfe, wie das verschiedentlich, am eindringlichsten in der großen Biographie von →Hermann Oncken geschehen ist. Indem L. Fichte weiterdenkt und aktualisiert, wird er ihm weit eher gerecht als jene, die ihn für das Bismarcksche Reich oder für den Hurra-Patriotismus des 1. Weltkriegs einzuspannen suchten. In einem anderen Fichte-Aufsatz sagt L., der Begriff des deutschen Volkes sei noch gar nicht wirklich, er sei ein Postulat der Zukunft. Dieses Postulat bedeutet für ihn die Verwirklichung des bisher unbewußt Erstrebten, „die Schaffung eines deutschen Territoriums als Basis für die gemeinsame Geschichte, als Grundlage für einen wahren deutschen Staat, der nicht mehr Besitz am Volke ist, sondern Besitz des Volkes … “ (Na'aman). Wegen seiner Fichterede am 19.5.1862 hat sich L. schließlich mit den Berliner Hegelianern überworfen, die beunruhigt das Revolutionär-Aktivistische in seinen Ausführungen herausspürten.
Als L.s wichtigste politische Schrift kann man die Arbeit „Das System der erworbenen Rechte, eine Versöhnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie“ ansehen, die 1860 und 1861 erschien. Was L. hier liefert, ist – am Beispiel der Eigentums- und Erbrechtsentwicklung – eine Geschichtsphilosophie im Sinne Hegels. Der Abbau der Besitzprivilegien stellt für ihn einen schrittweisen Befreiungsprozeß dar: Zuerst wird das unmittelbare Eigentum am Menschen (die Sklaverei), später das mittelbare (die Leibeigenschaft) und schließlich künftighin auch noch die vermittelte Verfügung über fremde Arbeit vermöge des Kapitalbesitzes abgeschafft. Mit der Einschränkung der Eigentumsrechte erweitert sich die Freiheit des Willens aller. Die solidarische Welt der Zukunft kann jedoch nur dann mit der individuellen Freiheit zusammen bestehen, „wenn der Einzelwille immer mit dem Kollektivbewußtsein zusammenfällt“ (Na'aman).
L. scheint davon überzeugt gewesen zu sein, daß durch entsprechende Aufklärungs- und Bildungsarbeit jene Übereinstimmung schließlich erreicht werden könne. Daß es seiner Auffassung von Demokratie (als „Diktatur der Einsicht“) keineswegs entsprach, die Entwicklung zufälligen Mehrheiten auszuliefern, hat er in einem Brief an Rodbertus deutlich ausgesprochen: „Sie haben ganz recht, wenn sie weder durch Majorität noch durch Stimmeneinheit sich beweisen lassen wollen, was das heutige Zeitbewußtsein will. Wie finde ich dies also? Nun, ich denke ganz einfach! Was Sie sich und der Zeit durch Vernunft und Logik, Wissenschaft beweisen können – das will die Zeit.“ „Das System der erworbenen Rechte“, das im Grunde eine Geschichtsphilosophie der entzogenen Rechte enthält, versteht L. nicht als Handbuch für Revolutionäre, sondern als streng wissenschaftliche Abhandlung. →Theodor Mommsen hat es nicht zu Unrecht als konstruiert kritisiert und ihm sachliche Irrtümer nachgewiesen. L.s philosophisches Bewußtsein konnte freilich solche Kritik kaum treffen.
Von Juli 1860 bis Jan. 1862 bereiste L. die Schweiz und Italien, wo er Kontakte zur revolutionären Einigungsbewegung aufnahm und in seiner Überzeugung von der revolutionären Potenz der nationalen Einigungsthematik bestärkt wurde. Vergeblich hat er bei dieser Gelegenheit in die große Politik einzugreifen gesucht, indem er Garibaldi zur Zerschlagung des österreich-ungarischen Kaiserreiches aufforderte, dessen Existenz ein wesentliches Hindernis für die Bildung eines einheitlichen deutschen Nationalstaates sei.
Im April 1861 besuchte Marx L. und die Gräfin Hatzfeldt in Berlin. L.s Versuch, eine Wiedereinbürgerung Marxens zu erwirken,|scheiterte, und auch der Plan einer von L. zu finanzierenden gemeinsamen Tageszeitung zerschlug sich. Marx und Engels mokierten sich insgeheim über L.s diktatorische Ansprüche als Chefredakteur, wie denn generell ihre Korrespondenz zahlreiche, oft ungerechte Schmähungen L.s enthält. Am 16.4.1862 hielt L. seine vielbeachtete (und alsbald im Druck verbreitete) Rede über die „demokratische Bedeutung des Arbeiterstandes“ („Arbeiterprogramm“) im Berliner Arbeiterverein und vier Tage später eine Rede über „Verfassungswesen“ im Bürgerbezirksverein. Im „Arbeiterprogramm“ deduziert er den Charakter des „Arbeiterstandes“ und dessen künftige historische Mission daraus, daß „dieser Stand … keine ausschließliche Bedingung weder rechtlicher noch tatsächlicher Art … mehr aufstellt und aufstellen kann, die er als neues Privilegium gestalten und durch die Einrichtung der Gesellschaft hindurch führen könnte“, vielmehr nur für die Abschaffung aller Privilegien und damit für die Vollendung des sittlichen Staates eintreten könne. Als Mittel zur Verwirklichung des Prinzips des Arbeiterstandes und der damit gesetzten Vollendung des sittlichen Staates gelten L. das allgemeine und gleiche Wahlrecht und ein starker, zentralistischer Nationalstaat. In der Rede über Verfassungswesen führte L. das Konzept der wirklichen im Unterschied zur geschriebenen Verfassung ein und sprach von einer Verfassungswirklichkeit, auf deren Kenntnis es entscheidend ankomme.
Am 6.12.1862 erreichte L. das Angebot einer Initiativgruppe des Leipziger Zentralkomitees der Arbeiterbewegung, die Leitung eines zu gründenden Verbandes zu übernehmen, am 11.2.1863 erfolgte eine offizielle Aufforderung des Leipziger Zentralkomitees, L. möge seine Vorstellung über Ziel und Aufgaben der Arbeiterbewegung präzisieren, was er in dem am 1.3. publizierten „offenen Antwortschreiben“ an das Zentralkomitee tat, das sein soziales Arbeiterprogramm formulierte. Neben der nach wie vor zentralen Forderung nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht sprach sich L. für „Arbeiterassoziationen mit Staatshilfe“ aus, wobei er zwar selbst immer annahm, daß solche Assoziationen erst von einem durch „den Arbeiterstand“ beherrschten demokratischen Staat finanziert werden könnten, aus Agitationszwecken aber auch die Forderung als solche an den bestehenden Staat gelten ließ. Das Angebot →Bismarcks, eine einzelne derartige Assoziation zu finanzieren, lehnte er allerdings bedingungslos ab. In einem Artikel wehrte sich L. ausdrücklich gegen die Gleichsetzung der von ihm propagierten Assoziationen mit den französischen Nationalwerkstätten des Jahres 1848, deren klägliches Scheitern ihm von Gegnern vorgehalten worden war.
Am 23.5.1863 konstituierte sich in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) unter der Präsidentschaft L.s, der auch die außerordentlich zentralistischen Statuten entwarf und sich große Befugnisse einräumen ließ. Im September hielt L. eine große Anzahl öffentlicher Reden (Heerschaureden) und reorganisierte das Kassenwesen des ADAV. Am 22.11. wurde er in einer öffentlichen Berliner Arbeiterversammlung verhaftet. Die am 12.3.1864 gehaltene Verteidigungsrede im Hochverratsprozeß (wegen einer Ansprache vom 14.10.1863) streicht die Möglichkeit des „sozialen Königtums“ heraus, das sich über die Köpfe der privilegierten Minderheiten hinweg direkt auf das „einfache Volk“ (den Arbeiterstand) stützt. Die seit Mai 1863 aufgenommenen Kontakte mit →Bismarck sind ebenso wie die Agitation für das „soziale Königtum“ als taktische Maßnahmen zum Zweck der Erhaltung legaler Betätigungsmöglichkeiten für den Verein anzusehen, haben aber in der Folge erheblich zur Verwirrung auch von Anhängern beigetragen. Am 22.4. wurde L. zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, am 29.6. wurde, nach abermaliger Verhandlung, das Strafmaß auf 6 Monate herabgesetzt. L. blieb aber in Freiheit. Im Mai errang er bei Reden in Solingen, Barmen, Köln, Duisburg, Wermelskirchen, Ronsdorf und Düsseldorf beachtliche Erfolge und wurde von großen Menschenmassen stürmisch gefeiert. Die Würdigungen L.s aus der Feder späterer Sozialisten und Kommunisten beziehen sich fast ausschließlich auf diese letzten zwei Jahre, während deren L. zum unumstrittenen Führer und Organisator der ersten selbständigen politischen Bewegung deutscher Arbeiter wurde. Sein Mut, sein rhetorischer Schwung und sein Geschick in der Formulierung eingängiger Losungen wurden selbst von denen anerkannt, die ihn – wie Marx, Engels, →Rosa Luxemburg und andere – seiner angeblichen theoretischen Schwächen vor allem auf ökonomischem Gebiet wegen kritisierten.
Mitten aus diesem erfolgreichen und aktiven Leben wurde L. durch den Tod infolge der bei einem Duell erlittenen Verwundung am 31.8.1864 herausgerissen. Dieser nicht nur von Marx als unpassend und sinnlos empfundene Tod hat gleichwohl zur Glorifizierung des „Achilles“ L. wesentlich beigetragen. L. hatte in seinem Leben schon zahlreiche Beziehungen zu Frauen gehabt. Trotz seiner Hochschätzung für die selbständige Kameradin Gräfin Hatzfeldt schätzte er Frauen im allgemeinen keinesfalls als gleichberechtigte Kampfgefährten der Männer ein. 1860 hatte er versucht, eine Ehe einzugehen, und hatte um die junge Russin Sophie Sontzeff vergeblich geworben. Im Juli 1864 lernte er Helene v. Dönniges, die Tochter eines bayer. Diplomaten, in Rigi-Kaltbad kennen, verliebte sich in ihre Liebe zu ihm und beschloß, die Eltern um die Hand der Tochter zu bitten. Die ehrgeizige neuadlige Familie war aber entschlossen, den in ihren Augen übel beleumundeten Freier abzulehnen, und als Helene Hals über Kopf zu L. flüchtete in der Erwartung, er werde mit ihr fliehen, meinte jener, den Dank der Familie und die Hand der Tochter dadurch verdienen zu können, daß er sie der Mutter unverzüglich zurückgab. Seine Erwartungen wurden wiederum enttäuscht. Helene wandte sich von L. ab, und damit hätte die Angelegenheit beendet sein können. Doch L. setzte alle möglichen Hebel in Bewegung: ließ durch seinen Freund Hans v. Bülow (der – anonym – auch eine Hymne für den Verein komponiert hatte) →Richard Wagner um Intervention bitten, gewann in einer persönlichen Unterredung sogar die Unterstützung des bayer. Außenministers, der eigens einen Beamten nach Genf schickte, bat die Gräfin Hatzfeldt, Bischof Ketteler einzuschalten (was wegen der unerwarteten Tatsache, daß die Dönniges evangelisch waren, sich als sinnlos erwies) und scheiterte doch, zumal die wichtigste Voraussetzung – die treue Liebe Helenes zu ihm – inzwischen nicht mehr bestand. In seinem Zorn über das Scheitern seiner Pläne beschloß L., der zuvor mehrfach von Selbstmord geredet hatte, die Familie zu beleidigen und ein Duell zu provozieren. An Stelle des Vaters stellte sich hierfür der ehemalige und abermalige Verlobte Helenes, der rumän. Junker Janko v. Racowitza zur Verfügung. Er traf bei dem ihm zustehenden ersten Schuß L. in den Unterleib, L.s Kugel verfehlte ihr Ziel. Drei Tage nach dem Duell starb L.
Am Tag vor dem Duell hatte L. sein Testament verfaßt, das u. a. auch dem ADAV galt. Johann Philipp Becker war der erste, der den Tod L.s als wichtiges Ereignis für die Partei begriff und Feiern zu organisieren begann. Er versuchte auch, eine Sprachregelung für die Einschätzung des Ereignisses zu finden, die den „makellosen Arbeiterführer“, der ein einziges Mal einen Fehler gemacht habe und für ihn mit dem Tode büßte, wiederherstellte. „Trotz der flehentlichen Einsprache der Gräfin Hatzfeldt, trotz der entschiedensten Opposition seiner Freunde, trotzdem, daß er sein ganzes Leben lang grundsätzlich den mittelalterlichen Unsinn des Duells bekämpft (hatte), nahm er dennoch die Herausforderung an. Und diese einmalige Untreue an seinen Grundsätzen büßte er mit dem Leben. Wie bei allen Menschen, war auch bei diesem Manne die stärkste Seite mit der schwächsten aufs engste verwachsen.“
Der hochbegabte theoretische Kopf, der abstrakte Willensmensch, der leidenschaftlich um seine persönliche Anerkennung wie um die „Sache“ ringende Kämpfer L. war – wie Na'aman in seiner Monographie gezeigt hat – im Grunde ein einsamer Mensch. Einzig die Gräfin Hatzfeldt war ihm eine lebenslange treue Kampfgefährtin, die zuweilen sein Ungestüm und seine Fehleinschätzung der Lage zu korrigieren wußte. Geistesgeschichtlich gehört L. in die Tradition des jakobinischen, radikalen Demokratismus und des revolutionär umgebildeten deutschen Idealismus von Fichte und Hegel. Daß er im Laufe der Geschichte von den Revisionisten und von bürgerlichen liberalen Demokraten als Korrektiv gegenüber dem Marxismus herangezogen wurde, beruhte auf einem historischen Mißverständnis. Wenn auch L. im Unterschied zu Marx dem Staat wie dem Recht eine höhern Bedeutung beimißt, so bedeutet das bei ihm weder eine Anerkennung des Parlamentarismus noch der Reformfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft, sondern vielmehr die Erwartung, daß – gestützt auf eine unartikulierte Massendemokratie – von einer revolutionären Elite eine erfolgreiche „Diktatur der Einsicht“ verwirklicht werden könne, die zum Sozialismus und Kommunismus führen und endlich nach Abschluß einer Erziehungsdiktatur (die ähnlich schon Fichte ins Auge gefaßt hat) Staat und Recht als äußere Zwangsanstalt überflüssig machen würde. In ihrer antiliberalen und antiparlamentarischen Auffassung stehen sich Marxisten und L. weit näher als gemeinhin bekannt. Dennoch gebührt L. ein Ehrenplatz in der kleinen Ahnengalerie deutscher Demokraten.
-
Werke
u. a. F. L. - Allg. Dt. Arbeiterver., Bibliogr. ihrer Schrr. u. d. Lit. üb. sie, 1840-1975, Mit Einl. v. C. Stephan, 1981. -
Ges. Reden u. Schrr., hrsg. u. eingel. v. E. Bernstein, 12 Bde., 1919 f.;
Nachgelassene Briefe u. Schrr., hrsg. v. →Gustav Mayer, 6 Bde., 1921-25;
Ausgew. Texte, hrsg. v. Th. Ramm, 1962;
Eine Ausw. f. unsere Zeit, hrsg. u.|eingel. v. H. Hirsch, 1963;
Reden u. Schrr., Aus d. Arbeiteragitation 1862–64, Mit e. L.-Chronik, 1970;
Arbeiterlesebuch u. andere Studientexte, Mit Nachwort „Zum Verständnis d. Texte“, hrsg. v. W. Schäfer, 1972. -
Literatur
ADB 17;
B. Becker, Gesch. d. Arbeiter-Agitation F. L.s, Nach authent. Aktenstücken, 1874, Nachdr. mit Einl. v. T. Oftermann 1974;
H. Oncken, L., 1904, ⁵1966;
E. Bernstein, L., 1919;
Th. Ramm, F. L. als Rechts- u. Soz.philosoph, 1953;
ders., L. u. Marx, in: Marxismusstud. 3. Folge, 1960, S. 188-221;
→Carlo Schmid, F. L. u. d. Politisierung d. dt. Arbeiterbewegung, in: Archiv f. Soz.gesch. 3, 1953, S. 5-20;
S. Miller, Das Problem d. Freiheit im Sozialismus, 1964, bes. Kap. 1: F. L., S. 25-54;
H. Kelsen, Marx u. L., Wandlungen in d. pol. Theorie d. Marxismus, 1967;
Sh. Na'aman, F. L., Deutscher u. Jude, 1968;
ders., L., 1970;
W. Gottschalch, Ideengesch. d. Sozialismus in Dtld., in: ders., F. Karrenberg u. F. J. Stegmann, Gesch. d. soz. Ideen in Dtld., 1969, S. 19-324, bes. S. 68-93;
H. Mommsen, L., in: Sowjetsystem u. Demokrat. Ges. III, 1969;
J. Jaurès, Die Ursprünge d. Sozialismus in Dtld., Mit Vorwort v. L. Goldmann, 1974, Kap. 4: Hegel-Marx-L., S. 78-103;
M. C. van Cleve, F. L., The inception of the German working men's party 1862-64, 1976;
S. Dayan-Herzbrunn, Le socialisme scientifique de F. L., in: Le Mouvement Social 95, 1976, S. 53-70;
H. Skambreks, Die soz.ökonom. Auffassungen F. L.s, in: Wirtsch.wiss. 24, 1976, S. 1684-1700;
H. Hirsch, Freiheitsliebende Rheinländer, 1977, bes. Kap. 6: Der Feuerkopf L., S. 113-32;
C. Stephan, „Genossen, wir dürfen uns nicht v. d. Geduld hinreißen lassen!“ Aus d. Urgeseh. d. Soz.demokratie 1862–78, 1977;
H. Stirner, Die Agitation u. Rhetorik F. L.s, 1977;
H. P. Bleuel, F. L. od. d. Kampf wider d. verdammte Bedürfnislosigkeit, 1979 (P);
G. v. Uexküll, F. L. in Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten, ²1979 (P);
H. v. Dönniges, Meine Beziehungen zu F. L., 1879, 111883;
Richard Schmid, Fernando Furioso, e. neue L.-Biogr., 1970;
H. Hirsch, Sophie v. Hatzfeldt, in Selbstzeugnissen, Zeit- u. Bilddokumenten dargest., 1981. -
Autor/in
Iring Fetscher -
Zitierweise
Fetscher, Iring, "Lassalle (Namensänderung 1846), Ferdinand" in: Neue Deutsche Biographie 13 (1982), S. 661-669 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118569910.html#ndbcontent
-
Lassalle, Ferdinand
-
Biographie
Lassalle: Ferdinand L. wurde am 11. April 1825 in Breslau von jüdischen Eltern geboren. Gegen den Willen seines Vaters, der ihn zum Kaufmannsstande bestimmt hatte, wandte er sich mit Eifer gelehrten Studien zu. An den Universitäten Breslau und Berlin trieb er Philologie und Philosophie. In Berlin wurde er mit Humboldt, Savigny, Böckh bekannt, die alle eine große Meinung von seinen Fähigkeiten hatten und ihn auch persönlich lieb gewannen. Während eines Aufenthalts in Paris verkehrte er mit Heine, der in seinen Briefen eine begeisterte Schilderung von den Talenten, der Energie und dem sichern selbstbewußten Auftreten des jungen L. entwarf. Mitten im Beginn einer Gelehrtencarrière lernte er 1846 in Berlin die damals noch schöne Gräfin Hatzfeldt kennen, die in einen Ehescheidungsproceß mit ihrem Mann verwickelt war. L. warf sich mit aller Leidenschaft zum Anwalt dieser Frau auf, führte durch acht Jahre ihre Processe, wurde dazwischen sogar der intellectuellen Miturheberschaft eines Cassettendiebstahls angeklagt, welchen Freunde der Gräfin verübt hatten, um in den Besitz wichtiger Documente zu kommen, wurde aber nach einer glänzenden|Vertheidigungsrede von der Anklage freigesprochen. Schließlich setzte er einen sehr günstigen Vergleich mit dem Gegner durch. Von seiner Jugend bis zu seinem Tode hat dieses Verhältniß zur Gräfin Hatzfeldt gedauert, das ihm für sein ganzes Leben seine sociale Position verdarb. Wenn er es auch in seiner Vertheidigungsrede nicht Wort haben mochte, so wird es doch ursprünglich die Liebe des jungen Mannes für die imponirende ältere Frau, und nicht blos, wie er es in seiner letzten Gerichtsrede kurz vor seinem Tode nannte, ein praktisches ritterliches Pathos gewesen sein, das ihn für die Verlassene und Verfolgte einnahm. Die Gräfin war eine begabte und leidenschaftliche Frau, welche ihm nicht blos für die ritterliche Vertheidigung, sondern wohl auch für die Liebe, die sie in ihren späten Jahren noch bei ihm erweckt hatte, zeitlebens dankbar war. Sie hat viel Einfluß auf ihn gehabt und ihn in seiner späteren Agitation immer ermuthigt und vorwärts gedrängt. L. bewahrte ihr bis zuletzt eine große Anhänglichkeit.
Im J. 1848 trat er mit den rheinischen Demokraten in Verbindung, nachdem er während des Hatzfeldt’schen Processes seinen Wohnsitz nach Düsseldorf verlegt hatte. Als die preußische Regierung im November 1848 die Nationalversammlung gewaltsam auflöste, forderte er das Volk zu bewaffnetem Widerstand auf. Dafür wurde er verhaftet und vor die Geschworenen gestellt. Hier hielt er als 23jähriger junger Mann seine erste politische Rede, hier nennt er sich offen einen Revolutionär aus Princip, einen entschiedenen Anhänger der socialdemokratischen Republik. Die Rede strotzt von jugendlichem Selbstbewußtsein und leidenschaftlichen Ausdrücken. Die Geschworenen sprachen ihn frei, aber der Gerichtshof verurtheilte ihn wegen eines verwandten geringeren Delicts zu sechs Monaten Gefängniß, welche Strafe er auch wirklich abbüßte, da er sich gegen jedes Gnadengesuch sträubte.
Der langwierige Fortgang des Hatzfeldt’schen Processes, welchen er ohne eigentlich Rechtsanwalt zu sein thatsächlich führte, unterbrach seine gelehrten Studien. Er hatte früh mit der Philosophie begonnen. Sein constructiver Geist und seine dialektische Anlage führten ihn bald zur Hegel’schen Philosophie. Der Kant’sche Kriticismus war damals ganz verschollen und hatte seine Wiederaufstehung erst vor sich, allein er hätte Lassalle's Geist, der nach positiven Losungen verlangte, auch niemals erfüllt. Für Naturwissenschaften hatte er wenig Sinn, und sie erhoben sich auch gerade damals wenig über eine Sammlung von Kenntnissen. Wie die besten jungen Gelehrten griff er zu einem schmierigen und abseits liegenden Gegenstand zunächst um seine Energie in der Bewältigung der Schwierigkeiten zu bethätigen. Die erschöpfende Behandlung eines eng begrenzten Gegenstandes, die Meisterschaft im Detail erzeugt ein Gefühl der Herrschaft im jungen Schriftsteller, das er bei weit ausgreifenden Arbeiten nicht so bald erreichen kann; durchdringt er dann geistig den Stoff mit seiner allgemeinen Weltanschauung, so glaubt er mit Recht ein Werk geschaffen zu haben. So wählte L. sich die verhältnißmäßig wenig untersuchte Philosophie Heraklits des Dunkeln von Ephesus für seine erste Arbeit, die er übrigens während des Hatzfeldt’schen Processes mehrmals unterbrach, so daß das Buch erst 1857 in zwei Bänden erscheinen konnte.
Der Grundgedanke des Werkes ist die Aufzeigung des Werdens als das eigentlich Absolute, als Grundprincip aller Dinge. Die Ausführung ist eigentlich eine Illustration Hegel’scher Sätze durch Heraklitische Aussprüche. L. dringt durchgängig auf den einheitlichen speculativen Charakter seines Autors. Die verschiedenen oft dunkeln Ausdrucksweisen des Heraklit über den Kampf und die Gegensätze in der Welt sollen nicht einzelne thatsächliche Gegensätze bezeichnen, sie sind nach ihm nur Namen und Formeln für den einen großen Gegensatz des Seins und des Nichtseins beide „als processirend gefaßt“ (I. 129). Das ewige|Werden ist der Fluß aller Dinge. Ebenso will L. die physikalischen Vorstellungen Heraklits, welche dem Gedankenkreis der alten Komosgonie angehörten, in metaphysische Formeln auflösen, welche den dialektischen Weltprozeß erfüllen. Das Feuer des Heraklit ist nach ihm nicht das sinnliche Feuer, auch nicht einmal das kosmische Feuer, sondern nur die Bewegung des Seins, rastlos in sein Gegentheil umzuschlagen, der Weltbrand ist keine Zerstörung der Welt im empirischen Sinne, er bedeutet die Ewigkeit des Werdens (II. 127). L. identificirt sich nicht gerade ausdrücklich mit den von ihm dem Heraklit in den Mund gelegten Sätzen Hegels, aber überall kommt das warme Interesse zum Ausdruck, das auf innerer Zustimmung beruht. In der Ethik wird diese Theilnahme begreiflicherweise noch lebhafter. Das Einzelwesen tritt in die Existenz durch die Individuation, die Entäußerung des Göttlichen, des Allgemeinen von sich selbst, seine Existenz ist selbst schon eine ἀδιϰία, eine Unbill gegen die allgemeine Einheit des Werdens, die nur durch Rückkehr des Einzelnen in das Allgemeine gesühnt wird. Die Ethik des Heraklit ist daher zugleich der ewige Grundbegriff der Sittlichkeit selbst, „Hingabe an das Allgemeine“ (II. 431), darum wird Willkür und Uebermuth verdammt, Sinnlichkeit und Egoismus verurtheilt. Darum ist der Ruhm, der erst nach dem Tode dem Menschen zu Theil wird, das wahre Sein der Menschen in ihrem Nichtsein (II. 436). So strenge Heraklit die Unterwerfung unter die Gesetze des Staates fordert, so geschieht dies doch immer unter der Voraussetzung, daß sie das Gemeinsame Aller und das Eine Göttliche enthalten, das ist ihre wahre Sanction, und wenn sie diese großen Grundsätze nicht enthalten, dann haben sie eben nicht den Charakter von Gesetzen (II. 392, 439). Ein Gedanke, der in seinen erworbenen Rechten in wenig geänderter Form wiederkehrt. Jenes Gemeinsame aber ist nicht blos die subjective Meinung der Masse, sondern nur das absolute Allgemeine im Staate, und darum war Heraklit kein Anhänger der jonischen Demokratie, ihm ist es auch Gesetz, wie L. mit besonderem Behagen hervorhebt, „auch dem Rathschluß eines Einzigen zu folgen, nämlich eines solchen, den jenes waltende Göttliche, das objectiv Allgemeine erfaßt hat“ (II. 440), und so erhebt sich L. bei Erzählung des politischen Lebens Heraklit's in Begeisterung an der Figur seines philosophischen Helden. Er sieht in ihm das platonische Ideal des überlegenen Genius, welcher als Verkörperung des Allgemeinen für das Volk wirkt, welcher die Vorurtheile und kleinen Interessen der Menschen verwirft, die Scheelsucht und den Neid der Mittelmäßigen überwindet und welcher der geborene Führer des Volkes ist, zur Herrschaft fähig und dazu berufen, so wie die allgemeine Vernunft siegreich über den Meinungen des gemeinen Verstandes waltet. Das war sein Ideal, die Dictatur des überlegenen Geistes, der seine bedeutende Persönlichkeit einsetzt für das gemeine Wohl.
In demselben Jahre übersiedelte L. mit der Gräfin Hatzfeldt nach Berlin, wo er das angenehme Leben eines wohlhabenden Privatgelehrten führte und mit allen literarischen Größen Berlins, insbesondere mit Böckh, viel verkehrte. Er beschäftigte sich damals mit der Zeit der Bauernkriege und als Frucht dieser Studien entstand ein Drama, „Franz von Sickingen“, das kein eigentliches Bühnendrama ist und auch die Probe der Aufführung nicht bestand. Es ist eine geschichtsphilosophische Dichtung, eine begeisterte Schilderung der Ideen Ulrichs von Huttens und der Auflehnung des deutschen Geistes in der Reformationszeit. Die kraftvolle Persönlichkeit und Willensstärke des großen deutschen Humanisten feiert L. mit Schwung und Pathos. Die Sprache ist nicht unpoetisch, allein überladen und oft blos rhetorisch.
Allein L. war keine blos literarische Natur. Seine Energie drängte immer zur Politik. Als der österreichisch-italienische Krieg die öffentliche Meinung Deutschlands tief aufregte, schrieb er eine Brochure gegen jede Unterstützung|Oesterreichs. Die Sache der Demokratie stehe auf der Seite der italienischen Bewegung, das Nationalitätenprincip Napoleon III. sei berechtigt soweit es sich um Culturnationen handele, die eine staatenbildende Fähigkeit besitzen, und müsse dann auch zur nationalen Einigung Deutschlands führen. Wenn Preußen seine Mission verstünde und ausführte, so würde die deutsche Demokratie selbst sein Banner tragen. Eine so klare und bestimmte Sprache zu Gunsten der Einigung Deutschlands unter Preußens Führung, wie damals, hat er später nie geführt. Er kam zwar in seinen späteren politischen Aeußerungen oft darauf zurück, allein sein späteres Auftreten gegen die preußische Regierung in der ersten Zeit der Militärconflicte, sowie sein späterer Kampf gegen die liberale Partei, welche im großen Ganzen doch die preußische Spitze wollte, führte ihn in der Folge oft zu entgegengesetzten Aeußerungen und zu der Meinung, als ob allein durch eine revolutionäre demokratische Bewegung die deutsche Einheit herzustellen sei. Aber Unitarier war und blieb er unter allen Umständen, den deutschen Föderalismus hat er stets bekämpft und als seine demokratischen Freunde 1860 eine Zeitschrift Herausgaben, so glaubte er, da er schon mit der Arbeit an seinen „erworbenen Rechten“ beschäftigt war, keinen besseren Beitrag für den ersten Band der demokratischen Jahrbücher liefern zu können, als eine Zusammenstellung von Fragmenten Fichte's über die deutsche Einheit. Er beklagte, daß das deutsche Volk seine besten und größten Denker nicht mehr kenne und lese. Ein Volk entstehe erst durch Einheit des Geistes. Neben dem großen Gegensatz zwischen Föderalismus und Volkseinheit sinke sogar der Gegensatz zwischen Monarchie und Republik zu einem relativ unbedeutenden herab. Das erbliche monarchische Kaiserthum mit Cassirung aller Untersouverainitäten steht noch immer auf einer höheren Stufe der Intelligenz und politischen Weisheit als die föderative Republik. Aber die deutschen Fürsten sind dazu unbrauchbar, sie sind in ihre Besonderheit so vertieft, das sie ein wohl erworbenes Recht auf die Zertheilung des deutschen Volksgeistes zu haben glauben. Darum ist die Freiheit nöthig und das nationale Dasein des deutschen Volkes ist nicht gesichert, so lange es im Innern nicht zur Freiheit gekommen ist. Die Erziehung zur Freiheit muß selbst mit Zwang geschehen. Ein paar Jahre darauf feierte er wieder Fichte in einer Festrede in der Berliner philosophischen Gesellschaft. Fichte war in einem gewissen Sinne auch eine revolutionäre Natur und zugleich der philosophische Vorläufer des deutschen Socialismus. Er ging wie L. von der stärksten Willenssubjectivität aus und kam dann zu einer äußerst starken Ausdehnung des Staatszweckes, der für ihn zuerst Recht, später die ökonomische Wohlfahrt und zuletzt auch die sittliche Cultur und Erziehung war. Im zweiten Band der demokratischen Jahrbücher veröffentlichte L. einen Aufsatz über Lessing, den er übrigens schon 1858 geschrieben hatte. Die literarische Epoche des vorigen Jahrhunderts bedeute ein neues Leben des deutschen Volkes und die beiden Hauptfiguren seien Friedrich der Große und Lessing. Die Bedeutung Friedrichs ist seine Auflehnung gegen das alte Reich, eine Insurrection gegen die alte Ordnung, im Inneren Aufklärung, aber auch diese ist nichts anderes als die zum Bewußtsein gekommene Ueberlegenheit des Subjects über die Welt seiner Ueberlieferung. Alles Revolutionäre in der äußeren Wirklichkeit aber verläuft im Sande, wenn das neue Princip nicht geistig durchgeführt wird und dieses Princip der lebendigen Präsenz des Selbstbewußtseins durch das ganze innere geistige Leben herbeizuführen, war die That Lessing's. Er ist nichts anderes als der weltliche Luther. Er ist der Dichter der humanen Idee, aber auch des deutschen Patriotismus. In seiner Kunstkritik durchbricht er den äußerlichen Formalismus, führt das Schöne in die Innerlichkeit des Denkens zurück und entreißt es der Sphäre der Sinnlichkeit und des Gefühls. Und gerade so verfährt er in der Religion, nicht auf zufällige|Geschichtswahrheiten, nur auf Vernunftwahrheiten könne die Religion basiren. Das Christenthum ist nach Lessing nur der Vorläufer eines neuen Evangeliums, wo der Mensch das Gute thut weil es das Gute ist. So wird Lessing der Begründer der philosophischen Ethik, welche die Tugend als die Realisirung des eigenen Begriffes auffaßt (S. 491). Die eigene innere Selbstentwicklung, das eigene Streben ist aber nicht nur für den Einzelnen der Weg zur Wahrheit, auch in der Geschichte gilt die innere Entwicklung des subjectiven Selbstbewußtseins, damit trennt sich Lessing von den französischen Philosophen, welche- in der Geschichte nur Unsinn und Zufall sahen, aber erreicht noch nicht Hegel für welchen die Geschichte die Entwicklung des objectiven Geistes ist. Am Schlusse kommt er auf die politischen Ansichten Lessing's zu sprechen und citirt statt weiterer Ausführung mit Hinweisung auf die französische Revolution eine Stelle aus dem Fragment Spartacus, der nachdem er vergeblich philosophirt hat, ausruft: wir wollen fechten!
Der Hatzfeldt’sche Proceß hatte ihn zu juristischen Studien geführt, mit Rechtsphilosophie hatte er sich immer beschäftigt und so kam sein Hauptwerk, das „System der erworbenen Rechte“ (1861 in zwei Bünden) zu Stande. Es gehört ebenso wie sein Heraklit dem Kreis der Hegel’schen Philosophie an, im einzelnen ist er aber hier viel weniger abhängig von Hegel, dem er im Heraklit fast bis auf einzelne Sätze folgte. Hier wie dort liegt die große Anschauung zu Grunde, daß alle Dinge eigentlich nur ein Proceß sind, daß die Welt eine Einheit der Natur und eine Einheit des Geistes ist, daß die Entwicklung der Geschichte und der Institutionen mit der Entwicklung der Ideen zusammenfällt. Aber diese Entwicklung soll nicht mehr ein blos dialektischer Proceß eines allgemeinen Satzes sein, sie soll Leben und Körper haben. Darum wendet er sich mit Recht gleich im Anfang gegen die hohlen Abstractionen der Hegel’schen Schule, welche den Reichthum des concreten Details und die Anschauung des Lebens vernachlässigten und darum mit logischen Formeln das Wesen der Dinge unmöglich erfassen können. Darum stellt er mit Recht die Relativität der einzelnen Institutionen voran. Alles Recht entwickelt sich historisch bei verschiedenen Völkern und unter verschiedenen socialen Verhältnissen. Die einzelnen Rechtsinstitute, welche die überaus ausgebildete moderne Rechtswissenschaft zu dogmatischen, absoluten Kategorien gemacht hat, sind nur historische Kategorien, nur der Ausdruck des geistigen Inhalts der verschiedenen historischen Volksgeister und Zeitperioden (I. XVI), er anticipirt hier bereits die Terminologie, welche er später auf das Capital anwendet. Aber nicht blos die einzelnen Institutionen, auch die Anschauungen der Menschen über das Recht sind der historischen Entwicklung entworfen, das Naturrecht selbst ist „historisches Recht, eine Kategorie historischer Natur und Entwicklung, denn der Geist selbst ist nur ein Werden in der Historie“ (I. 70). L. führt übrigens diesen richtigen Gedanken zu wenig aus. Er konnte leicht das Naturrecht des vorigen Jahrhunderts als eine Reaction gegen die Zustände der damaligen Zeit, gegen die Reste der Feudalität, als den Beginn einer neuen Auffassung und zugleich als Vorbereitung einer neuen geschichtlichen Periode aufzeigen, er konnte nachweisen wie die dogmatischen Sätze, welche auf der Freiheit und Rechtsgleichheit der Individuen aufgebaut wurden, nur der Ausdruck neuer socialer Ordnungen waren. Darin wäre eine neue und gerade für seinen Gegenstand zutreffende Bestätigung der Relativität und der Entwicklung aller Institutionen und Rechtsideen gelegen. Statt dessen verfällt er selbst in den von ihm gerügten dogmatischen Fehler der Construction der Institutionen aus einem absoluten Princip, wiederholt den Satz des alten Naturrechts, daß das Privatrecht nichts anderes sei als die Realisation der Freiheit des Individuums (I. 57) und übersieht offenbar absichtlich die Anschauung der historischen Schule, daß das Recht ein System der Ordnung der Lebensverhältnisse, eine Reihe von Herrschaftsformen ist, so daß sein ganzer Umfang mit jener rationalistischen Formel nicht gedeckt werden kann.
Von diesem Satz des Naturrechts aus nennt er nun erworbene Rechte jene, welche durch freie Willensaktionen vermittelt sind (I. 85), die das Individuum ganz zu seiner That gemacht, „verseinigt“ hat (I. 142). Auf solche Rechte sollen spätere Gesetze nicht zurückwirken, die Aufrechterhaltung der individuellen Willensfreiheit bildet den alleinigen Träger des Nichtrückwirkungsgedankens (I. 166). Im asiatischen Alterthum, wo die Willensfreiheit des Individuums nichts galt, konnten alle Gesetze rückwirken, seit dem Entstehen und Erstarken der individuellen Freiheit entwickelt sich erst der Begriff der Nichtrückwirkung, der Schutz und die Achtung erworbener Rechte. Mit dieser auf den Begriff der individuellen Willensaction gestellten Definition der erworbenen Rechte vertieft L. zunächst die herrschende Lehre über Rückwirkung von Gesetzen, welche die Rückwirkung auf erworbene Rechte, d. i. auf die Verbindung eines Rechts mit einer einzelnen Person ausschließt, sie dagegen Gesetzen über das Dasein von Rechten, Rechtsinstituten zuspricht (Savigny), für welche er die weitere Formulirung wählt, „Gesetze, welche das Individuum ohne Dazwischenschiebung eines freiwilligen Actes treffen, welche das Individuum also unmittelbar in seinen unwillkürlichen, allgemein-menschlichen oder natürlichen oder von der Gesellschaft ihm übertragenen Qualitäten treffen, oder es auch nur dadurch treffen, daß sie die Gesellschaft selbst in ihren organischen Institutionen treffen“ (I. 55). Im Einzelnen weicht er aber vielfach von der herrschenden Doctrin ab. Mit großem Scharfsinn und häufig sogar mit Spitzfindigkeit geht er zunächst die einzelnen Institute des Privatrechts durch und sucht überall nach dem subjectiven Willen; ist von diesem die Handlung sicher gesetzt worden, oder muß dieser ganz bestimmt vorausgesetzt werden, dann ist ein erworbenes Recht vorhanden, dann kann keine Rückwirkung späterer Gesetze stattfinden, ob es sich nun um Obligationen-, Status- oder Erbrecht, ja sogar um formelle Rechte handelt, denn nicht das Gesetz macht ein Recht zu einem erworbenen, sondern das Individuum muß das aus dem Gesetz stammende Recht durch eine Handlung seines Willens ergreifen und „erwerben“. Aber jedem Vertrag und jedem individuellen Willensact ist von Anfang an die stillschweigende Clausel hinzuzudenken, daß das gesetzte Recht nur auf solange Geltung habe, solange die Gesetzgebung ein solches Recht überhaupt als zulässig betrachten wird (I. 194). Denn die alleinige Quelle des Rechts ist das gemeinsame Bewußtsein des ganzen Volkes, der allgemeine Geist (195). Der subjective Willen erhält erst seine rechtliche Substanz durch seine Einheit mit der allgemeinen Willensgemeinschaft (Briefe an Rodbertus S. 39). Nimmt diese eine andere Gestalt an, so kann sich das Individuum nicht mehr dagegen auf seine früheren Handlungen berufen, denn das hieße die Trennung vom allgemeinen Rechtsbewußtsein zur Rechtsquelle machen. Das ist der Grund der Einwirkung prohibitiver, absoluter Gesetze auf bestehende Verhältnisse. Das Rechtsbewußtsein selbst faßt er ziemlich unbestimmt. Der früheren Rechtsordnung wirft er vor, daß sie gar kein öffentliches Recht sei, sondern alles öffentliche Recht nur als Privateigenthum der besitzenden Classe ansehe (I. 248). Aber immer wird der Staatswille durch das Rechtsbemußtsein der herrschenden Classe oder der maßgebenden Mehrheit des Volkes bestimmt werden und dieses wieder von bestimmten socialen und historischen Voraussetzungen abhängig sein. L. verweilt übrigens bei der Frage der Relativität des Rechtsbewußtseins nicht lange, er faßt das neue Rechtsbewußtsein ganz voraussetzungslos auf und polemisirt nun mit der logisch immer zwingenden Kraft radicaler Principien gegen Stahl, welcher bekanntlich seinen Conservativismus nicht so weit trieb, daß er nicht|doch der Fortbildung der Rechtsordnung und der Idee des Gemeinzustandes einen rechtsumbildenden Einfluß auch auf sog. erworbene Rechte einräumte, also gegenüber der starren Unbeugsamkeit eines Haller eine Mittelstellung einnimmt, die natürlich von einer radicalen Logik am leichtesten als widerspruchsvoll angegriffen werden kann. Durch diese ganze Darstellung, welche den größten Theil des ersten Bandes in Anspruch nimmt, weht durchweg jener „jacobinische Hauch“ den nach L. „jeder der modernen Philosophie Nahende empfängt“ (I. 214). Den Ausgangspunkt bilden die Decrete der berühmten Nacht vom 4. August 1789, durch welche die Constituante das Feudalsystem aufhob. L. sucht allerdings die Sache zuerst begrifflich zu deduciren und constatirt dann zum praktischen Beleg die Uebereinstimmung jener Decrete mit dem Resultat seiner Deduction, allein seine Construction ist doch nur eine Vertiefung der Formel jenes Gesetzes, welches bekanntlich alle jene Feudallasten und Giebigkeiten, die auf der öffentlich-rechtlichen Grundlage der Feudalität, der persönlichen Oberherrlichkeit und Unterthänigkeit beruhten, einfach ohne jede Entschädigung aufhob, aber Entschädigung für jene Abgaben versprach, welche auf onerosem Titel von Grundverleihungen der Grundherrn an ihre Unterthanen beruhten. Er faßt nun die Frage so: prohibitive Gesetze, wie jenes Decret eines war, verbieten entweder absolut ein bestimmtes Rechtsverhältniß, setzen gewisse Rechte aus der Sphäre der privatrechtlichen Erwerbung heraus und bestimmen, daß gewisse Rechtsverhältnisse überhaupt nicht mehr Eigenthum sein können, heben also, wie die gewöhnliche Sprüche lautet, das ganze Institut auf. Solche Gesetze wirken sofort und den früheren Berechtigten gebührt keine Entschädigung, weil der objektive Rechtsgrund, das Rechtsbewußtsein ein anderes geworden ist. Oder das neue Gesetz untersagt nur eine bestimmte Form der Ausübung eines Rechts, das selbst intakt bleibt, und schreibt nur die Bedingungen der Verbindung des Individuums mit jenem Rechte vor, dann wird das ganze Rechtsverhältniß nicht außerhalb des Privatrechts gesetzt, dann gebührt für solche Rechte, z. B. Zehnten, neben welchen ähnliche Reallasten fortbestehen. Entschädigung. Ihre Natur als ewige Rechte verlieren sie, sie werden als ablösbar erklärt, aber nach Entkleidung der alten Form respectirt und wie andere bestehende Rechte behandelt (I. 224—255). Ebenso bleibt aber auch unter allgemeinen prohibitiven Gesetzen der ersten Art das einzelne Privatrecht erworben, so weit es sich um dingliche Rechte handelt, welche, wenn auch ursprünglich auf einem nunmehr verbotenen Erwerbungsgrund beruhend, in das Eigenthum bereits übergegangen sind, wie z. B. bei Grundstücken; die obligatorischen Forderungen aus dem frühern Erwerbsgrund werden hingegen sofort hinfällig. Wenn die Grundentlastungsgesetzgebungen anderer Länder diese grundlegenden Principien der französischen Revolution verlassen haben, so war dies immer nur eine Anmaßung der bisher privilegirten Classen, wie in Preußen bei der Grundlastenregulirung im J. 1850, wo auch für ungemessene Giebigkeiten Entschädigung gewährt wurde, oder bei der Entschädigung für Aufhebung der Grundsteuerfreiheit (1861), welche L. auf das heftigste angreift.
Allen diesen socialen Gesetzen liegt jedoch nicht, wie man gewöhnlich glaubt, der Gedanke der Befreiung und Verstärkung des Privateigenthums zu Grunde. Der culturhistorische Gang aller Rechtsgeschichte geht nach L. vielmehr dahin, die Eigenthumssphäre des Privatindividuums immer mehr zu beschränken (260), immer mehr Objecte außerhalb des Privateigenthums zu setzen. Gebundenes Eigenthum, Fideicommisse, Leibeigenschaft, Monopol, Zunftordnung sind alles Formen, wo der menschliche Wille selbst noch als Privateigenthum gesetzt werden kann, diese ausschließlichen Rechte sind eben eine Potenzirung des Privateigenthums, eine Verstärkung der Besonderheit im Recht. Die französische Revolution|hat diese besonderen Privateigenthumsformen gebrochen (nach allen drei Richtungen der Hegel’schen Logik), einmal nach der Richtung der „Allgemeinheit", indem sie die Vorstellung von der privatrechtlichen Patrimonialgewalt der Fürsten über den Staat zerstörte, dann in Bezug auf die „Einzelheit“, indem sie durch Aufhebung der Unfreiheit, der Unterthänigkeit die Persönlichkeit, den individuellen Willen freisetzte von dem Privatrechte Einzelner und endlich in Bezug auf die „Besonderheit“, indem sie durch Aufhebung der Zunftverfassung und Realgerechtigkeiten bestimmte Formen des wirthschaftlichen Lebens, bestimmte Productions- und Consumtionsgarantien der Herrschaft Einzelner entzog. Diese Entwicklung ist heute noch nicht abgeschlossen. Dieses Werk der Revolution setzt der Liberalismus nur scheinbar fort, denn er will in der Gewerbefreiheit die freie Bethätigung der Arbeitskraft nicht für das Individuum überhaupt, sondern nur für das in besonderer Lage befindliche, so und so viel Steuer zahlende, mit Capital ausgerüstete, also immer noch für ein besonderes Individuum; was übrigens grundfalsch ist, denn die Gewerbepolitik der französischen Constituante und des späteren mitteleuropäischen Liberalismus sind ganz identisch. Europa, fährt L. fort, stehe gegenwärtig (d. i. 1861) vor zwei sehr interessanten Eigenthumsfragen, einmal ob der öffentliche Wille einer Nation Eigenthum einer Familie sei, d. i. ob in Frankreich sich eine Dynastie erhalten kann und ob in Deutschland die Zertheiltheit des Volksgeistes Eigenthum und verbrieftes Recht der deutschen Fürsten bleiben könne, dann in socialer Beziehung vor der Frage, „ob die freie Bethätigung und Entwicklung der Arbeitskraft ausschließliches Privateigenthum des Besitzers von Arbeitssubstrat und Arbeitsverhältniß (Capital) sein und ob folgeweise dem Unternehmer als solchem und, abgesehen von der Remuneration seiner etwaigen geistigen Arbeit, ein Eigenthum an fremdem Arbeitswerthe (Capitalprämie, Capitalprofit, der sich bildet durch die Differenz zwischen dem Verkaufpreis des Products und der Summe der Löhne und Vergütungen sämmtlicher auch geistiger Arbeiten, die in irgendwelcher Weise zum Zustandekommen der Producte beigetragen haben) zustehen solle“ (264). Hier haben wir bereits den Socialisten vor uns, hier steckt der Marx’sche Mehrwerth, die capitalistische Plusmacherei der socialistischen Agitation bereits drinnen, und mit Recht druckt L. diese Stelle im Vorwort seines späteren socialistischen Hauptwerkes wieder ab. Die ganze spätere große Thätigkeit Lassalle's arbeitet an der Lösung dieser hier von ihm offenbar mit Bedacht aufgeworfenen Frage. Es soll kein Eigenthum an der unmittelbaren Benutzbarkeit eines andern Menschen, kein Recht auf Ausbeutung geben, die Arbeitskraft soll emancipirt werden und zwar im guten alt-römischen Sinne des Worts e mancipio, außer dem Eigenthum der Capitalisten gesetzt werden.
Der Satz, daß prohibitive Gesetze sofort auf alle Verhältnisse, die auch von früher her datiren, einwirken, beruht nur auf der Veränderung des Rechtbewußtseins, hat die Sitte früher schon gegen ein Institut entschieden, so ist es nicht mehr haltbar und das formelle Gesetz vollzieht nur das Urtheil der Volksanschauung, das ist die Bedeutung der mores im alten römischen Recht, deren Gegenwirkung gegen das strenge alte Civilrecht erst Ihering recht aufgezeigt hat. Für die moderne Zeit fordert L. zwar bestimmte Gesetze, welche das veränderte Rechtsbewußtsein explicite constatiren, behauptet aber, daß die Veränderung des Rechtsbewußtseins selbst sich bereits früher nicht durch Gesetze, sondern durch bestimmte Thatsachen vollzogen haben kann, darum ist die Zurückdatirung des Verbots der Testirung in absteigender Linie, der Fideicommisse und Erbverträge auf den Tag des Bastillesturmes, wie es das Gesetz vom 17 Nivose II (6. Januar 1794) verfügte nicht eine ungerechte Rückwirkung, sondern blos der legale Ausdruck dafür, daß jener 14. Juli 1789 die alte Welt der Privilegien gebrochen|und die neue Aera der Rechtsgleichheit heraufgeführt hatte, jenes Ereigniß war der Wendepunkt des Rechtsbewußtseins, die Zeit nach jenem Tage gehört dem neuen Rechtsbewußtsein, darum müssen alle seitdem eröffneten Erbschaften nach den Grundsätzen der Gleichheit behandelt werden (35. 452). Also ein revolutionärer Act genügt um das neue Rechtsbewußtsein zu constatiren und die Gesetzgebung kann dann nach Belieben mehrere Jahre hinterher erst an die Arbeit gehen, die Bürgschaft einer gerechtfertigten Rückwirkung hat ihr jener Act schon gegeben; übrigens giebt L. selbst zu, daß sogar der Convent kein anderes Gesetz auf jenen Tag habe zurückwirken lassen und davor zurückschreckte, von jener schrankenlosen Freiheit der Revolution auf dem Gebiete des Privatrechts den weiteren Gebrauch zu machen, welcher nach seiner Theorie consequent und gerechtfertigt gewesen wäre.
Im zweiten Theile seines Werkes kehrt L. wieder zum Privatrecht zurück und versucht eine neue Construction des Erbrechts oder wie er sagt, entdeckt er das Erbrecht erst überhaupt, das bis dahin gar nicht verstanden worden sei. Auch das Erbrecht des Hegelianers Gans erfaßt nach ihm nicht das Wesen dieses Rechtsinstituts. Soll das Erbrecht ein erworbenes Recht sein, dann muß es aus der eigenen individuellen Willensaction des Berechtigten entspringen. Es genügt nicht der Wille des Erblassers, es muß der identische Wille des Erben hinzutreten, um Erbrecht überhaupt zu begründen. Die bisherige Theorie läßt nur die vermögensrechtliche Persönlichkeit des Erblassers auf den Erben übergehen, das ist aber nur eine Fiction für die von Savigny gezogene Consequenz dieses Standpunktes, daß nämlich die Identität zwischen Erblasser und Erben eigentlich nur im Vermögen liege, daß der Uebergang des Vermögens das eigentlich Substantielle der Succession sei. Das Wesen des römischen Erbrechts aber liegt nach L. in der Fortsetzung der subjectiven Persönlichkeit, es liegt in seiner charakteristischen Epoche nicht im Intestaterbrecht, sondern im testamentarischen Erbrecht und dieses ist nichts als die Unendlichkeit des Subjects, die Unsterblichkeit des Willens, wie Leibnitz schon gesagt habe. Die Fortdauer des auf die Außenwelt bezogenen endlichen subjectiven Willens erschöpft überhaupt den römischen Begriff der Unsterblichkeit, während für das Christenthum die „Unsterblichkeit des Geistes gilt, der alle Außenwelt und jeden Willen abgestreift hat“ (II. 224). Soll aber der subjective Wille sich unendlich setzen, so kann er die Endlichkeit nur dadurch überwinden, daß er die Gewalt hat aus seiner freien Innerlichkeit heraus eine andere Person zu seinem Fortsetzer und Träger zu ernennen (II. 25). Darum ist das Testament im alt-römischen Recht das Principale und die Intestaterbfolge nur subsidiär (27). Den alten Römern erschien das Testament nicht als bloße Vermögensdisposition, sondern nach der bekannten Etymologie Cicero's als eine testatio mentis, eine „Kundgebung des geistigen Innern“, darum setzten die alten Römer in ihren Testamenten zugleich ihren Feinden ein Denkmal der Schande (59), und selbst der spätere kaiserliche Despotismus respectirte diese schrankenlose Licenz der Testamente, darum endlich konnte der alte Testator Strafen gegen die Entweihung seines Grabes verhängen (181). Das römische Testament darf nicht blos eine Vermögenszuwendung, es muß die formelle Einsetzung eines Erben enthalten (62), es muß vor Allem ein Willenscontinuator bestellt werden, der selbst wieder den Willen hat, den Willen des Erblassers fortzusetzen. Der Erbe soll nicht etwas haben, sondern etwas sein (63), darum keine Beschränkung auf Dauer, keine Resolutivbedingung, semel heres semper heres, so daß nach dem Zwölstafelrecht der Erbe wegen der alles auszehrenden Legate auch gar nichts erhalten konnte (91). Gegen dieses civile Erbrecht reagirt das wirthschaftliche ius gentium in der bonorum possessio, welche nichts anders als die Nachfolge in die Vermögensmaterie darstellt (66), und ebenso die spätere Gesetzgebung, welche das freie Recht der Vermächtnißerrichtung durch die leges Furia und Voconia im Sinne einer Vermögenszuwendung an den Erben beschränkt; dieser enterbte Erbe des alten Civilrechts, welcher nichts als das Willensorgan des Testators sein soll, wollte eben nicht ohne persönliches Interesse diese Function übernehmen, und seinen schließlichen Sieg nicht so sehr über die Legatare als über den despotischen Willen des Erblassers bezeichnet die lex Falcidia, welche erst erlassen wird zur Zeit des Untergangs der Republik, als der ursprüngliche Volksgeist auch selbst dem Untergang nahe war (93). Aber selbst dann noch wehrte sich die alte Idee der Willensfortsetzung ohne vermögensrechtliche Betheilung der Erben und schuf als Gegenmittel gegen die egoistischen Ansprüche des Erben das Universalfideicommiß, welches den Fiduciarerben zwang, nicht mehr einzelne beschwerende Legate, sondern die ganze Erbschaft herauszugeben (81. 100). Anfänglich mußte der Fiduciar als Willensfortsetzer des Erblassers alle Lasten übernehmen, erst durch das S. C. Trebellianum wird dann der Fideicommissar als Erbe angesehen und der Fiduciar entlastet. Allein mitten in diese Entwicklung hinein schlägt wieder das S. C. Pegasianum, welches den Erbcharakter des Fiduciar wieder herstellt, ihm aber nach der veränderten Anschauung von den vermögensrechtlichen Ansprüchen der Erben die Wohlthat der falcidischen Quart gewährt; so kämpfen diese zwei Vorstellungen fortwährend miteinander, bis erst durch Justinian der Unterschied zwischen Fideicommiß und Legat verwischt wird (II. 120—145). Sowie dieser Fiduciar nur der eigentliche Willenserhalter des Erblassers war, so hatte das alte Testament per aes et libram auch eine solche Figur im familiae emptor, welcher durch die Form eines Geschäftes unter Lebenden, bei dem die Willensübertragung noch prägnanter ist, zum wahren civilrechtlichen Erben wurde und selbst gar kein Vermögen erhielt. Er war aber nicht etwa ein moderner Testamentsexecutor, denn auf ihn gingen die sacra und die Schulden über (107—115).
Das Legat verhält sich zum Erbrecht nicht wie ein Theil zum Ganzen, sondern wie das Object zum Willen. Es ist die sachliche Vermögenszuwendung ohne Willenssuccession. Die Macht des Erblassers zeigt zunächst das Vindicationslegat, welches Eigenthum auf den Legatar überträgt, ohne dessen Wissen und Wollen, die entgegengesetzte Ansicht der Proculejaner gehört eben der Zeit der Abschwächung des alten Rechts an. Die verschiedenen älteren Formen des Legats werden nun mit scharfsinniger Dialektik untersucht und in der schwankenden Entwicklung dieser Formen der dialektische Proceß des Erbbegriffes und seiner Widersprüche aufgezeigt. Ist das Vindicationslegat die stärkste Willensäußerung des Testators, so hat wiederum durch die Abtrennung der Sache aus der Erbschaft der Wille in Bezug auf sie fortzugelten, gewissermaßen zu rasch aufgehört, die Sache ist sofort Eigenthum der Legatare geworden. Soll aber der Wille fortdauern und im Legat erhalten werden, so muß die Sache auf Grund des noch fortdauernden Willens des Erblassers und daher auch des Erben in den Besitz des Legatars übergehen, so entsteht das Legat per damnationem mit einer bestimmten Handlung des Verabreichens seitens des Erben, der Erbe handelt hier und handelt interesselos, darum nennen die Römer dieses Legat optimum ius legati, weil es der Idee des Erbrechts am meisten adäquat ist. Es ist die subjective Willensunsterblichkeit, welche hier am stärksten hervortritt, darum kann der Erblasser eine Sache legiren, die gar nicht sein, sondern nur des Erben Eigenthum ist, ja sogar eine die res aliena ist, d. h. weder ihm noch dem Erben gehört, die dieser erst herbeischaffen muß, und endlich eine, welche res futura ist. Ist so dieses Legat die stärkste Gewaltäußerung des Erblassers, so liegt in der Intervention des Erben doch wieder ein Widerspruch.|Dieser muß die mancipatio vornehmen, es kommt daher zur Verfügung des Verstorbenen noch ein Act unter Lebenden. Diese kräftige Intervention des Erben nun scheint wieder den erblasserischen Willen zu verdunkeln und damit in das Gegentheil der Willensfortsetzung umzuschlagen. Diesen neuen Widerspruch zu lösen, versucht das legatum sinendi modo, welches wieder den Testator activ und der Erben passiv auftreten läßt, damit fällt aber dieses Legat wieder in den Widerspruch des Vindicationslegats zurück und darum beginnt mit dieser Legatform eine Reihe von Controversen, die ihren wahren Grund in dem inneren Widerspruch der gesammten Legats- und Testamentsbegriffe, in dem Widerspruch zwischen der Fiktion der Willensfortdauer und Willenseinheit und der Verfügung von bestimmten realen Handlungen hat (II. 171—223).
Neben dieser gebietenden Stellung des Erblassers steht nun die Figur des Erben und hier tritt mit Recht zunächst der suus heres in den Vordergrund. Dieser als in der Gewalt des Erblassers befindlich, repräsentirt die Willensidentität mit dem früheren Gewalthaber, denn die civilrechtliche Familie stellt eine Willenseinheit getrennter Persönlichkeiten dar. Der Erblasser braucht hier keinen Fortsetzet seines Willens besonders einzusetzen. Die sui sind die ersten Intestaterben nicht in dem Sinn, daß sie vom Gesetz dazu gemacht waren, sondern weil sie unmittelbare Fortsetzer der erblasserischen Willenssubjectivität sind (229). Die Nothwendigkeit, den suus einzusetzen oder zu enterben, ist nicht ein Sieg des Familiensystems über die erblasserische Willkür, sondern nur „die logische Nothwendigkeit, daß das Unmittelbare, wenn es nicht sein soll, thätig aufgehoben werden muß“ (255). Der suus gehört noch nicht dem Intestaterbrecht an, er ist ein lebendiges Testament (403), das gesetzliche Erbrecht tritt erst ein, wenn weder ein selbstgesetzter (testamentarischer), noch von selbst unmittelbar daseiender Willensperpetuirer (suus) existirt (265). Wegen dieser Mittelstellung des suus gilt hier nicht jener Gegensatz zwischen testatus und intestatus, es kann daher nach altem Civilrecht der präterirte suus dem fremden Testamentserben adcresciren. Das alte Civilrecht kannte weder Notherbenrecht noch Pflichttheil, daraus folgt, daß das Intestaterbrecht keine selbständige Instanz gegenüber dem Testator bildet, sondern daß es nur subsidiarisch Platz greift, wenn der individuelle Wille des Erblassers nicht gesprochen hat (385), es ist nur eine Ergänzung des eigenen, nicht ausgesprochenen Willens des Individuums. An Stelle dieses nicht ausgedrückten Willens des Einzelnen tritt der allgemeine Wille des Volkes. Die Basis der römischen Gesellschaft, die Personengemeinschaft der Agnaten ist darum die Basis des Intestaterbrechts (388). Damit fällt nicht die Inofficiositätsquerel zusammen, diese steht auf dem natürlichen Boden der Cognation und gehört nicht zum civilen Intestatserbrecht. Das Zwölftafel-Erbrecht stellt diese Reihenfolge des Erbrechts (Testamentserbe, suus, Intestaterbe) auf und ausdrücklich nennt es als Object der Erbschaft, nicht als Subject die familia. Diese ist nicht Vermögen, sondern die Willensherrschaft des Subjects und das ihr Unterworfene (405), dieses Herrschaftsgebiet erhält der Agnat, welcher gar nicht zur familia im römischen Sinne des Worts gehört (408. 410). Das alte Erbrecht ist daher kein Familienerbrecht in unserm Sinn, darum gibt es keine successio graduum, es ist ein Suchen des Individuums und wenn es dieses bei den Agnaten nicht findet, so greift es auf den Stamm, wo es die Willensgemeinschaft zu treffen hofft. Findet es auch hier nicht den Willensfortsetzer, so nimmt es einen Quinten überhaupt und das ist die Bedeutung der alten usucapio pro herede, die selbst wieder dem Intestaterbrecht subsidiär ist, sowie dieses dem Testamentserbrecht. Das Wesen des Todten schreit nach Fortsetzung, nimmt der Testamentserbe nicht an, so ruft es das Intestaterbrecht auf, und zögert der Intestaterbe, so wird der erste beste angerufen, daß er ihm Fortexistenz gebe (472).|Dieser rechtsphilosophische Gedanke des alten Erbrechts hatte seinen tiefen Ursprung in den religiösen Vorstellungen des römischen Volkes und insbesondere im alten Manen- und Larencultus, welcher die Individualitäten der Verstorbenen möglichst erhalten wollte (521). Der Grundgedanke Lassalle's, daß zu keiner Zeit und bei keinem Volke ein so stark ausgeprägter Begriff der Willensindividualität bestanden habe als im alten Rom, und daß darauf der Primat des Testamentserbrechts beruhe, ist unzweifelhaft richtig. Diese harten, willensstarken Römer waren Herrscher über Leben und Tod ihrer Kinder, ihrer Hausgenossen, ja selbst ihrer Schuldner, unumschränkt geboten sie über ihr Vermögen; Selbstsucht und Herzenshärte charakterisiren den alten Römer und erklären die Testirfreiheit und die Bevorzugung des Testamentserbrechts besser als die gemüthvolle Ausfassung, als ob die Testamente die Form gewesen wären, um die gegen die alte civilrechtliche Herrschaftseinheit der patria potestas und manus zurückgesetzte natürliche Familie der Blutsverwandten zu begünstigen, als ob also die Familien-liebe und nicht die Willkür die Testamente hervorgerufen habe (Ihering, Geist des R. R. I. 207). Diese Weichheit des Gefühls, welche zwar die spätere Inofficiositätsquerel anzurufen scheint, bestand bei den alten Römern nicht und wir dürfen nicht die Vorstellungen des späteren abgeschwächten Römerthums, oder die überwiegend familienrechtlichen Anschauungen der Deutschen oder gar die utilitarisch-ökonomischen Anschauungen der modernen Zeit heranziehen, um ein altes Rechtsinstitut zu erklären. Aber nicht blos die culturhistorische Stufe des alten Rom, sondern auch die Rechtsphilosophie muß das Testament als den Ausdruck der freien Selbstbestimmung, als einen Sieg des privaten Willens über Familie und Verwandte erscheinen lassen, der später zwar durch Notherbenrecht im Interesse der Erhaltung des Familienvermögens eingeschränkt wird, aber selbst auch dann noch über die nächsten Grade hinaus frei und rücksichtslos gegen alle übrigen Verwandten sich den Erben seiner Wahl aussuchen kann. Das alte Naturrecht, das aller Subjectivität im Recht immer günstig ist, sieht daher vor allem das Willensmoment im Testament, die unter dem Einfluß des Naturrechts stehende neuere Gesetzgebung hat immer das Bestreben möglichst den Willen des Erblassers zur Geltung zu bringen, und Kant spricht in seinen metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre eigentlich die Lassalle’sche Formel schon aus: Die Beerbung ist die Uebertragung der Habe und des Gutes eines Sterbenden auf den Ueberlebenden durch Zusammenstimmung des Willens Beider (§ 34). Es kommt also ebensosehr auf den Willen des Erben an und L. muß darauf besonderes Gewicht legen, weil er nur durch diese Willensaction des Erben das Erbrecht zu einem erworbenen Recht werden lassen kann. Darum liegt der zweite gleichwerthige Theil des Erbrechts in der aditio. Nur der suus und necessarius erwirbt ipso jure, alle andern Eiben müssen ihren Willen Erbe zu sein erklären (voluntariii heredes). Der Wille des Erben muß aber bestimmt und klar sein, er muß von seiner Erbeinsetzung wissen, weil nur so die geistige Beziehung zwischen seiner und der Willenssubjectivität des Erblassers hergestellt werden kann (308). Ein Irrthum über die Höhe der Erbschaft schadet nicht, wohl aber hindert die Adition ein Irrthum, ein Zweifel oder ein Nichtwissen über die Testirfähigkeit des Erblassers, über die Giltigkeit des Testaments, über den Eintritt einer Bedingung, ja selbst eine unwissentliche Erfüllung einer Bedingung, weil dies kein bewußtes Wollen ist, darum gilt von der Antretung der Erbschaft der sonst schwer verständliche Satz plus est, in opinione quam in veritate (321, 328). Dagegen macht ein Zweifel über die eigene Erbfähigkeit die Adition nicht wirkungslos, wohl aber muß der Erbe wissen, ob er neccesarius heres oder voluntarius, weil beim ersten die Willenseinheit schon besteht, beim zweiten erst gesetzt werden muß und auf diesen selbständigen Willensact des Erben kommt alles an, so daß er nicht je nach Umständen und Belieben ausbleiben kann. So lange dieser Willensact nicht gesetzt ist, so lange ist er nicht Erbe und kann daher vor der Adition die Erbschaft auf seine Erben nicht transmittiren (368). Ganz anders ist die Stellung des Erben im germanischen Erbrecht, welches L. zum Schlusse mit einigen Strichen zu charakterisiren sucht. Hier erwirbt der Erbe ipso jure, ja das Erbrecht stellt sich hier als ein schon zu Lebzeiten des Erblassers bestehendes Eigenthumsrecht an dem Familienerbe dar (584), darum hier ursprünglich nur Intestaterbrecht. Hier wird es nun L. begreiflicherweise schwer, das Erbrecht auf einen Willensact der Erben zurückzuführen, welcher nach seiner Theorie es erst zu einem erworbenen Recht macht, er sucht diesen Willensact „des Erben in seiner Geburt und in der sittlichen Personenidentität der germanischen Familie, wo der Vater bei der Zeugung die Willensaction für das Kind will“ (585), jedenfalls eine merkwürdige Personenrepräsentation! Das Testament dringt erst später ins germanische Recht, aber ohne den geistigen Gehalt des römischen Rechts und hat bei seiner ersten Reception viel mehr den Charakter einer Schenkung unter Lebenden (590), die weitere Entwicklung des deutschen Testamentsrechts ist der Kampf der alten germanischen Familienvorstellung gegen das eindringende römische Juristenrecht, darum ist das moderne Testamentsrecht aus Widersprüchen zusammengesetzt und ist nichts als ein „großes Mißverständniß, eine compacte theoretische Unmöglichkeit“ (593). Hier wendet sich L. plötzlich gegen das Testament überhaupt, das nach Ueberwindung der alten römischen Rechtsidee keine innere geistige Basis mehr habe, als bloße Vermögenszuwendung krankt es an dem Widerspruch, daß der subjective Wille, der mit dem Tod erlischt, der als Persönlichkeit rechtlich nicht mehr fortlebt, doch noch nach seinem Untergang Dispositionen trifft (598). Das Naturrecht habe Unrecht, dieses moderne Testament für ein naturrechtliches auszugeben, der französische Convent habe ganz Recht gehabt, das damalige Testamentsrecht möglichst einzuschränken, auf den Volksgeist zurückzugehen und alle Fähigkeit in directer Linie zu testiren aufzuheben. Damit ist zwar nicht das alte germanische Erbrecht völlig wiederhergestellt, denn dieses erkannte dem Intestaterben schon bei Lebzeiten des Erblassers ein Recht auf das Familienerbe zu. Die französische Gesetzgebung läßt den Erblasser bei seinen Lebzeiten durch Schenkungen über das Vermögen frei verfügen, das ist die Concession an die individuelle Freiheit, die Intestaterbfolge beruht also nicht mehr auf dem Recht des Intestaterben, sondern auf dem die „Vermögenshinterlassenschaft regelnden Willen des Staates“, sie beruft die Familie, aber nicht mehr aus eigenem Recht, sondern als „Staatsinstitution“. Innerhalb der Grenze bis zur quotité disponible ist es der Staat, welcher die Erbschaft vertheilt. Das ist richtig, die Willkür des Erblassers wird erheblich beschränkt, allein L. irrt, wenn er darin ein „Rückgreifen auf den eigenen Gehalt des germanischen Geistes“ sieht. Die Testirfreiheit wird beschränkt, aber nicht zur Erhaltung des alten gebundenen Familienguts, sondern im Namen der Gleichstellung aller Kinder. Die Parcellirung des Grundbesitzes und Vermögens, die Reaction gegen das germanische Fideicommiß und Erstgeburtsrecht, das sind die Ideen und Tendenzen der neuen französischen Erbrechtsgesetzgebung.
Eine weitere Kritik des modernen Erbrechts unterläßt L. Er schließt die Entwicklung des Erbrechts mit der neueren französischen Gesetzgebung und läßt die bekannten socialistischen Angriffe auf das Erbrecht überhaupt, oder doch wenigstens auf jenes der Collateralen und Testamentserben unberührt, und zieht nicht die Consequenzen seiner früheren Verurtheilung des modernen Testamentsrechts, wie er auch in seiner spätern socialistischen Agitation niemals die Institution des Erbrechts selbst angegriffen und wie er denn überhaupt es oft vermieden hat, das letzte Wort seiner Gedankenreihe auszusprechen. Mit|den erwähnten kurzen Bemerkungen über das germanische Erbrecht schließt der zweite Theil seines rechtsphilosophischen Werkes, welcher viel mehr durchgearbeitet und viel wirksamer als der erste über die erworbenen Rechte ist. Einzelne Darstellungen sind oft überraschend und verblüffend, die geschichtliche Entwicklung des Legats ist glänzend und geistreich. Der Grundgedanke von der Fortsetzung des Willens des Erblassers ist für das alte Civilrecht sicher richtig und L. hat keine Mühe gespart, um diesen Gedanken durch alle Rechtsformen emsig zu verfolgen, die Nachweisung der Willensrequisite beim Erblasser ist natürlich leichter und darum auch mehr gelungen, als die schwierigere Suche nach dem bewußten Willen des Erben. Sowie das Erbrecht auf den subjectiven Willen des Erblassers und des Erben zurückgeführt wird, so bildete im ersten Theil die individuelle Willensaction das eigentliche Requisit des erworbenen Rechts. Dies Princip des subjectiven Willens gehört recht eigentlich dem Jung-Hegelianismus an. Die revolutionäre Richtung dieser Schule ging vom Individualismus aus, hier wurde der Subjectivismus auf die Spitze getrieben, hier wurde nach den Worten des Meisters die Welt auf ihren Kopf, das heißt auf die Vernunft gestellt. Die kühne Construction, die geniale Weltanschauung, die rücksichtslose Behandlung hergebrachter Meinungen und Einrichtungen hat L. ganz mit jener Schule gemein und wenn er auch fast immer den wissenschaftlichen Ton einhält, so erinnern doch manche Stellen an Max Stirner, der in seinem „Einzigen und sein Eigenthum“ den Subjectivismus der Junghegelianer bis ins Paradoxe gesteigert hat. Mit dieser objectiven Vergötterung des Subjectivismus geht aber in dieser Schule und auch bei L. eine Ueberhebung der eigenen schriftstellerischen Subjectivität Hand in Hand. Die Sprache ist häufig anmaßend und voll übermüthigen Selbstbewußtseins. So ist es gekommen, daß sich dieses merkwürdige Buch keinen dauernden Platz in der juristischen Litteratur erobert hat. Aber nicht diese äußerlichen Mängel, oder die durch Wiederholungen und Dialektik oft ermüdende Darstellung sind es, welche die ruhigen und vorsichtigen Juristen abgeschreckt haben. Es ist die philosophische Methode selbst, welche unsern Juristen, die alle in der historischen Schule aufgewachsen sind und mühsame Detailforschung und Quellenkritik am höchsten stellen, antipathisch ist. Sie wittern gleich einen Rückfall in das alte Naturrecht. Der Scharfsinn unserer Civilisten, und sicher findet sich kaum in einer andern Disciplin so viel Schärfe der Argumentation beisammen, ist mehr nach Art der Mathematiker, es wird auch construirt, aber die grundlegenden Sätze liegen nicht wie philosophische Sätze vorne am Anfang der ganzen Reihe, sondern sind gewissermaßen nur Exponenten zwischen einzelnen Gliedern, es ist Construction, aber auf engerer Basis, es sind Theilstücke der großen Curve, welche der speculative Kopf dagegen gleich im ganzen mit kühnem Schwunge projiciren will. Solche philosophische Versuche gehen allerdings oft fehl, und im Einzelnen werden sie immer eine Menge Irrthümer begehen, aber man möge darum nicht zu gering von ihnen denken. Sie vertiefen doch die positiven Wissenschaften; nicht blos die Summe der Kenntnisse, auch das innere geistige Band gehört zur Wissenschaft. Phrasenhaftes Herumreden mit einigen oberflächlichen Schlagworten, geistreiches Dilettiren ohne gründliche Detailkenntniß soll allerdings von der strengen Wissenschaft unerbittlich gestraft werden, aber das Buch Lassalle's kann mit vollem Recht Anspruch auf den Namen einer wissenschaftlichen Leistung machen. Seine civilistische Gelehrsamkeit ist zum mindesten auf dem Durchschnittsniveau der strengen juristischen Litteratur, sein Scharfsinn in der Interpretation einzelner Stellen ist oft ungewöhnlich, so bleibt als sein angeblicher Hauptfehler eben nur die philosophische Construction zurück, welche Leben und Bewegung in das ermüdende Gleichmaß der Pandektenstellen bringen will. Und nützt denn das|scharfsinnige Ausdeuten eines grundlegenden Gedankens durch alle Einzelcombinationen hindurch der Wissenschaft nichts? Ist denn das berühmte Buch Ihering's über den Geist des römischen Rechts nicht auch eine rechtsphilosophische Construction? Freilich hat diesem Werk sein umfassender historischer Standpunkt, aber auch sein Eklekticismus die großen Sympathien erworben, welche die schroffe Einseitigkeit und der logische Absolutismus Lassalle's nicht erwecken konnten. Aber das speculative Bedürfniß liegt beiden Werken zu Grunde und solche Versuche müssen immer wieder erneuert werden, um eine von Detail strotzende Wissenschaft geistig aufzurütteln und sie vor der Gefahr einer bloßen Summe angehäufter Kenntnisse zu bewahren.
Bald nach den erworbenen Rechten veröffentlichte L. eine außerordentlich heftige Kritik gegen die Literaturgeschichte von Julian Schmidt, in Form von Anmerkungen zu einzelnen Stellen des Textes. Er hatte eine besondere Vorliebe für diese Form der Polemik, die er später in seinen gerichtlichen Reden und Berufungsschriften häufig anwandte. Der Ton der Schrift ist roh und geschmacklos, die Nachahmung des Anti-Götze mißlang gänzlich. Die Tendenz wäre nicht zu tadeln gewesen, denn er will insbesondere Schiller, Fichte, Hegel gegen die absprechenden Urtheile des modernen Literarhistorikers vertheidigen und überhaupt den großen Classikern und Denkern gegenüber dem neuen Literatenthum ihren berechtigten Platz sichern, allein er hat sich jede gute Wirkung durch die maßlose Grobheit verdorben.
Diese Schrift ist trotz ihres rein literarischen Charakters doch der Vorläufer des großen Feldzugs, welchen L. später gegen die liberale Presse und die Fortschrittspartei führte. L. hatte von 1848 her gewisse Beziehungen zu den Resten der alten demokratischen Partei erhalten und die demokratischen Jahrbücher, an denen er auch Mitarbeiter war, sollten den Kern für eine größere Parteigruppirung abgeben. Das schlug fehl; in Preußen hatte sich indessen insbesondere seit der sogenannten neuen Aera ein constitutionelles Leben entwickelt, das unmöglich mehr einfach an 1848 anknüpfen konnte. Zu Beginn der Sechziger Jahre kam der Conflict über die neue Armeeorganisation. Das öffentliche Interesse wurde im allgemeinen lebendiger, bis in die untern Schichten drang die Theilnahme an Politik. Gerade damals entstand die gute Sitte, daß hervorragende Gelehrte und Schriftsteller in populären Vereinen Vorträge hielten. L. hielt im Frühjahr 1862 einen Vortrag über Verfassungswesen. Das waren aber nicht die gewöhnlichen Redensarten über Constitutionalismus, über Staatsrecht, er griff an den lebendigen Kern der politischen Dinge. Alle Verfassungen sind nur der formelle Ausdruck thatsächlicher, socialer und realer Machtverhältnisse. Nicht die Paragraphen der Verfassung, nicht die sogenannten constitutionellen Gewalten erschöpfen das Leben der Verfassung, alles was im Staat Macht hat, ist ein Theil der Verfassung, weil es den Staatswillen zu bestimmen vermag Der König ist ein sehr wesentlicher Theil der Verfassung, nicht weil ihm die Gewalt durch die Verfassung ertheilt wird, sondern weil er die Gewalt thatsächlich ausübt, weil ihm die Armee gehorcht. Der Adel ist mächtig, weil er Einfluß bei Hof und auf den König besitzt, die Bourgeoisie, weil sie die Production und den Credit in der Hand hat, nur die arbeitende Classe ist politisch schwach, weil sie auch ökonomisch machtlos ist, darum ließ sie sich 1848 auch so leicht das allgemeine Wahlrecht wieder entreißen, aber eine gewisse Widerstandsfähigkeit besitze die arbeitende Classe doch noch auch heute, wollte man ihre persönliche Freiheit angreifen, die Leibeigenschaft wieder herstellen, dann würde sie sich so wehren, daß man ihre Widerstandskraft sofort respectiren müßte. Die ganze konstitutionelle Geschichte ist nur ein Kampf verschiedener Classen mit dem Königthum und untereinander um Erringung politischer Macht. Die|Bourgeoisie, welche 1848 momentan das Königthum niedergeworfen zu haben schien, verstand es nicht die günstige Lage festzuhalten. Wollte sie ihren Sieg behaupten und ausnützen, so mußte sie das Hauptmachtmittel des Königthums, die Armee, schwächen oder in ihre Gewalt bringen, die Militärdienstzeit auf sechs Monate herabsetzen und vor allem die Kanonen, dieses wichtige Stück der Verfassung, in die Verwahrung der städtischen vom Volk gewählten Behörden bringen. Statt dessen ließ sie sich durch Octroiirung des Dreiclassenwahlgesetzes die Revision der Verfassung gefallen, obwohl die Verfassung vom 5. December 1848 vom König angenommen, also geltendes Recht war. Seitdem ist die preußische Verfassung fortwährend im reactionären Sinne geändert und gehandhabt worden, sie ist so gut wie todt und die liberale Partei ist einfach lächerlich, wenn sie sich noch um diese durchlöcherte Verfassung schaart. Das war eine neue Sprache, das war wieder die Sprache von 1848, die rücksichtslose Sprache der revolutionären Partei, die gleich die Hand auf die Kanonen legen will und keinen Deut auf constitutionelle Doctrinen gibt. Hier wie in den spätern Reden Lassalle's herrscht, wie er selbst einmal sagt, die Voraussetzungslosigkeit des politischen Denkens. Es ist der philosophische Radicalismus, welcher die mühselige constitutionelle Arbeit der mittleren Classen, die Nothwendigkeit von Compromissen mit der Monarchie geringschätzt, die historische Berechtigung eines allmäligen Uebergangs vom absoluten Königthum zum parlamentarischen System nicht gelten läßt, mit grausamer Hand höhnisch auf die geringen Erfolge des Liberalismus hinweist und mit den abstracten Sätzen der französischen Revolution die volle Herrschaft des Volkes verlangt.
Dieser Vortrag erregte Aufmerksamkeit. Die Fortschrittspartei hörte diese Sprache nicht gern, die Regierung sah aber solche Diversionen außerhalb des Rahmens der parlamentarischen Opposition nicht ungern, zeigten sie doch, daß im Volk noch ganz andere Tendenzen bestünden als die ihr gerade augenblicklich unbequeme Strömung. Der Militärbudgetconflict ging weiter. Die Kammer verweigerte die Genehmigung der Ausgaben der neuen Organisation, das Budgetgesetz kam nicht zu Stande, aber die Regierung organisirte die Armee ruhig weiter. Die Lage war gereizt, allein ein wirklicher Bruch, ein Auflehnen trat nicht ein. Da hielt L. einen zweiten Vortrag „Was nun?“ Die liberale Partei sei in ihren Reden bis zum äußersten gegangen, sie habe die Regierung für die ungesetzlichen Ausgaben criminalrechtlich verantwortlich gemacht, statt aber das Tafeltuch zwischen sich und der Regierung für immer zu zerschneiden, sitze sie ruhig mit ihr an demselben Tische und führe die parlamentarischen Geschäfte weiter. Es müsse zum Bruch kommen. Eine Steuerverweigerung wäre ein solcher Schritt, allein die königliche Gewalt sei so groß, die Autorität des Staates so mächtig, daß die Bevölkerung die Steuern ruhig weiter zahlen und der ganze Beschluß ein Streich in die Luft sein würde. Soll aber die Volksvertretung diesen Absolutismus und das sei das jetzige Regime noch mit dem Mantel der constitutionellen Fiction bekleiden, ist das der Kammer und der Wähler würdig? Da gebe es nur ein Mittel, sich und die Ehre des Volkes zu wahren, nämlich die Abstinenz. Die Kammer beschließe, ihre Sitzungen auf unbestimmte Zeit und zwar auf so lange auszusetzen, bis die Regierung den Nachweis liefert, daß die verweigerten Ausgaben nicht länger fortgesetzt weiden. Das könne die Regierung nicht aushalten, sie müsse doch den Schein einer constitutionellen Finanzwirthschaft haben, sie könne sich nicht als nackten Absolutismus vor dem Volke hinstellen lassen. L. täuschte sich mit seinem Vorschlag vollständig, die damalige preußische Regierung hätte auch diese Form des Conflictes ruhig ertragen und es ist sehr fraglich, ob bei Neuwahlen die Wähler die Abstimmung ihrer Abgeordneten ratificirt hätten. Mit diesem Vortrag verschärfte sich die feindselige Stellung Lassalle's zur Fortschrittspartei, welcher er Großsprecherei, Furcht und Kleinmüthigkeit vorwarf.
L. aber ging weiter. Die constitutionellen Controversen, welche innerhalb der liberalen Partei bezüglich der Militärausgaben bestanden, ließ er bei Seite und drang tiefer auf den untern Grund aller populären und revolutionären Bewegungen. Am 12. April 1862 hielt er vor dem Berliner Handwerkerverein der Oranienburger Vorstadt einen Vortrag über den „Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes“, welchen er mit Recht Arbeiterprogramm betitelte. Diese Rede war wirklich ein Programm. In gedrängter conciser Darstellung gibt er eine geschichtsphilosophische Entwicklung der europäischen politischen Ideen. Vielfach im Anschluß an das Buch von L. Stein über die französische sociale Bewegung, das auch auf Hegel’scher Grundlage geistreich construirt und das auch sonst auf L. vielfach Einfluß geübt hat, sagt er nun: Eine neue Periode in der Geschichte muß die Geltung einer neuen Idee bedeuten. Der Wendepunkt zwischen einem alten und einem neuen historischen Princip ist eine Revolution. Revolutionär in diesem wahren Sinne des Wortes sind daher jene Umwälzungen und Erschütterungen nicht, welche ein bestehendes Princip nur kräftigen oder verschärfen wollen, darum war der deutsche Bauernkrieg trotz seiner revolutionären Maßregeln reactionär, denn er wollte nur den ritterlichen und bäuerlichen Besitz politisch berechtigt machen, den einzelnen Menschen aber als Menschen nicht, und darum mußte er scheitern. In seinem „Franz von Sickingen“ hatte er die Coalition der Ritter und Bauern nicht so abfällig behandelt. Viel eher, fährt er fort, war das neue Landesfürstenthum revolutionär, das die Idee einer vom Grundeigenthum unabhängigen Staatssouverainität, also die von Privatbesitzverhältnissen unabhängige Staatsidee vertrat, und darum siegte dieses Landesfürstenthum nicht blos gegen Ritter und Bauer, sondern auch gegen das ohnmächtig gewordene Kaiserthum. Eine wirklich revolutionäre Bewegung, die auf einem wahrhaft neuen Gedankenprincip steht, ist noch niemals untergegangen, mindestens nicht auf die Dauer (S. 7). Aber das neue Gedankenprincip darf nicht der Einfall eines Menschen, sondern muß wirklich eine neue historische Idee sein, die sich bereits thatsächlich in den realen Verhältnissen vollzogen oder vorbereitet hat, darum kann man nie eine Revolution machen, man kann immer nur einer Revolution, die sich schon in den socialen Verhältnissen vollzogen hat, die äußere rechtliche Anerkennung und consequente Durchführung geben, aber so thöricht es ist, eine Revolution machen zu wollen, ebenso unweise ist es, eine Revolution, die bereits die Gesellschaft ergriffen hat, zurückdämmen zu wollen. Alle großen geschichtlichen Perioden bezeichnen so das Zusammentreffen neuer realer socialer Ordnungen mit neuen Ideen. So war der Fortschritt der Industrie und der bürgerlichen Production, die Entwicklung des Capitalreichthums und der Theilung der Arbeit ein revolutionäres Princip. Beim handwerkmäßigen Betrieb war die nächste Nachfrage bestimmend für die Production, jetzt geht die Production dem Angebot voraus und sucht die Bedürfnisse zu erzwingen, jetzt wird mit Massenproduction und Wohlfeilheit der Weltmarkt erobert. Der Charakter dieser geschichtlichen Periode ist die Bedeutung der Bourgeoisie, des dritten Standes und die Anerkennung seiner Macht im Staate ist die französische Revolution von 1789, die die Herrschaft der feudalen Grundaristokratie zerbricht. Aber dieser tiers état, von welchem Sieyès glaubte, er sei alle Welk, ist eben nur die capitalbesitzende Classe geblieben, sie will politisch herrschen auf Grund des Besitzes, darum will sie durch Wahlcensus, Dreiclassenwahlsystem die Masse des Volks von der Macht ausschließen und darum legt sie das Hauptgewicht auf die indirecten Steuern, an denen unter ihrem Einflusse in Preußen das arme Volk 85 Millionen Thaler liefern müsse,|während die wirklich directen Steuern, der Maßstab des Politischen Wahlrechts nur 12 Millionen einbrächten. Hier fällt L. plötzlich aus seiner im getragenen Stile gehaltenen geschichtsphilosophischen Construction in die rein agitatorische Sprache. Um zu diesem überraschenden Mißverhältniß der beiden Steuergattungen zu kommen, rechnet er einfach die ganze Grundsteuer zu den indirecten Steuern, da sie ja auf den Getreidepreis umgewälzt und daher definitiv von den Consumenten bezahlt werde. Die Grundsteuer wirkt also nach ihm wie eine Mahlsteuer, während heute nach Wissenschaft und Praxis der Getreidepreis durch die internationalen Marktverhältnisse bestimmt wird und vielfach mit Recht angenommen wird, daß die Grundsteuer gerade die Grundrente trifft und einer Werthverminderung des Grundes um den Capitalbetrag der Steuer gleich kommt. Er wiederholt übrigens diesen Satz in seiner Rede über die indirecten Steuern. Von der Gewerbesteuer, sagt er, gelte die gleiche Abwälzbarkeit, aber ohne irgend eine nähere Ausführung zu geben und auch die Gebäudesteuer zählt er stillschweigend zu den indirecten Steuern, so wie er auch ganz übersieht, daß alle diese drei directen Steuern gerade so wie die Classen- und Einkommensteuer die Basis des Wahlcensus bilden. Aber wie er theoretisch Unrecht hat mit der Ueberwälzung jener directen Steuern, ebenso historisch unrichtig ist es, die Auflegung der indirecten Steuern der Bourgeoisie zur Last zu legen. Im alten Regime des feudalen Frankreichs war es, wo die indirecten Steuern die größte Ausdehnung erfuhren, wählend die besitzenden Classen in England, welche er auch Bourgeoisie nennen würde, eine Reihe von Consumtionssteuern aufgehoben und die Einkommensteuer eingeführt haben. Und ebenso falsch ist es, daß die Bourgeoisie das Dreiclassenwahlsystem in Preußen zur Beseitigung ihrer Herrschaft eingeführt habe, wie er denn auch selbst mit merkwürdiger Inconsequenz in der Vertheidigungsrede in dem Processe, welchen ihm dieser Vortrag zuzog, sofort erklärte, daß es die preußische Regierung war, welche aus allgemeinen reactionären Gründen jenes Wahlsystem octroiirte, während die deutsche Bourgeoisie im J. 1848 in Frankfurt das allgemeine Wahlrecht proclamirte (Die Wissenschaft und die Arbeiter S. 42). Aber in seinem Vortrage steht er zu sehr unter dem Einfluß der Stein’schen Construction der französischen Verhältnisse, die er gerade so wie dieser als allgemein typische Entwicklungsformen annimmt und nennt das Jahr 1848 die Morgenröthe einer neuen Geschichtsperiode, eine Revolution für die Arbeiter, für die gesammte Menschheit. Das ist die Bedeutung des vierten Standes. Arbeiter sind wir alle, die Freiheit des Arbeiterstandes ist die Freiheit der Menschheit selbst. Der Ruf nach seiner Befreiung wird ein Schrei der Liebe sein, selbst wenn er als Schlachtruf des Volkes ertönt. Soll nun das Princip des Arbeiterstandes als das herrschende Princip der Gesellschaft verwirklicht werden, so ist das einzige Mittel hierzu das allgemeine und directe Wahlrecht. Dieses neue Princip ist aber ein eminent sittliches. Die obere Classe ist nicht an sich unsittlich, aber weil sie sich als privilegirt ansieht oder als solche zu erhalten wünscht, ist ihr die Hebung des Volkes antipathisch, sie ist wie in Feindesland und der Feind ist die Masse des eigenen Volkes, so ist die Selbstsucht der oberen Classen im nothwendigen Gegensatz gegen die Culturentwicklung der untern Classen. Diese Fehler hat die untere Classe nicht, hier fallen persönliches Interesse, Classeninteresse und allgemeines Interesse zusammen, darum wird die Herrschaft des vierten Standes die Blüthe der Sittlichkeit und Cultur bedeuten (S. 38). Damit wird auch eine andere Auffassung vom Staat selbst entstehen. Die Bourgeoisie verlange vom Staate nur die Sicherung der ungehemmten Selbstbethätigung des Einzelnen, sie verlange vom Staat nur Schutz für persönliche Freiheit und Eigenthum, das aber ist eine Nachtwächteridee (S. 39). Die neue Idee verlange die Solidarität der Interessen, die|Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit in der Entwicklung. Der Staat soll das menschliche Wesen zur positiven Entfaltung und fortschreitenden Entwicklung bringen, er soll durch Vereinigung die Einzelnen in Stand setzen, solche Zwecke, eine solche Stufe des Daseins zu erreichen, die sie als Einzelne nie erreichen könnten. Und in einer schwungvollen Peroration läßt er am Schluß den Purpursaum der neuen Morgenröthe bereits am Horizont aufsteigen.
Mit diesem Vortrag trat er positiv mit seinen Ideen hervor. Die Sprache ist im ganzen maßvoll, meistens wissenschaftlich gehalten, allein hier und da schwillt der agitatorische Ton schon vernehmlich an. Das ist leine Kritik der Fortschrittspartei mehr, kein Rath mehr für die Opposition zur Durchführung des Budgetconflictes, das ist ein neuer Boden für eine ganz andere Bewegung, als für den Streit um die Armeeorganisation. Hier wird in der Sprache der alten Demokratie von 1848 an die Massen appellirt. Der nationale Standpunkt der Broschüre von 1859 wird nicht mehr aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft fand in dem Vortrag den Thatbestand des Delicts der Aufreizung der besitzlosen Classen zum Hasse der Besitzenden. In dem Processe vor dem Berliner Criminalgericht zeigte L. eine neue Form seines Talents. In seiner Vertheidigungsrede, die er unter dem Titel „Die Wissenschaft und die Arbeiter“ veröffentlichte, ist eine ungewöhnliche Verbindung von Vehemenz der Sprache mit Schärfe der Argumentation. Die Vertheidigung ist selbst wieder eine Agitationsrede und auf die Wirkung nach außen berechnet. Der incriminirte Vortrag sei ein wissenschaftlicher gewesen und daher entrollt er eine Fülle von glücklich gewählten Citaten aus allen Zeiten für die Freiheit der Wissenschaft. Sein Leben sei der Wissenschaft und den Arbeitern geweiht, seine Wissenschaftlichkeit sei allein eine Bürgschaft gegen eine wüste Demagogie. Wenn sich die Gebildeten und Edeln einer Nation vom Volk ganz zurückziehen, dann kommt die Führung an die Rohesten. Voll Eitelkeit hebt er seine wissenschaftliche Bedeutung hervor und mit grausamem Humor führt er seine Sache gegen den Staatsanwalt, der ein Sohn Schelling's war. Er läßt nun den Vater, den Philosophen, gegen den Sohn, den Staatsanwalt, sprechen, citirt Stellen von Schelling über die Freiheit des Geistes und des Wortes, über den Revolutionsbegriff, die trefflich für seine Vertheidigung sprechen. Zum Schluß aber reicht er wieder der Bourgeoisie die Hand, gegen die Reaction kämpfe er mit ihr. Bourgeois und Arbeiter, sind wir Glieder eines Volkes und ganz einig gegen unsere Unterdrücker. Das Gericht verurtheilte ihn zu vier Monaten Gefängniß (16. Januar 1863).
Diese Vorträge und der Verlauf des Processes brachten die Figur Lassalle's stärker vor das große Publicum und namentlich vor die Arbeiterkreise. In diesen begann es sich zu jener Zeit etwas mehr zu rühren. Die Fortschrittspartei hatte mit den Arbeitern Fühlung gefaßt und theilweise auch gefunden, sie empfand das Bedürfniß, in ihrem constitutionellen Conflict die Sympathien der Massen für sich zu haben, wollte sie aber doch nicht direct in die politische Arena bringen. In Leipzig hatte sich ein Centralcomité für Arbeiterintereffen gebildet, welches eine Verbesserung der wirthschaftlichen Lage der arbeitenden Classen und das allgemeine Stimmrecht anstrebte, ein rechter Führer fehlte und nach verschiedenen Versuchen bei leitenden politischen Persönlichkeiten wandte sich das Comité an L. um Rath. Bisher war er erst als ein Einzelner, als ein Mann der Wissenschaft, als ein philosophischer Radicaler aufgetreten, wirklich praktische Ziele hatte er nicht verfolgt. Die Anerkennung seiner Vorträge durch Gelehrte und selbst hohe Beamte schmeichelte ihm, allein nach außen hin bedeutete sie nichts, zu einer wirklichen Action war sie nicht brauchbar. Der Brief der Leipziger Arbeiter aber war der erste volksthümliche Wiederhall seiner|Berliner Vorträge, er fühlte, daß er Anklang gefunden und daß er eine Action beginnen könne. Er wollte die Ideen, die er seit Jahren im Kopfe getragen, die er wissenschaftlich in seinen erworbenen Rechten vorbereitet, die er mit Rodbertus, Bucher, Ziegler discutirt, die er in den ersten Flugschriften für das große Publicum mundgerecht gemacht hatte, in die Wirklichkeit setzen. Er zögerte nicht lange und schrieb „das offene Antwortschreiben“ an das Leipziger Comité, das vom 1. März 1863 datirt ist. Diese Schrift ist die Stiftungsurkunde des deutschen Socialismus. Auf die Frage, wie sich die Arbeiter politisch verhalten sollen, antwortet er, sie sollen sich als selbständige politische Arbeiterpartei constituiren, einen Anhang der Fortschrittspartei zu bilden, sei ihrer nicht würdig, die Fortschrittspartei habe durch Schwäche und Kleinmuth die Sache der Freiheit preisgegeben und hänge noch immer an dem Dogma der preußischen Spitze, wo doch die preußische Regierung die reactionärste aller deutschen Regierungen sei. Was die Arbeiter vor allem angeht, sei die sociale Frage, die Ausgabe, die Lage des gesammten Arbeiterstandes zu verbessern. Wenn man zu diesem Zweck noch über Gewerbefreiheit. Freizügigkeit debattire, so sei dies einfach thöricht, darüber discutire man nicht, das wird lautlos decretirt. Sparkassen, Invaliden-, Hülfskassen machen das Elend der Arbeiterindividuen erträglicher, leisten aber auch nicht mehr (S. 9). Die Schulze-Delitzsch-Associationen, die Credit-, Vorschuß-, Rohstoff- und Consumvereine sind nicht im Stand, die Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes zu bewirten. Die Credit- und Rohstoff' vereine sind nicht für die Arbeiter, sondern nur für den kleinen Gewerbstand bestimmt, diese Bertriebsform muß aber gegenüber der Großindustrie verschwinden, es ist nutzlos und grausam, ihren Todeskampf zu verlängern (S. 14). Die Confumvereine sollen wol den ganzen Arbeiterstand umfassen, sind aber auch unfähig, seine Lage wirklich zu verdessern. Einmal fassen sie den Arbeiter als Confumenten und nicht als Producenten, legen also die helfende Hand nicht da an, wo er leidet und wo reformirt werden muß, dann aber wird ihre Wirkung, wenn sie allgemein eine Verwohlfeilung der Lebensbedürfnisse herbeiführen füllten, gerade eine Verminderung des Lohnes sein, denn dann tritt sowie überhaupt immer jenes eherne ökonomische Gesetz in Wirksamkeit, daß der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den nothwendigen Lebensunterhalt reducirt bleibt, der in einem Volk gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erforderlich ist (S. 15), und mit agitatorischem Ruf apostrophirt er die Arbeiter: Fragen Sie jeden, der zu Ihnen spricht, ob er dieses Gesetz anerkennt und wie er dasselbe beseitigen will (S. 17). Die Folge dieses Gesetzes ist, daß von dem Arbeitsertrag dem Arbeiter nur die bare Nothdurft als Arbeitslohn zukommt, der ganze Ueberschuß aber auf den Unternehmerantheil fällt, und mit der steigenden Productivität der Arbeit vergrößert sich dieses Mißverhältniß zum Nachtheil des Lohnes (S. 17). Man möge dagegen nicht die besseren Einkommens- und Lebensverhältnisse unserer heutigen Arbeiter mit den Lohnverhältnissen der älteren Zeit vergleichen, solche Vergleiche sind werthlos, was zu vergleichen ist, ist die Lage der arbeitenden Classe mit der Lage ihrer anderen Mitbürger in der Gegenwart (S. 19). Der heutigen Lage aber ist nur abzuhelfen durch Association der Arbeiter für fabrikmäßige Großproduction. Der Arbeiterstand muß sein eigener Unternehmer werden (S. 22), damit fällt die Scheidung in Lohn und Unternehmergewinn weg und an ihre Stelle tritt als Vergeltung der Arbeit der Arbeitsertrag. Den Weg dazu aber können nicht bloße private Productivassociationen mit Erfolg für die ganze Classe beschreiten. Solche Versuche fallen in der Regel in die capitalistische Productionsweise zurück, wie das Beispiel der so viel gerühmten Pioniere von Rochdale zeigt, die zuletzt eine gewöhnliche Actiengesellschaft geworden sind, wo die Nichtmitglieder als gewöhnliche Lohnarbeiter für die Arbeiteractionäre arbeiten. Das ist dann kein Unterschied gegen die heutige Vertheilung des Arbeitsertrags, keine Aufhebung des Unternehmergewinns als solchen (S. 33). Dem ganzen Arbeiterstand kann nur der Staat helfen. Der Staat hat die Aufgabe, die Culturfortschritte durch positive Förderung zu erleichtern. Hat der Staat denn nicht intervenirt bei Abschaffung der Sklaverei in den englischen Colonien, bei Gewährung von Zinsgarantien für Eisenbahnen zu Gunsten der Capitalisten? Und warum sollte der Staat nicht den Arbeitern seinen Credit leihen können zur Bildung von Productivassociationen, welche anfänglich einzelne Industriezweige umfassen, dann in Creditverbände mit einander treten würden. Die Führung der Geschäfte bliebe den Arbeitern überlassen, denen L. während des Jahres den üblichen Lohn entrichten und am Schlusse des Jahres den Geschäftsgewinn als Dividende zutheilen ließe. Aber diese Staatshülfe wäre ja eine Belastung der Steuerträger, wendet man vielleicht ein. Ja, wer sind denn die Steuerträger, wer ist denn das Volk, ja wer ist denn der Staat, wenn nicht die arbeitende Classe? Die preußische Einkommensteuerstatistik weist nach, daß 89 oder sogar 96 Procent der Bevölkerung in gedrückter Lage sind. Ihnen, der nothleidenden Classe, gehört der Staat, aus Ihnen besteht er. Ihre große Afsociation ist er selbst (S. 31). Die Staatshülfe für die Productivassociationen ist aber nur durchzusetzen, wenn die gesetzgebenden Körper Deutschlands aus dem allgemeinen und directen Wahlrecht hervorgehen. Das allgemeine Stimmrecht von 96 Procent der Bevölkerung als Magenfrage aufgefaßt, das ist das Zeichen, in dem Sie siegen werden! (S. 38).
In dieser meisterhaft geschriebenen Broschüre hat L. alle seine Ideen über die sociale Frage niedergelegt, alle seine späteren Schriften sind nur Ausführungen, Wiederholungen, Berichtigungen dieser Gedanken. Mit der Forderung nach Abschaffung des Lohnsystems und des Unternehmergewinns, mit der Forderung auf Zutheilung des vollen Arbeitsertrags an die Arbeiter war die socialiftische Formel wieder in Deutschland ausgesprochen. Wenn sich L. auch dabei gegen Socialismus und Communismus verwahrt, da die individuelle Freiheit und die individuelle Arbeitsvergütung fortbestehen soll, so war das nur eine Redensart. Die alte rein politische Demokratie war schwach geworden; um sie wieder zu neuer Kraft zu erwecken, mußte, wie L. später einmal sagte, ein Classeninteresse hinter sie geworfen werden. Im „Arbeiterprogramm“ sind die Arbeiter noch das ganze Volk und alle Welt ist Arbeiter, hier aber wird der Arbeiter schroff dem Besitzenden entgegengestellt, sein Classenbewußtsein aufgerufen, sein Classeninteresse ihm geschildert und er aufgefordert, die Hand nach der Befriedigung seiner Ansprüche auszustrecken. So hatte man seit langem nicht mehr zu den Arbeitern gesprochen, die Ricardo’sche Lohntheorie, die L. den Leipziger Arbeitern als unbestrittenes Dogma der Wissenschaft hinstellte, war bisher nur in der Literatur der Nationalökonomie bekannt gewesen, er schrie sie auf den Markt hinaus. Er wollte, wie er sagte, ausfprechen das, was ist, alles, was in der Wissenschaft zu Gunsten der Arbeiter und gegen die heutigen Verhältnisse der Produktion und Gütervertheilung zu finden war, das verwendete er zur praktischen Agitation.
Der Erfolg war zwar nicht unmittelbar der, den L. erwartete, sein Antwortschreiben erregte nicht einen Sturm, wie die Thesen an der Wittenberger Schloßkirche, aber doch vermochte es gleich wenigstens in Leipzig eine Gemeinde zu bilden. Das Leipziger Comité nahm sein Programm an und schrieb eine größere Arbeiterversammlung aus, zu welcher L. eingeladen wurde. In der Presse erhob sich eine heftige Discussion über die Schlagworte Staatshülfe und Selbsthülfe, um welche L. den politischen Sprachschatz bereichert hatte. Fast die ganze liberale Presse erklärte sich gegen ihn, nannte seine Vorschlüge eine Nachahmung der Louis Blanc'schen Nationalwerkstätten, welche 1848 in Frankreich kläglich gescheitert seien, sein Lohngesetz wurde angegriffen, sogar Professor Rau trat mit einem Schreiben gegen ihn auf. So stand L. gleich mitten in hestiger Polemik, er antwortete, er wies nach, daß die Nationalwerkstätten der französischen Regierung im J. 1848 von Gegnern Louis Bianc's, wie Minister Marie, für Erdarbeiten und ähnliche nutzlose Arbeiten eingerichtet wurden, um die Louis Blanc'schen Projecte ad absurdum zu führen, verschwieg aber bei der Anführung dieser historischen, thatsächlichen Berichtigung, daß seine Vorschläge doch eine große Aehnlichkeit mit den Projecten Louis Blanc's an sich trugen. Rau wies er nach, daß er in seinem Lehrbuch ungefähr dasselbe, wie die Ricardo’sche Lohntheorie lehre. In Arbeiterkreisen jedoch war damals der Name Schulze's so stark, daß sich eine große Anzahl von Arbeitervereinen und -Versammlungen gegen L. erklärte. Diese anfängliche Abneigung eines großen Theils der deutschen Arbeiter gegen Lassalle's Lehren ist nicht so unverständlich, als sie auf den ersten Blick aussieht. Die Arbeiter waren damals noch so nahe an der Polizeibevormundung der Reactionszeit, daß ihnen zunächst die Worte Selbsthülfe. Selbstverantwortlichkeit gefielen, die Consumvereine hatten im einzelnen wirklich wohlthätig gewirkt, sodaß sie vielfach mißtrauisch gegen die neue Lehre waren. Mehrere Vereine am Rhein sprachen sich zwar für ihn aus. In einzelnen Berliner Zeitungen dagegen wurde L. persönlich auf das schmählichste angegriffen, ja sogar mit dem Mord einer alten Frau, der in seiner Nachbarschaft stattgefunden hatte, in Verbindung gebracht. Im Berliner Arbeiterverein stellte ein Beamter der Borsig’schen Maschinenfabrik die Persönlichkeiten Lassalle's und Schulze's einander gegenüber, warf die Anhänger Lassalle's über den Haufen und ließ für Schulze und Selbsthülfe votiren. In gelehrten Kreisen fand er Zustimmung, die sich aber nicht öffentlich aussprechen mochte. Von seinen beiden Genossen in der Vorberathung seines Antwortschreibens, gab Bucher eine vage Zustimmungserklärung zu Lassalle's Ansichten von den allgemeinen Aufgaben des Staates, Rodbertus dagegen, den er in seinen Briefen um Unterstützung bestürmte, erklärte sich zwar für das Lohngesetz, aber gegen alle praktischen politischen und socialen Folgerungen Lassalle's, ebensowol gegen die Productivassociationen als völlig unwirksam, als gegen die Forderung des allgemeinen Stimmrechts und gegen jede politische Agitation. Die Arbeiter sollen eine wirthschaftliche, sociale Partei bilden, auf friedlichem Wege werde im Einvernehmen mit den übrigen Classen der Gesellschaft eine andere Vertheilung des Arbeitsertrags gesetzlich beschlossen werden, wie aber eine solche herbeigeführt werden und wie sie aussehen solle, darüber schwieg Rodbertus. L. ging nun nach Leipzig zur Arbeiterversammlung, führte dort seine Grundsätze und Vorschläge aus, und brachte einen Beschluß auf Erlassung eines Aufrufs an die deutschen Arbeitervereine zur Gründung eines allgemeinen Arbeitervereins auf Grundlage der Principien seines Antwortschreibens zu Stande. Nun mußte er weiter persönlich eingreifen, denn die Fortschrittspartei ließ überall Versammlungen gegen ihn abhalten. In Rodelheim bei Frankfurt hielt sie eine Versammlung, wo L. Büchner. M. Wirth und Sonnemann gegen L. sprachen. Als dort einer seiner Anhänger den Rednern vorwarf, sie hätten vielleicht weniger heftig gegen L. gesprochen, wenn dieser anwesend wäre, beschloß man, L. zu einer großen Versammlung zugleich mit Schulze-Delitzsch einzuladen. Schulze lehnte wegen parlamentarischer Geschäfte ab, L. ging hin. Er schrieb an Rodbertus, er halte zwar auch nichts von solchen Disputationen, allein er brauche einen Eclat, er wolle seine alte revolutionäre Mähne schütteln, er müsse hin und müsse siegen. Und er siegte. Die Versammlung war hauptsächlich aus Anhängern Schulze's zusammengesetzt, Sonnemann legte ein Referat und den Antrag vor, die Versammlung möge in Erwägung, daß die deutschen Arbeiter an dem männlichen Princip der Selbsthülfe und Selbstverantwortlichkeit festhalten, die Beschickung der Leipziger Gründungsversammlung ablehnen. L. hatte also einen schweren Stand. Aber hier vor diesem fremden und zuerst unsympathischen Publicum legte er seine Probe als Agitator ab. Ein Unbekannter, ein Berliner Jude, mit einer gewissen falschen Eleganz gekleidet, trat er vor die Frankfurter Arbeiter, die immer gerne zum Spotte aufgelegt sind. Und er sprach nicht wie ein Arbeiter, der selbst das Mühsal der Arbeit kennt und darum leicht die Instincte der großen Masse aufrüttelt, nein, er kam mit schwerfälligem literarischen Rüstzeug, um die wissenschaftliche Wahrheit der Sätze seines Antwortschreibens zu beweisen. Er las den Arbeitern eine Reihe von Citaten aus A. Smith, Say, Mill, Rau, Zachariä, Roscher vor, um ihnen die Richtigkeit des Ricardo’schen Lohngesetzes darzuthun, aber mitten zwischen diese für jede Versammlung ermüdenden Citate warf er aufreizende Worte, die direct den Arbeitern ihre Nothlage recht deutlich ins Bewußtsein bringen sollten. Er wiederholte seine Berechnung über die Zahl der kleinen Leute und Arbeiter in Preußen nach den Ergebnissen der Classen- und Einkommensteuer, wegen welcher er in eine Polemik mit Wackernagel verwickelt war, und wenn er auch in den Ziffern von seiner ersten Berechnung etwas abwich, so bewies er doch an der Hand der Schriften des preußischen Statistikers Dieterici, daß er Recht habe, zu behaupten, daß nur 1,3 Procent der Bevölkerung über 1000 Thaler Einkommen, 3 Procent ein Einkommen von 500—1000 Thaler und der große Rest von 95,7 Procent der Bevölkerung unter 500 Thaler Einkommen besitze (Arbeiterlesebuch, S. 26). Die arbeitende Classe sterbe nicht plötzlich aus Hunger, aber wegen schlechter und ungenügender Nahrung ist der Proceß des Hungersterbens ein permanenter (S. 27). Mit englischen statistischen Zahlen beweist er die geringere Lebensdauer der arbeitenden Classe überhaupt und die größere Sterblichkeit ihrer Kinder. „Ihr deutschen Arbeiter seid merkwürdige Leute!“ rief er, „vor französischen und englischen Arbeitern, da mühte man plaidiren, wie man ihrer traurigen Lage abhelfen könne, Euch aber muß man erst noch beweisen, daß Ihr in einer traurigen Lage seid. So lange Ihr nur ein Stück schlechte Wurst habt und ein Glas Vier, merkt Ihr das gar nicht und wißt gar nicht, daß Euch etwas fehlt. Das kommt von Eurer verdammten Bedürfnißlosigkeit. Möglichst viel Bedürfnisse haben, aber sie auf ehrliche und anständige Weise befriedigen, das ist die Tugend der heutigen Zeit“ (32). Dann entwickelte er seine Vorschläge, die Productivassociationen mit Staatscredit sind nur ein erster Schritt, keineswegs noch die Lösung der focialen Frage. Die Discussion über geeignete Mittel gehöre in den aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgehenden gesetzgebenden Körper. Einstweilen könne man 100 Millionen Thaler dazu verwenden, die mit 5 Procent zu verzinsen wären, der Capitalzins sei nicht mit dem Unternehmergewinn zu verwechseln. Diese Zinsen würden, wieder zu 5 Procent ausgelegt, in 14 Jahren das Capital verdoppeln, so daß man dann 200 Millionen hätte und jährlich 10 Millionen an Associationen austhun könnte. Die Associationen würden unter einander in Creditverband stehen (S. 43). Die Versammlung war oft unwillig und ungeduldig, und L. griff zu den stärksten Ausdrücken, um die Arbeiter aufzustacheln. „Ich würde es begreiflich finden, wenn auch tadeln, wenn Ihr die Maschinen zerstörtet, wenn Ihr Gewalt brauchtet, aber daß Ihr Euch gegen mich, der ich Euch helfen will, erklärt, wäre unnatürlich. Ihr solltet votiren: nein? Ihr solltet wie gezähmte Hausthiere Euch gegen Euch selbst wenden? Das wäre eine nationale Schmach“. Vier Stunden hatte er so gesprochen, als die Ungeduld und der Lärm der Versammlung den Schluß seiner Rede herbeiführte. Er gab sich aber nicht geschlagen. Zwei Tage darauf wurde die Versammlung wieder aufgenommen, die Stimmung war merklich günstiger geworden und er konnte mit mehr Selbstvertrauen und Pathos sprechen. Er wolle keine Gewalt, er fühle keinen Haß gegen die Besitzenden, er wolle den Triumph für den deutschen Namen, daß die Initiative in der socialen Frage von den Besitzenden selbst ausgeht, als ein Product der Wissenschaft und der Liebe (S. 55). Er will keine proletarische Revolution, er will die Ventile öffnen, um der Explosion vorzubeugen. Aber am Schluß erhebt er die leidenschaftlichsten Anklagen gegen die liberale Presse, die liberalen Philister und die ohnmächtige Fortschrittspartei. Als es zur Abstimmung kam, verließen die Anhänger Schulze's, die nunmehr in der Minderheit waren, den Saal und 400 Stimmen gegen eine nahmen den Antrag Lassalle's auf Beschickung der Leipziger Versammlung an. Ein so glänzendes Resultat hatte er selbst nicht erhofft. Diese Frankfurter Rede ist seine größte agitatorische Leistung. Die Rede selbst ist nicht einheitlich, sie leidet an der Verschmelzung vorbereiteter, ausgearbeiteter Theile mit Improvisationen, daher ist der Gedankengang oft unterbrochen und sind Wiederholungen häufig. Allein wirksam ist sie trotzdem in großem Maße. Die Lage der arbeitenden Classe wird mit ergreifenden Farben geschildert, ihre Leidenschaften, ihr Ehrgefühl wird aufgestachelt und darum ist sie unter dem Namen Arbeiterlesebuch eine Art Grundtext für die nachfolgende socialistische Agitation geworden. Einen Tag später sprach L. in Mainz zwei Stunden und siegte mit 800, Stimmen gegen zwei. Jetzt war der Feldzug praktisch eröffnet. Die Erfolge im Maingau thaten ihre Wirkung. Am 23. Mai 1863 traten Delegirte von Hamburg, Dresden und vielen rheinischen Städten in Leipzig zusammen und gründeten den allgemeinen deutschen Arbeiterverein, „welcher von der Ueberzeugung ausgehend, daß nur durch das allgemeine gleiche und directe Wahlrecht eine genügende Vertretung der socialen Interessen des deutschen Arbeiterstandes und eine wahrhafte Beseitigung der Classengegensätze in der Gesellschaft herbeigeführt werden kann, den Zweck verfolgt auf praktischem und legalem Wege, insbesondere durch den Gewinn der öffentlichen Ueberzeugung für die Herstellung des allgemeinen gleichen und directen Wahlrechts zu wirken“. Das Programm war also äußerlich fast ganz politisch auf Wahlreform gerichtet, und enthielt kein Wort über die socialen Reformpläne. L. wurde zum Präsidenten gleich auf fünf Jahre gewählt und mit einer fast dictatorischen Gewalt ausgestattet. Die übrigen Vorstandsmitglieder waren ziemlich unbedeutend, einige revolutionäre Schriftsteller und Arbeiter. Die Werbung von Mitgliedern ging langsam und mühselig vorwärts. Im August 1863 waren nicht mehr als 1000 Mitglieder im Verein. Die Gegner Lassalle's versuchten eine Gegenagitation, erzielten aber auch keinen rechten Erfolg, sie gründeten in Coburg eine eigene Arbeiterzeitung, hielten im Juni und im August in Frankfurt einen Congreß verschiedener Arbeitervereine, bei der zweiten Versammlung sprach Schulze, allein die Massen waren auch nach der anderen Seite nicht in Fluß zu bringen. Auch L. benützte den Sommer nicht recht zu weiterer Agitation.
Im Herbst 1863 hatte er die Appellverhandlung wegen seines Arbeiterprogramms zu bestehen. Die Verfolgung dieser Berliner Rede war der wichtigste Proceß seiner von den Gerichten so vielfach beunruhigten Laufbahn und er Pflegte diesen Proceß mit besonderer Sorgfalt. Sowie das erstrichterliche Urtheil erschienen war, versah er es mit kritischen Randnoten (Criminalproceß, 3) in der Art, wie er Julian Schmidt glossirt hatte. Er hatte eine merkwürdige Vorliebe für diese Art der Kritik, welche immer kleinlich und wortfängerisch ist und durch Ausrufungszeichen und Interjectionen nicht an Bedeutung gewinnt. Sein lebendiger Geist, dem gleich beim Lesen der glückliche Einfall kam, sein besonders|entwickelter Widerspruchssinn, der in einem solchen Falle, wo es gegen ihn persönlich ging, besonders geschärft war, führten ihn zu dieser Form von Polemik die aber auch unter seinen Händen oft ermüdend und läppisch wurde. Dagegen ist seine Vertheidigungsrede in zweiter Instanz vor dem Berliner Kammergericht die bedeutendste Rede, die er vielleicht überhaupt gehalten hat. Die Rede enthält anläßlich der Vertheidigung einiger incriminirter Stellen seines Vortrags einen allgemeinen Angriff gegen die indirecten Steuern und insbesondere den Nachweis, wie schwer diese Steuern auf der großen Masse des Volkes, also auf der ärmsten lasten. Zuerst führt er eine ganze Reihe sehr glücklich gewählter Citate, insbesondere aus der älteren französischen Litteratur über den unerträglichen Druck der indirecten Steuern an, und weist dann mit Kraft und Beredsamkeit nach, daß die indirecten Steuern nicht nach Capital und Einkommen sondern nach den Bedürfnissen umgelegt sind, daß sie im umgekehrten Sinn Progrefsiosteuern sind, die um so stärker jeden treffen, je ärmer er ist. Diese Ausführungen gehören zu dem besten, was überhaupt in der Literatur über die Nachtheile indirecter Steuern geschrieben wurde. Dann aber will er seinen Satz, daß die Grundsteuer eigentlich auch eine indirecte Steuer und daher auf den Getreidepreis überwälzbar sei, beweisen. Der Beweis des ersten Satzes gelingt ihm eigentlich gar nicht, denn nach einigen Citaten von Hoffmann, die aber gegen ihn sprechen, weiß er nichts anderes dafür anzuführen, als daß Ricardo jede Steuer auf Getreideproduction, welche nicht blos die Grundrente in seinem Sinne trifft, d. h. welche nicht die Acker schlechtester Qualität freiläßt, auf den Getreidepreis überwälzen läßt. Selbst von diesem Standpunkt müßte von dem Gesammtbetrag der Grundsteuer jener Betrag, welcher selbst nach Ricardo als Besteuerung der Rente anzusehen ist, auszuscheiden sein, und nur von dem übrigen Betrag, welcher auch den schlechtesten Boden träfe, könnte diese leichte Ueberwälzbarkeit gelten. Diese ganze Ueberwälzbarkeit beruht bei Ricardo nur auf dem Schluß, daß wenn die Ackerbauer die Steuer im Getreidepreis nicht vergütet erhielten, sie die Landwirtschaft aufgeben würden, dadurch würde das Getreideangebot vermindert und der Getreidepreis bis zu jener Höhe gesteigert, daß auch die Steuer ersetzt wird. Diese Voraussetzung wird nun thatsächlich fast nie eintreten, und sollten einige Landwirthe ihren Beruf aufgeben, so ist die ausländische Getreideeinfuhr da, um die Preise nicht um den Betrag der Grundsteuer steigen zu lassen. Die heutige Theorie, wie schon früher erwähnt wurde, hat diese Ricardo’sche absolute Ueberwälzung der Grundsteuer schon längst aufgegeben und nimmt eine Belastung der Grundrente durch einen großen Theil der Steuer und eine Grundcapitalentwerthung um den capitalisirten Betrag der jährlichen Steuer an. L. geht natürlich mit Ricardo so lange, als dieser die Belastung der Arbeiter als Consumenten durch die Grundsteuer behauptet und spricht von der Grundsteuer als von einer Getreidekopfsteuer. Nun ist aber Ricardo in seiner Ueberwälzungstheorie noch weiter gegangen und nimmt die Fortwälzung der Preiserhöhung der Lebensmittel auf den Lohn und damit auf den Capitalgewinn an, sodaß die Arbeiter effectiv gar keine Last von der ganzen Steuer zu tragen hätten und jede Steuer auf die arbeitende Clafse zuletzt eine Steuer auf den Unternehmergewinn ist. Das paßt natürlich L. nicht, allein wer, wie er, so streng an der Ricardo’schen Lohntheorie festhält, daß der Lohn nach den Kosten des nothwendigen Lebensunterhalts sich richtet, muß die Ricardo’sche Consequenz zugeben, daß, wenn die nothwendigen Lebensmittel durch Steuern vertheuert werden, der Lohn um diese Vermehrung der Productionskosten der Arbeit auch erhöht werden muß. Für seine Steuerargumentation aber verläßt er hier die Ricardo’sche Lohntheorie und läßt den Lohn durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, begeht aber hier einen Irrthum, der fast wie|eine absichtliche Irreführung aussieht. Er meint, durch die Getreibepreissteigerung werde der Arbeiter zwischen zwei Feuer genommen (S. 40), einmal leide er darunter als Consument, der den Lohn um den Betrag der Preissteigerung nicht erhöhen kann und dann deshalb, weil nach Ricardo die Steuer den Lohnfond, den Betrag des Nationalcapitals, der zu einer bestimmten Zeit auf Lohnzahlung zu verwenden ist, verringert. Nun soll dies allerdings nach Ricardo geschehen, aber nur deshalb, weil Ricardo alle Steuern, die auf unentbehrliche Lebensbedürfnisse gelegt sind, alle Lohnsteuern in letzter Linie auf den Capitalprofit fallen läßt, der die Steuer nur schwer im Productenpreis abwälzen kann, daher durch die Steuer in seinem natürlichen Wachsthum unterbunden wird und darum weniger Arbeitsnachfrage leisten kann. Wenn man aber, wie L. diese Fortwälzung der Arbeitssteuern auf den Capitalprofit leugnet, dann kann man nicht plötzlich der Steuer zugleich auch noch einen Einfluß auf die Grüße des Lohnfonds zuschreiben. Es kann immer nur eins von beiden geschehen, entweder leidet der Arbeiter als Consument der besteuerten Artikel, wie L. zuerst annimmt oder er leidet wegen Verringerung des Lohnfonds, wie Ricardo annimmt, beides zugleich ist aber unmöglich. Viel geschickter ist er bei seiner anderen Argumentation gegen Ricardo. Die Preissteigerung des Getreides im Lohn wird nach L. nur dann sich im Lohn ausdrücken, wenn das Getreide das einzige Nahrungsmittel ist, hat aber die arbeitende Classe noch andere Consumtionsartikel, wie Fleisch. Kaffee. Getränke etc., so wird sie sich an diesen abbrechen, um das theuere Brot zu bezahlen, der Lohn aber wird derselbe bleiben. Der standard of life wird also herabsinken und mit Recht führt er nationalökonomische Schriftsteller und statistische Daten dafür an, daß erfahrungsgemäß der Lohn immer nur sehr langsam der Preissteigerung der Confumartikel folgt, daß dazwischen eine lange Zeit der Entbehrung und Noth liege. Die indirecten Steuern mussen aber auf Massenartikeln liegen, wenn sie etwas einbringen sollen, und mit Leichtigkeit entkräftet er die Behauptung des Staatsanwalts von der finanziellen Bedeutung der Luxussteuern und dem Umfang des Consums der oberen Classen selbst an besteuerten Massenartikeln. Was die obere Classe verzehrt und dafür steuert, ist nur unbedeutend; ja selbst an directen Steuern worunter L. immer nur die Classen- und Einkommensteuer versteht, zahlt die wohlhabende Classe weniger als die unbemittelte. Die classificirte Einkommensteuer beträgt 2,9 Millionen Thaler, die Classensner für alle Steuerträger mit einem Einkommen unter 1000 Thaler 9,9 Millionen Thaler, zieht man aber selbst die Grenze bei 650 Thaler Einkommen, so zahlen die unteren Classen noch immer mehr als das Doppelte der oberen. Denn die obere Classe ist ja außerordentlich wenig zahlreich. Hier wiederholt er seine Statistik nach den preußischen Einkommensteuerausweisen. Nicht mehr als 44 000 Personen haben ein Einkommen von über 1000 Thalern und davon nur 11000 über 2000 Thaler (natürlich berücksichtigt er hier nicht die notorisch niedrige Einschätzung), und diese „lächerlich kleine Handvoll Menschen mit ihren Familien, die in allen Städten alle Theater, alle Concerte, Gesellschaften, Restaurationen. Weinstuben füllen, vermöge ihrer Ubiquität den Schein einer Wunder wie großen Anzahl erregen, nur an sich denken, nur von sich sprechen, die sich dünken, die Welt zu sein, bringen durch ihre Zeitungen auch die anderen dahin, es zu glauben. Und unter dieser Handvoll Menschen windet sich in stummer, unaussprechlicher Qual in wimmelnder Zahl das unbemittelte Volk von 17 Millionen, producirt alles, was das Leben verschönt, macht uns die unerläßliche Bedingung aller Gesittung, die Existenz des Staates möglich, schlägt seine Schlachten, zahlt seine Steuern und hat Niemand, der an es dächte und es verträte"(S. 57). Er malt dann an der Hand amtlicher Publicationen ein lebendiges Bild von der|Nothlage, nicht blos der gewerblichen, sondern auch der ländlichen Arbeiter. Die Rechtfertigung seiner Behauptung, daß die Bourgeoisie die indirecten Steuern zu einem unerhörten System entwickelt habe, gelingt ihm weniger, einmal bringt er eine Reihe historischer Citate, insbesondere aus Frankreich, um zu zeigen, daß im feudalen Mittelalter kein System der indirecten Steuern bestanden habe, aber seine prächtigen Citate aus Boisguillebert und Forbonnais über die unerträgliche Last der französischen indirecten Steuern, die er am Anfang seiner Rede im allgemeinen ins Treffen führt, beziehen sich auf die Zeit des absoluten Königthums und des alten Regimes und doch sicher nicht auf eine Zeit der Herrschaft der Bourgeoisie. Geschickter ist die Anführung der Thatsache, daß das preußische Ministerium Manteuffel im J. 1849 eine allgemeine Einkommensteuer einführen und dafür die Mahl- und Schlachtsteuer in Wegfall bringen wollte, daß aber der Neformplan an dem Widerstand der Kammern und der sogen. öffentlichen Meinung gescheitert sei. Die Gesammttendenz seines incriminirten Vortrags war nachzuweisen, daß mit dem Jahre 1846 eine dritte und neue Weltperiode eingetreten sei, bestimmt, um die sittliche Idee des Arbeiterstandes, das Princip der Arbeit zum herrschenden Princip der Gesellschaft zu erheben, er sollte die theoretische Grundlage liefern für eine gesetzliche und friedliche Agitation zu Gunsten des allgemeinen Wahlrechts. Er verwahrt sich gegen jede Sympathie mit dem Sansculottismus. „Wie?" ruft er aus. „es hat sich Jemand in einem faustischen Trieb mit der zähesten und ernstesten Mühe durchgearbeitet von der Philosophie der Griechen und dem römischen Rechte durch die verschiedensten Fächer historischer Wissenschaft bis zur modernen Nationalökonomie und Statistik und Sie könnten im Ernst glauben, er wolle diese gange lange Bildung damit schließen, dem Proletarier die Brandfackel in die Hand zu drücken?“ Aber die Revolution wird kommen. „Sie wird eintreten in voller Gesetzlichkeit und mit allen Segnungen des Friedens, wenn man die Weisheit hat, sich zu ihrer Einführung zu entschließen bei Zeiten und von oben herab — oder aber sie wird innerhalb irgend eines Zeitraumes hereinbrechen unter allen Convulsionen der Gewalt mit wild wehendem Lockenhaar, erzene Sandalen an den Sohlen (S. 131). Dem Staate schreibe ich die hohe gewaltige Aufgabe zu, die Keime zu entwickeln, wie er dies, seitdem die Geschichte steht, gethan hat und für alle Ewigkeit thun wird, und, als das Organ, das für alle da ist, an seiner schützenden Hand die menschliche Lage aller herbeizuführen, diese Doctrin ist keine Theorie der Zerstörung und Barbarei, es ist im höchsten Grade eine Staatsdoctrin. Die modernen Barbaren sind jene, welche am liebsten den Staat abschaffen, Justiz und Polizei an den Mindestfordernden verganten und den Krieg durch Actiengesellschaften betreiben lassen möchten, damit nirgends im ganzen All noch ein sittlicher Punkt sei, von welchem aus ihrer capitalbewaffneten Ausbeutungssucht ein Widerstand geleistet werden könne. Diesen gegenüber stehe ich mit den Richtern Hand in Hand, das uralte Vestafeuer aller Civilisation, den Staat vertheidige ich mit Ihnen gegen jene modernen Barbaren!“ Nie mehr hat L. so groß und so glänzend gesprochen. Die Rede ist lehrreich, überzeugend und erhebt sich am Schlusse zu einem wahrhaft edeln Pathos. Die Richter scheinen selbst unter dem Eindruck der Rede gestanden zu haben und wandelten die vier Monate Gesängniß der ersten Instanz in eine Geldstrafe von 100 Thalern um.
Aber er konnte diesen vornehmen Ton nicht immer einhalten. Die Noth der gemeinen Agitation drängte und er mußte wieder zu den Massen sprechen. Er war an den Rhein gegangen, um „Heerschau zu halten“. In Barmen, Solingen und Düsseldorf hielt er Ende September 1863 eine Brandrede, die er dann unter dem Titel „Die Feste, die Presse und der Frankfurter Abgeordnetentag“ als Broschüre herausgab. Sein Hauptangriff galt der Presse, die der Hauptfeind der Entwickelung des deutschen Geistes und des deutschen Volksthums sei. Sie sei verlogen, corrupt und feige. Die Presse müsse vom Capital emancipirt werden und das Mittel dazu sei das Verbot für die Zeitungen. Annoncen aufzunehmen. Gewiß ein thörichter Vorschlag. Dann goß er die vollen Schalen seines Zornes auf die Fortschrittspartei aus, welche trotz des rücksichtslosen Vorgehens der Regierung noch immer im Landtag sitze und den Muth habe, nach einer Reihe von beispiellosen Niederlagen noch Feste zur eigenen Verherrlichung zu feiern, und welche im Frankfurter Abgeordneten tag auf die Frankfurter Reichsverfassung zurückgreifen wolle. Die Frankfurter Reichsverfassung ist eine reactionäre und föderalistische Utopie, die für immer todt sei, rief er aus und vergaß, daß er vor einem halben Jahre noch die Frankfurter Reichsverfassung wegen der Aufnahme des allgemeinen Wahlrechts in dieselbe gepriesen hatte. Die deutsche Einigung sei nur im einheitlichen Nationalstaat möglich. Die liberale Opposition coquettire zugleich mit dem von Oesterreich einberufenen Fürftentag und mit dem Gedanken der preußischen Spitze. Bismarck habe Recht, wenn er sagte, sie verrathe Preußen, und die Großdeutschen haben Recht, wenn sie sagen, sie verrathe die große Einheitsidee. Die Fortschrittspartei behauptet und verleugnet alles in demselben Athem. Bismarck fürchte sie darum nicht, und wenn wir Flintenschüsse mit Hrn. v. Bismarck wechselten, so würde die Gerechtigkeit fordern, noch während der Salven einzugestehen, er ist ein Mann, jene aber sind alte Weiber. Der ganze Verfassungsconflict habe für das Volk kein Interesse, die preußische Verfassung hat gar nie zu Recht bestanden, alle Kammern waren seit der Octroyirung nur Usurpatorenhaufen, welche ab und zu im Namen der Bourgeoisie einen Patt mit der Regierung schlossen. Das war nicht mehr die vielgerühmte wissenschaftliche Sprache, das war die rohe Diatribe. Und als er am Schluß einen Bericht über die bisherigen Erfolge der Agitation gab, machte er übertriebene Angaben, aber selbst seine Ziffern waren nicht weniger als imvonirend. Welch ein Abstand zwischen diesen zwei Reden. Und doch ist auch dieser andere Ton begreiflich, denn das ist die Unerbittlichkeit einer demokratischen Agitation, daß das Niveau des Redners immer niedriger, die Sprache immer heftiger weiden muß. Jeder praktische Politiker, der von der Wissenschaft herkommt, wird am vornehmsten im Beginn seiner Laufbahn sprechen. Will er in seiner Partei Einfluß gewinnen oder gar erst eine Partei und sogar eine demokratische Partei gründen, so muß er herabsteigen zu den Borurtheilen und Leidenschaften der Menge und muß ihre Sprache sprechen. So kommt er zu Beifall, und Beifall muß der politische Parteimann und noch mehr der Agitator haben, einmal seiner selbst willen, um aufrecht zu bleiben, und dann wegen seiner Anhänger, denn der Beifall der Einen gewinnt die Anderen. Die Aufnahme Lassalle's am Rhein war immer herzlicher als anderswo, die Arbeiter strömten in Masse herbei, jubelten ihm zu, allein dauernden Effect hatte auch diese Rede nicht. In Solingen kam es zu einem Auflauf, die Versammlung wurde vom Bürgermeister geschlossen, L. beschwerte sich direct beim Ministerpräsidenten Bismarck, allein die Behörde bestätigte hinterher den Auflösungsbefehl und gegen die Rede selbst wurde sofort vom Staatsanwalt die Anklage erhoben.
Aber vor allem mußte Berlin gewonnen werden, das sich bisher ziemlich kühl verhielt. Im October 1863 hielt L. eine „Ansprache an die Arbeiter Berlins“, um sie zum Eintritt in seinen allgemeinen deutschen Arbeiterverein aufzufordern. Wieder bringt er ganz unnützer Weise die heftigsten Angriffe gegen die preußische Verfassung vor und verlangt das allgemeine Stimmrecht, nicht so sehr aus allgemein demokratischen Gründen, als weil es dem Volk durch|die Reaction widerrechtlich entrissen sei. Er selbst, welcher an den Ereignissen von 1848 einen, wenn auch unbedeutenden, Theil genommen und gerade gegen die Octroyirung sich erhoben hatte, und dessen politisches Rechtsgefühl verletzt war, empfand noch immer lebhaft jene Gewaltmaßregel, allein die Arbeiter hatten 15 Jahre später nicht einmal eine Erinnerung an jene Vorgänge von 1848. Er rühmte sich immer, daß die Verbindung des Politischen und des Socialen seine Stärke sei, allein im J. 1863 die Arbeiter Verlins an das Unrecht mahnen, das ihnen im J. 1848 widerfahren, war nicht praktische Politik, auf dieses politisch unreife Publikum wirkt nur die Schilderung seiner Classenlage und der Hinweis auf Abhülfe. Er verwahrte sich in seiner Rede gegen die Verdächtigung, als ob er der Reaction diene, die Fortschrittspartei hasse ihn vielmehr als Revolutionär. Die rheinischen Arbeiter gehen mit ihren Sympathien für den deutschen Arbeiterverein allen voran, so wie im J. 1848. Damals handelte es sich darum, Barricaden zu bauen, heute durch eine imposante Demonstration das allgemeine Wahlrecht zu erobern. Er ließ die Rede in einer großen Anzahl von Exemplaren verbreiten, allein er brachte in Berlin keine rechte Bewegung zu Stande. Nur wenige Arbeiter traten in seinen Verein. Das wirksamste Agitationsmittel in großen Städten, einige Massenversammlungen zu halten und so wieder ein paar große Reden ins Publicum zu schleudern, tonnte er nicht anwenden, weil ihm die Polizei solche Volksversammlungen entweder verboten oder sofort aufgelöst hätte, und weil ihm selbst in seine kleinen Versammlungen lärmende Störenfriede eindrangen, welche eine große Versammlung bald durch Scandal gesprengt hätten. So las er während des Winters in schwach besuchten Vereinsversammlungen seine älteren Reden und Broschüren vor, sicher von allen Agitationsmitteln das unwirksamste. Er war ermüdet, die ganze Last der Agitation ruhte allein auf seiner Person, er mußte Reden halten, reisen, in Zeitungen schreiben, die Vereinsangelegenheiten verwalten, nach allen Seiten correspondiren. Seine großen Reden waren sehr sorgfältig ausgearbeitet, nahmen daher viel Zeit und Mühe in Anspruch, dann regte der Tag der Rebe seine Nerven sehr auf, sodaß er nicht, wie der berufsmäßige socialdemokratische Agitator der siebziger Jahre fortwährend auf der Platform stehen konnte. Dabei wurde er von der liberalen Presse unanständig angefeindet und als Werkzeug der Reaction hingestellt. Beeinflußt war L. sicher nicht von der Regierung, allein daß er durch seine Agitation der Regierung einen Dienst erwies, darin hatten die liberalen Zeitungen vollkommen Recht. Wenn eine liberale Partei mit einer halbabsolutistischen Regierung um die Erweiterung des Rechtes der Kammern, um den politischen Einstich der Mittelelassen kämpft, dann ist jede demokratische Diversion im Rücken der Liberalen, vorausgesetzt, daß sie nicht wirklich zur Macht kommt, was in der Regel nicht der Fall ist, nur ein Schlag für die Liberalen und ein Dienst für die Regierung, welche darauf hinweisen kann, daß sich die Masse des Volks um die constitutionellen Streitpunkte, ja um das ganze parlamentarische System gar nicht kümmere, daß also die ganze liberale Opposition nur das Streben einer ehrgeizigen Clique sei, daß also das Königthum Recht habe, nicht nachzugeben. So wird in solchen Zeiten jeder demokratische Agitator ein Verbündeter der reactionären Regierung, beide kämpfen gemeinsam, wie sie sagen, gegen die Macht der Bourgeoisie, aber in der Regel wird der demokratische Allürte bald der Dupirte der Regierung, den gebildeten Mittelclassen wird der Einfluß auf die Staatsgewalt entzogen, aber das Volk erhält auch nicht den geringsten politischen Einfluß und die absolutistische Regierung wird allein gekräftigt. Diesen Kreislauf der Carrière demokratischer Agitatoren, der mit der Uebermacht der Regierung und der Niederlage der Agitation endet, will aber der selbstbewußte Volksführer niemals zugeben, er|träumt von einer Macht, die hinter ihm stehe und die ihn berechtige, mit der Regierung, wie von Macht zu Macht zu verhandeln. Dabei fühlte sich L. zur Person Bismarck's hingezogen. Die Rücksichtslosigkeit und Ausdauer Bismarck's im Conflicte erregte seine Bewunderung und der gemeinsame Gegensatz gegen die Fortschrittspartei ließ ihm den Wunsch nach einer persönlichen Annäherung als nicht unberechtigt erscheinen. Der Ministerpräsident empfing L. auch einige Male und hat viele Jahre später in der Debatte über das Socialistengeseß im deutschen Reichstag selbst einige treffende Bemerkungen über seine Unterhaltungen mit L. und über dessen Persönlichkeit gemacht. Bismarck fand Gefallen an der geistreichen Manier Lassalle's, den er, wie er sagte, ganz gern als Gutsnachbar gehabt hätte. L. wäre ganz national und monarchisch gesinnt gewesen, wobei es freilich offen blieb, ob die nationale Monarchie mit einer Dynastie Hohenzollern oder Lassalle abschließen solle. Aber eine Abmachung fand nicht statt, auch nicht einmal eine moralische Unterstützung wurde gewährt. Bismarck wußte zu gut, wie wenig wirklichen Erfolg Lassalle's Agitation hatte. L. konnte ihm nichts bieten, er unterhielt sich mit ihm wie mit einer Curiosität, scheint ihn aber für die praktische Politik nicht einmal ganz ernst genommen zu haben. Hatte L. auch hier nur einen Mißerfolg zu verzeichnen, so nahmen ihn dazwischen die gerichtlichen Verfolgungen forwährend in Anspruch. Seine letzte rheinische, seine letzte Berliner Rede wurden verfolgt und gegen die gerichtlichen Vertheidigungsreden nach ihrer Veröffentlichung auch wieder die Anklage erhoben.
Hatte so die praktische Agitation eigentlich nur einige vorübergehende glänzende Momente, aber keinen dauernden Erfolg gehabt, so mußte sie doch weitergeführt werden, wollte man nicht die ganze Bewegung als gescheitert erklären. L. fühlte das Bedürfniß, seine Gedanken, die er bisher nur zerstreut in Reden und Broschüren veröffentlicht hatte, in einer wissenschaftlichen Form zu vertiefen und theoretisch zu begründen. Er wollte einen theoretischen Codex seiner Lehre für Anhänger und Gegner schaffen und trotzdem er von allen Seiten gehetzt und geistig abgespannt war, schrieb er im Laufe des Winters 1863/64 ein größeres Buch: „Herr Bastiat'-Schulze oder Capital und Arbeit“. Die Form dieses Buchs trägt die Unruhe und Hast seiner Entstehung an der Stirn. Zunächst enthält es eine Kritik gegen den Arbeiterkatechismus von Schulze und wiederholt jene kleinliche und geschmacklose Form der Polemik, die L. schon gegen Julian Schmidt auf die Spitze getrieben hatte. Es wimmelt von persönlichen Angriffen und Grobheiten, von prahlerischem Selbstlob der eigenen Gelehrsamkeit und ist auch in seinen übrigen Theilen schriftstellerisch schlecht gemacht. Schulze gebrauchte in jener populären Broschüre allerdings eine etwas nachlässige Ausdrucksweife und dringt in die methodische Deduction nationalökonomischer Begriffe nicht ein, so daß es L. manchmal leicht wird, einzelne Stellen ab absurdum zu führen. Schulze ging in seiner Schrift allerdings zunächst vom privatwirthschaftlichen Standpunkte aus, L. betont dagegen mit aller Einseitigkeit den socialen Charakter der ganzen Volkswirthschaft, das Ineinandergreifen und die Solidarität der Production. Wenn Schulze den alten Satz von A. Smith wiederholt, daß der Producent erst für seinen eigenen Bedarf producire und erst den Ueberschuß abgebe, so seien solche kleinbürgerliche Anschauungen bei der Theilung der Arbeit und der Massenproduction für den Weltmarkt einfach lächerlich, wenn Schulze jene Güter Capital nennt, welche nicht sofort verzehrt werden, so wendet L. ein, es gebe ja für die Nationalökonomie ein umlaufendes Capital, welches für Löhne, also zur augenblicklichen Verzehrung ausgegeben wird, wobei er die Sache offenbar verdreht, denn Schulze meinte und mit ihm die ganze Nationalökonomie, dabei die Nichtverzehrung durch den Eigenthümer des Capitals, nicht aber eine fremde Confumtion. Mitten durch die ermüdende und|oft geschmacklose Polemik, welche häufig nur eine Wortfängerei ist, und in dem zweiten mehr positiven Theil des Buches entwickelt L. seine eigenen Ideen über einige Hauptfragen der Nationalökonomie, ohne aber ein eigentliches socialistisches System aufzustellen. Vor allem wendet er sich gegen die von Schulze theilweise aufgenommene Werththeorie Bastiat's, welcher im Gegensatz zur englischen Nationalökonomie den Werth der Güter nicht durch die zu ihrer Hervorbringung nöthige Arbeit bestimmen läßt, sondern nach dem Dienst mißt, welcher dem Nachfragenden dadurch erwiesen wird, daß ihm die Arbeit zur Production des Gutes erspart wird. Die Theilung der Arbeit, erwiedert L., bringt es vielmehr mit sich, daß niemals die durch den Dienst ersparte Arbeit, sondern nur die unendlich geringere und immer geringer werdende Positive Arbeit, die zur Production des Gegenstandes erforderlich war, den Werth bestimmt. Die alte englische Auffassung, daß aller Werth auf Arbeit beruhe, sei unanfechtbar. Die einzige Einwendung, die L. sich selbst macht, wäre nur die, daß unter den heutigen Productionsverhältnisfen durch technische Fortschritte der Betrag der Productionskosten, d. i. das zur Production nöthige Arbeitsquantum plötzlich sinken kann und damit der Werth des Productes sinkt oder daß durch Aenderungen im Geschmack oder in den Bedürfnissen oder durch Ueberproduction plötzlich der Preis der Waare fällt, sodaß das auf ihre Herstellung wirklich verwendete Arbeitsquantum nicht mehr der Maßstab ihres Werthes ist. Diese Widersprüche gegen die Arbeitstheorie des Werthes sind nun nach L. nur durch die Marx’sche Formel der allgemein gesellschaftlichen Arbeitszeit zu lösen. Wenn durch Fortschritte in der Production nur weniger Arbeit zur Herstellung des Gutes nöthig ist, dann verliert die individuell zu viel geleistete Arbeit ihren Werth. Ein Satz, der vollkommen richtig ist, aber nicht nur in der privatwirthschaftlichen Praxis längst bekannt war, sondern von Hermann schon ganz bestimmt deducirt worden ist. Nach diesem scharfsinnigsten deutschen Nationalökonomen sind die sog. anderweitigen Anschaffungskosten, welche die Production jener Güter erfordert, die noch zur Versorgung des Marktes nöthig sind, bestimmend für den Preis aller Güter; werden nun diese Kosten niedriger, so werden sie wieder die normalen Kosten sein und als solche den Preis herabdrücken. Auf der anderen Seite der Werthsverminderung durch Geschmackveränderung oder Ueberproduction aber fällt Marx und mit ihm L. plötzlich aus seiner Arbeitstheorie des Werthes in die entgegengesetzte von ihnen bekämpfte Bedürfnißtheorie. Hier ist es nicht die geringer gewordene gesellschaftlich nothwendige Arbeit, welche den Preis herabdrückt, sondern wie Mehring sehr richtig gegen L. bemerkt, der veränderte gesellschaftliche Bedarf nach dem Gute, also das von der socialistischen Werththeorie bekämpfte Preiselement der Nachfrage, welches den Preis erniedrigt, und damit ist die Arbeit des Unternehmers, welcher den Zweck der Arbeit, die Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse durch Anpassung der Production an die Nachfrage regelt, nicht mehr werthlos und wenigstens ein Theil des Unternehmergewinns gerechtfertigt. Die ganze Werttheorie Lassalle's und der Socialisten hat immer die praktische Tendenz, die Unrechtmäßigkeit des Unternehmergewinns zu beweisen. Der Werth eines Products wird bestimmt durch sein Arbeitsquantum, der Arbeiter aber erhält nur den Lohn, welcher geringer ist als der Werth seines Arbeitsquantums und dieser Abzug vom vollen Arbeitsertrag bildet den Capitalprofit. In den Falten dieses Unterschiedes zwischen Arbeitsertrag und Arbeitslohn steckt nach L. die ganze sociale Frage (S. 125) und es sei ein Verdienst der englischen Nationalökonomie, daß sie zum Unterschied gegen die Franzosen, welche Capitalzins und -Prosit als constituirende Preiselemente der Güter durch die Confumenten bezahlen lassen, den Capitalzins und -Profit nicht als Preisfactor anerkennen, und er beruft sich dabei|auf Ricardo, ohne aber eine bezügliche Stelle von ihm anzuführen, während Ricardo im Capitel über Capitalprofit ausdrücklich den Werth der Maaren aus zwei Elementen, dem Capitalgewinn und den Löhnen nebeneinander bestehen läßt (Principles, p. 60). Uebeihaupt folgt L. Ricardo nur soweit es ihm gerade paßt. Der Satz von Ad. Smith, daß Arbeit die „Quelle aller Werthe“ sei, wird von Ricardo dahin erweitert, daß nicht blos die zur Hervorbringung des Gutes nothwendige Arbeit, sondern auch jene Arbeit, welche auf Arbeitsinftrumente, Gebäude etc. verausgabt worden, theilweise in den Werth des Products übergeht und daher den Preis bestimmt (s. III. p. 16). Und diese zweite Art von Arbeit ist nichts anderes als Capital, d. i. das Product früherer Arbeit, das für einen späteren Arbeitsproceß Hülfsstoff, Instrument oder Productionsmittel im allgemeinen ist. Damit hat Ricardo vorweg auch die Productivität des Capitals gesichert, darum läßt er auch von allem Anfang an Capitalformen bestehen. L., wie die meisten Socialisten, will nun die alte Herkunft und die in der Natur des Productionsprocesses liegende berechtigte Productivität des Capitals nicht zugeben, ihm ist das Capital nur eine historische Kategorie (S. 199, 201), gerade so wie das Eigenthum. Seine Productivität ist kein Naturgesetz, sondern eine Wirkung von ganz bestimmten historischen Zuständen, die mit anderen historischen Zuständen wieder verschwinden kann und muß (S. 201). Der Bogen in der Hand des Indianers ist kein Capital, wenn auch Arbeitsinstrument, weil er in jenem primitiven Zustande nicht werbend angelegt werden kann. Die selbständige Productivität des Capitals ist nur möglich bei seiner Trennung von der Arbeit und bei einem allgemeinen System der Theilung der Arbeit (S. 161). Die Production unter Theilung der Arbeit, welche allein einen Ueberschuß über den Tagesbedarf giebt, setzt um möglich zu sein, immer schon wieder einen vorhergegangenen Ansatz von Capitalansammlung und somit immer wieder eine schon vorhergegangene Theilung der Arbeit voraus, welche allein diesen der individuellen Arbeit unerschwinglichen Ueberschuß über den Tagesbedarf beschaffen kann (S. 99). Aber um selbst bei dem Beispiele Lassalle's vom Bogen des Indianers zu bleiben, ist gar kein Zweifel, daß durch die Benützung der Waffen mehr Wild erlegt wird, als ohne sie, daß daher das Arbeitsproduct um so viel größer ist, daß also ein Theil dieses Arbeitsproductes auf die Arbeit des Jägers, ein anderer Theil aber auf die Abnützung und den Gebrauch der Waffe entfällt. Dies gilt ebenso wenn die Arbeit getheilt ist oder nicht, ist der Besitzer des Werkzeugs und der Arbeiter in einer Person vereinigt, so kommt ihm beides zu Gute, sind es verschiedene Personen, so muß der Besitzer des Werkzeugs für dessen Ueberlassung eine Gebrauchsmiethe erhalten. Die verhältnißmäßige Große dieser beiden Theile gehört in die Frage der Vertheilung und kann verschieden bemessen werden, ändert aber gar nichts an der Richtigkeit des Satzes daß das Capital in allen seinen Formen, als Rohstoff. Werkzeug u. s. w. einen Theil des Products erzeugt, also unter allen Umstünden productiv ist. Um die Productivität des Capitals nur als ein Phänomen der heutigen Productionsweise darzustellen, geht L. die Geschichte durch und nimmt mit Rodbertus an, daß ursprünglich alle Arbeit nur Sklavenarbeit war. Derjenige, welchem nicht nur das Arbeitsinstrument, sondern auch der Arbeiter als rechtliches Eigenthum gehört, könne nicht Capitalist sein, wobei er gleich von Rodbertus abweicht, dem er sonst in der historischen Darstellung folgt, indem dieser gerade die Sklaven das hauptsächlichste antike Capital genannt hat. Die antike Hauswirthschaft war Naturalmirthschaft, aber selbst L. muß zugeben, daß in nicht allzu später Zeit des Alterthums der Handel und die Production von Tauschwaaren in fast kapitalistischer Weise sich entwickelten (S. 167). Ebenso war die Wirtschaft der mittelalterlichen Adeligen nur Naturalwirthschaft, er meint|aber, daß im Mittelalter wegen der Einschränkung der Zünfte auf einen bestimmten Betriebsumfang auch das Gewerbe nicht im Stande war, den Productionsertrag zu capitalifiren (S. 178). Er übersieht dabei völlig, einmal daß es Gewerbe vor und neben den Zünften gegeben hat, dann daß sicher der größte Theil des mittelalterlichen Handelscapitals und damit auch die Anfänge des großen industriellen Capitals durch Ersparnisse des mittelalterlichen Gewerbes entstanden sind, weil er überhaupt nicht zugeben will, daß individuelle Arbeit sparen oder daß Capital durch Sparen entstehen könne (S. 86. 100). In seinen Briefen an Rodbertus gibt er übrigens vom privatwirthschaftlichen Standpunkt die Möglichkeit dieser Capitalbildung zu (S. 53) und damit ist aber auch die allgemeine nationalökonomische Bedeutung des Sparens und Ansammelns für künftige Productionszwecke zugestanden. Aber in seinem Bastiat-Schulze beginnt die Capitalbildung erst mit der französischen Revolution, mit der freien Concurrenz, den Vorschüssen zur Production, der organisirten Theilung der Arbeit und der Massenproduktion (S. 101. 203). Woher diese Vorschüsse zur Production stammen, wird natürlich nicht untersucht, weil er sonst sicher auf ihre Entstehung durch Sparen hätte kommen müssen. Für ihn springt das große Capital plötzlich wie eine politische Revolution in die Welt und gegen diese Großproduction setzt er nun seine volle Kritik ein. Ihr Wesen und Gedeihen ist nur möglich bei der Speculation und Conjunctur (S. 29), aber der Arbeiter ist von diesem Glücksspiel ausgeschlossen, sein Rücken ist der grüne Tisch, auf welchem die Speculanten würfeln (S. 32). Die Position des Capitals ist eine so günstige, daß es vom Consumenten immer die ganzen Erzeugungskosten, Arbeitsquanta oder Arbeitszeit bezahlt erhält, privatwirthschaftliche Verluste durch Preissturz und mißlungene Speculation können Einzelne treffen, das Capital als Unternehmerstand kann niemals zu Schaden kommen, als ob nicht bei großen Krisen die Preise aller Artikel weit unter die Kosten fallen könnten und als ob sich das Vollscapital nicht aus der Summe der einzelnen Privatcapitalien zusammensetzte. In der Vertheilung des Productionsertrags liegt unter den heutigen Productionszuständen die privilegirte Stellung des Unternehmers. Der durchschnittliche Arbeitslohn ist durch das eiserne Lohngesetz auf den volksüblichen nothwendigen Lebensunterhalt beschränkt. An Stelle der menschlichen Beziehungen, die das Arbeitsverhältniß selbst zu Zeiten der Sklaverei und Leibeigenschaft hatte, steht heute die kalte unpersönliche Beziehung des Unternehmers auf den Arbeiter wie auf eine Sache, die wie jede andere Waare auf dem Markte nach dem Gesetz der Productionskosten erzeugt wird. Wird es üblich, auch Kinder in den Fabriken zu beschäftigen, so fängt der Markt von neuem an zu rechnen, er findet daß der Vater nicht mehr die volle Lebensnothdurft für eine durchschnittliche Familie zu erhalten braucht, sondern mit weniger vorlieb nehmen kann, da ja die Kinder zu ihrem eigenen Unterhalt beitragen (S. 188). Er wiederholt hier womöglich mit noch größerer Schroffheit als in seinen früheren Schriften das Ricardo’sche Lohngesetz, das man in Deutschland und Frankreich mit mehr Recht das Lassalle’sche Lohngesetz zu nennen Pflegt. Denn Ricardo, der doch in dogmatischer Formulirung alle deductiven Nationalökonomen übertrifft, sagt hier selbst, daß unter der Herrschaft des Bevölkerungsprincipes (von Malthus) jenes Gesetz nur von den Löhnen der niedrigsten Art gelte, und man nicht annehmen dürfe, daß jener natürliche Preis der Arbeit, selbst in unentbehrlichen Nahrungsmitteln geschätzt, absolut fix und constant sei, er wechsele nach Zeit und Ort und hänge wesentlich von den Lebensgewohnheiten des Volkes ab, daher müsse der standard of lite erhöht werden, um die Gefahren der allzu großen Fortpflanzung abzuwenden und das Lohnniveau im allgemeinen zu heben (Principles 52. 54. 93). Dazu kommt, daß die ganze|Ricardo’sche Lohntheorie auf der Annahme eines sog. Lohnfonds beruht. Das zu einem bestimmten Zeitpunkt für Lohnzahlungen disponible Capital der Unternehmer durch die jeweilige arbeitende Bevölkerung dividirt gebe den Marktpreis der Arbeit auf den einzelnen Kopf. L. hat zwar in seiner Rede über die indirecten Steuern die Lohnfondtheorie ohne Kritik gegeben, spricht sich aber in seinem Briefwechsel mit Rodbertus (S. 53) entschieden gegen diese Theorie aus, wie er dies als Socialift auch thun muß. Die alte englische Lohnfondtheorie hängt mit der Auffassung zusammen, daß nur Rente und Capitalprofit Reineinkommen seien, der Lohn aber nur als ein Theil der Bruttoauslagen der nationalen Production anzusehen sei, und die Lohnfondstheorie selbst ist eigentlich von den englischen Nationalökonomen erfunden worden, um den Arbeitern die Wirkungslosigkeit von Arbeitseinstellungen einzureden. L. hält sich aber trotz seiner vielgerühmten Wissenschaftlichkeit bei all' diesen schwierigen Fragen nicht auf, er läßt jede Einschränkung bei Seite und in der Polemik wird bei ihm der gewohnheitsmäßige volksübliche Lohn sehr häufig zum absoluten, natürlichen Lohn, der unerbittlich nur die Lebensfristung gestattet. Die Thatsache, daß es den Arbeitern durch strengere Lebenshaltung und geschlossenes Vorgehen wie in den englischen Gewerkvereinen gelungen ist, sich aus der ohnmächtigen Stellung des Lohnfondsdivisors zu einem sehr selbständigen Factor bei der Feststellung des Lohnsatzes zu machen und den Lohn dauernd zu erhöhen, verschweigt L. natürlich. Ebenso wendet er sich wieder gegen die Vergleichung jetziger Lohnsätze mit jenen der Vergangenheit und verlangt wie in seiner Frankfurter Rede die Vergleichung der heutigen Lage der Arbeiter mit jener der oberen Classen der Gegenwart. Das mag agitatorisch wirksam sein, ist aber für seine Lohntheorie nicht ausreichend. Die Vergleichung früherer und jetziger Lohnsätze zeigt die Verbesserung des Lebensfußes der Arbeiter in vielen Gewerbszweigen, allein wenn schon L. durchaus nur gleichzeitige Einkommenverhältnisse mit einander vergleichen will, so sollte er den Lohn der gelernten widerstandsfähigen Arbeiter mit dem der schwachen unwissenden Tagelöhner vergleichen, da wird sich zeigen, daß innerhalb des verderblichen Lohnsystems durch Kraft, Tüchtigkeit sich ein ganz anderes Niveau als die bare Nothdurft erreichen läßt. Und dieser höhere Lohn, den sich die Arbeiter allmählich erzwingen, wird im Preise der Producte von den Consumenten bezahlt, was dem Standpunkt Lassalle's, welcher im Productenpreis nur Vergütung von Arbeitszeit und Arbeitsquantum sehen will, ganz entspricht. Wenn er aber sein Lohngesetz immer nur als Naturgesetz hinstellt, damit also auch dessen Voraussetzung, die Bevölkerungstheorie von Malthus als unbestreitbar annimmt, dann wird die Regel, daß jede Verbesserung der Lage den Arbeiter sofort zur vermehrten Fortpflanzung führe, auch unter anderen Einkommensformen als unter dem Lohnsystem gelten und die arbeitenden Classen wieder gleich hart treffen. Treibt er so die Lehre Ricardos, die dieser selbst nur als eine Tendenz der untersten Lohnstufe bezeichnet hatte, auf die Spitze, so acceptirt er hinwiederum die weitere Behauptung Ricardo's nicht, daß mit dem Fortschreiten des Nationalwohlstandes, der Bevölkerung und der Lebensmittelpreise ein immer größerer Antheil der Gesammtproducte auf Rente und Löhne und ein geringerer auf den Capitalprofit fällt. Hier folgt L. ganz Rodbertus, welcher ihn ja so vielfach beeinflußte und behauptet mit diesem die beständige Abnahme des verhültnißmäßigen Arbeitslohnes, d. h. bei steigender Productivität der gesellschaftlichen Arbeit wird der Lohn der arbeitenden Classe ein immer geringerer Theil des Nationalproducts, weil, wie Rodbertus sagt, die Arbeiter vermöge des Lohngesetzes gezwungen sind, sich sofort mit der niedrigsten Lebensnothdurft abfinden zu lassen, wenn auch die Arbeit productiver geworden ist. Diese sehr schwierige Frage des relativen Arbeitslohns ist nicht ohne Beziehung auf die Größe des|stehenden Capitals zu lösen. Nimmt in großen Productionszweigen das stehende Capital, namentlich der Gebrauch selbstthätiger Maschinen zu, dann wird allerdings die Arbeitsquote am Gewinn geringer werden, allein nicht vermöge des Lohngesetzes, sondern wegen der geringeren Leistung der Arbeit gegenüber der Leistung der Maschinen. Carey meint, daß in diesem Falle wegen der massenhaften Production ein immer geringerer Werththeil der einzelnen Producte auf die Reproduction des Capitaleinsatzes entfällt, daher der Arbeitsantheil mit steigender Productivität steige. Aber von der menschlichen Arbeit geht in einem solchen Falle ein noch viel geringeres Werththeilchen auf das einzelne Product über, auf sie kann daher keine steigende Entlohnung vom einzelnen Stück entfallen. Die weitere Folge wird die Verringerung der Arbeiterzahl in diesem Gemerbszweige sein, wo aber der Einzellohn der wenigen, die selbthätigen Maschinen überwachenden Arbeiter wohl höher sein kann und wird, als der Einzellohn der zahlreichen Arbeiter, welche früher das Product mit wenig oder gar keiner Maschinerie, also mit viel mehr Arbeit hergestellt haben. Ist dagegen das stehende Capital gering wie bei Bergwerken, in der Landwirthschaft, im Kleingewerbe, so wird mit der steigenden Civilisation der Arbeiter mehr leisten, und auch der Arbeitsantheil am Product zunehmen. L. geht in ähnliche Unterscheidungen nicht ein, er führt überhaupt den Rodbertus’schen Satz von der Abnahme des relativen Arbeitslohnes nicht aus, untersucht auch niemals im Detail das Verhältniß zwischen Capitalzins und Capitalprofit, er wendet sich nur gegen den Capitalprofit in allen seinen Formen. Niemals sei der Capitalprofit als Lohn für die geistige Arbeit des Unternehmers aufzufassen und zu rechtfertigen. Eine Entlohnung gebührt den Leitern allein, diese ist aber gering und mit Recht so gering, wie dies der relativ geringe Betrag der Directoren- und Beamtengehalte einer Actiengesellschaft im Verhältniß zum Betrag der Capitaldividende beweist (S. 197). Der Capitalprofit beruht auf der Productivität des Capitals und diese wieder auf der Theilung der Arbeit. Mit Rodbertus bezeichnet er die Theilung der Arbeit als die Quelle aller Kultur und Productivität; aber vermöge der heutigen socialen Ordnung, vermöge des Privatbesitzes an Capital ist jetzt das vom Arbeiter getrennte Arbeitsinstrument Productiv und der lebendige Arbeiter zum todten Arbeitsinstrument herabgesetzt (S. 203). Vermöge dieses socialen Gesetzes bemächtigen sich die Capitalisten des Arbeitsproducts anderer. Die Herrschaft des Capitals als solchen ist unter dieser socialen Ordnung um so mächtiger als sie auch innerhalb des Capitalistenstandes selbst immer zum Siege des großen über das kleine Capital führt (S. 208), und wenn man den Socialismus Vertheilung des Eigenthums von Gesellschaftswegen nennt, so ist gerade der heutige Zustand ein anarchischer Socialismus. Das Eigenthum ist Fremdthum geworden (S. 209). Die ganze Kritik der capitalistischen Productionsweise von Rodbertus und L. beruht darauf, daß sie ihren Fundamentalsatz, daß alle Producte Arbeitsproducte sind, immer nur in nationalwirthschaftlichem Sinne auffassen; weil alles Arbeitsproduct ist, darum soll der ganze Arbeitsertrag der Arbeit gehören, darum ist Capitalgewinn ein Unrecht. Solange es aber selbständige Wirthschafts- und Rechtssphären giebt, so lang es individuelle Arbeiter und nicht blos die Arbeit schlechthin als nationalökokomische Kategorie geben wird, so lange reicht diese ausschließlich nationalwirthschaftliche Auffassung, die alle privatwirthschaftlichen Vorgänge gerade der Arbeitstheilung übersieht, nicht aus. Zugegeben daß das Product Arbeitsertrag ist, kann man denn, wie L. in einem Brief an Rodbertus es will, den Arbeitern einer Fabrik den ganzen Gewinn, also den ganzen Arbeitsertrag zutheilen? Selbst wenn alle Rohstoffe, Arbeitsinstrumente, welche die Arbeiter dieser Fabrik gebrauchen, auch nur Arbeitsproduct anderer Arbeiter sind, so ist das Arbeitsprodukt diese- früheren Arbeiter|Capital für den Arbeitsproceß der nachfolgenden Arbeiter, welcher ohne diese vorgethane Arbeit gar nicht vollzogen werden konnte. Vom Werth ihres neuen Products entfällt daher ein Theil auf die vorgethane Arbeit und die ersten Arbeiter haben daher Anspruch auf einen Theil des Arbeitsertrages der nachfolgenden Arbeiter. Und dabei ist es gleichgiltig, ob die ersten Arbeiter den nachfolgenden Arbeitern diese Arbeitsinstrumente, Rohstoffe, dieses Capital dargeliehen haben, oder ob eine Mittelsperson diese Producte im privatrechtlichen Verkehr an sich gebracht und den nachfolgenden Arbeitern zur Benützung überläßt, oder ob die nachfolgenden Arbeiter selbst durch Credit, oder Geschenk, oder Ersparniß diese Capitalien erworben haben. Immer muß ein Theil des Arbeitsertrages zur Vergütung für dieses capitalistische Element der Production verwendet werden, weil die bloße menschliche Arbeit des letzten Arbeitsprocesses das Product ohne Maschinen und Hilfsstoffe niemals allein herstellen kann. So lange nicht alle Productionsmittel außerhalb des Privateigenthums sowohl der Arbeiter als der dazwischen tretenden Capitalisten gesetzt werden, so lange muß es einen individuellen Capitalgewinn geben, mögen ihn nun individuelle Arbeiter oder individuelle Capitalisten erhalten. Das letzte Ziel des Socialismus muß daher die Einziehung aller Capitalien durch den Staat sein und L. sagt in einem Briefe an Rodbertus selbst ganz bestimmt, daß seitdem er ökonomisch denke, der innere Kern seiner Ansichten sei, das Grund- und Capitaleigenthum abzulösen, aber dem Mob dürfe man das heute noch nicht sagen (S. 46). In seinem Bastiat-Schulze deutet er diesen Gedanken übrigens ziemlich deutlich an. Theilung der Arbeit sei bereits gemeinsame Arbeit, gesellschaftliche Verbindung zur Production, es sei also nur erforderlich in der gesammten Production die individuellen Productionsvorschüsse aufzuheben und die ohnehin gemeinsame Arbeit der Gesellschaft auch mit den gemeinsamen Vorschüssen derselben zu betreiben und den Ertrag der Production an alle die zu ihr beigetragen haben nach Maßgabe dieser ihrer Leistung zu vertheilen (S. 211). Das leichteste und mildeste Uebergangsmittel hiezu sind die Productivassociationen der Arbeiter mit Staatscredit, die zwar noch keineswegs die Lösung der socialen Frage sind, die aber für jeden Productionszweig einer Stadt die Concurrenz innerhalb dieses Productionszweiges und damit auch das Risico beseitigen würden (S. 217), als ob sich die Associationen von Stadt zu Stadt nicht Concurrenz machen würden und als ob das Risico in der industriellen Production hauptsächlich in der Concurrenz bestände. Ueber die Art der Ablösung der bestehenden Fabriken spricht sich L. nicht aus und doch mußte er eine Expropriation derselben annehmen, da er wenigstens für eine Stadt der neuen Productivassociation den ausschließlichen Betrieb eines bestimmten Industriezweiges übertragen will. Rohstoffe seien durch Credit den Associationen zu gewähren und auch stehendes Capital durch eine Staatsbank, doch wohl nur mittelst Papiergeld, vorzuschießen (S. 220). Detaillirte Vorschläge über die Art der Vertheilung des Gewinnes an die Arbeiter sind ebenso wenig enthalten, als die wichtige Frage untersucht wird, wem denn das stehende Capital einer solchen Associationsfabrik nach der Amortisation der dazu gewährten Staatsvorschüsse gehören soll, den Arbeitern welche die Rückzahlung durch ihre Arbeit aufgebracht haben, oder den künftigen Arbeitern, welche mit dem stehenden Capital den künftigen Arbeitsertrag herstellen oder der Arbeit überhaupt, d. h. dem Staat, welcher dann der Monopolcapitalist wäre und die Arbeiter mit fixen Beträgen entlohnen würde wie bisher. Nach der jeweiligen Beantwortung dieser Fragen können die Productivassociationen nach Rückzahlung des Vorschusses entweder ganz wohl eine Arbeiteractiengesellschaft werden, also die capitalistische Productionsweise fortfetzen, statt sie, wie die Socialisten wollen,|zu beseitigen, oder zum communistischen Eigenthum des Staates an allen Productionsmitteln führen. In seinen früheren Schriften will L. die Arbeiter durch Association zu eigenen Unternehmern, Großproducenten machen, wobei allerdings der Uebergang in eine Arbeiteractiengesellschaft mit bloßer Lohnbehandlung der künftigen Arbeiter naheliegt, also die socialistische Umwandlung nicht eintritt. Im Bastiat-Schulze berührt er diesen Kernpunkt der Frage nicht mehr und so lange er nicht den Muth hatte, offen die Erwerbung aller Productionsmittel für den Staat auszusprechen, so lange diese Associationen selbständige Rechts- und Wirthschaftssubjecte bleiben, so lange bleiben sie auf kapitalistischem Boden, und die einzelnen associirten Arbeiter können die Ersparnisse aus ihren Geminnantheilen wieder capitalistisch anlegen. Er wollte vielleicht den Marx’schen Gedanken, man müsse die Capitals- und Produktionskraft der zu Expropriirenden erst noch mehr vergrößern und ihre Zahl noch mehr verringern, um die Enteignung dann um so leichter vornehmen zu können, nicht aussprechen, und schildert nur den großes Aufschwung, welchen die Production überhaupt durch die staatlich subventionirten Produclivassociationen nehmen würde, gewisse große wohlthätige Unternehmungen, wie z. B. die Verwerthung des Fleisches der südamerikanischen Rinder, seien heute unmöglich, weil sich das nöthige Privatcapital nicht dazu finde. Hätte L. ein paar Jahre länger gelebt, so hätte ihn die Liebig’sche Fleischextractcompagnie eines Besseren über die Leistungsfähigkeit des associirken Privatcapitals belehren können.
Wenn dieses Buch auch kein eigentliches socialistisches System enthält, ja auch seine Kritik nicht immer scharf durchgearbeitet ist, so hat es doch mit den übrigen socialistischen Schriften Lassalle's die Bedeutung eines Wendepunktes in der wissenschaftlichen und praktischen ökonomischen Entwicklung Deutschlands. Der deutsche Socialismus war seit 1848, wo er übrigens neben der rein politischen und der unitarischen Bewegung nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte, ganz in Vergessenheit gerathen. Die Bücher von Mario blieben ganz unbeachtet, Rodbertus hatte zwar durch seine Controverse mit Kirchmann ein gewisses Interesse erregt, wurde aber im Laufe der fünfziger Jahre vergessen Die kleine Schrift von Marx „Zur Kritik der politischen Oekonomie“ machte gar keinen Effekt und sein Communistenmanifest von 1848 wurde höchstens hie und da wie eine längst abgethane Kuriosität erwähnt. Auf den deutschen Universitäten herrschte ein bequemer Eklekticismus mit historischer und statistischer Gelehrsamkeit, der die dialektische Schärfe von Hermann nicht fortsetzen mochte. Höchstens Stein in Wien und Hildebrand in Jena hielten das Interesse für sociale Fragen nicht blos in dogmengeschichtlicher Beziehung, sondern auch mit Rücksicht auf wirkliche Gegenwart und Zukunft wach. In dieser Zeit trat nun L. auf. Zunächst zwang er die Presse sich mit socialen Fragen zu beschäftigen, diese suchte Hilfe und Auskunft bei der Wissenschaft, und damit hat L. die kritische Bewegung in der deutschen Nationalökonomie und zum Theil auch ihre neuere socialistische Richtung eingeleitet. Wenn er auch größtentheils Gedanken von Marx und Rodbertus benützt hat, so ist der äußere Anstoß doch von ihm gekommen und Rodbertus wäre ohne L. wahrscheinlich vergessen geblieben und Marx hätte ohne L. vielleicht sein „Capital“ gar nicht geschrieben. L. griff die Grundbegriffe der alten Nationalökonomie an, oder stellte sie als bloß historische, rechtliche Ordnungen ohne allgemeine gesetzmäßige Geltung hin und that dies mit solchem Nachdruck vor aller Welt, daß man auf ihn hören mußte. Und gerade erst mit seinem Auftreten in der Mitte der sechziger Jahre beginnt in der deutschen Nationalökonomie eine neue kritische Bewegung. Die alten Dogmen der klassischen englischen Nationalökonomie und die bloßen kulturhistorischen und statistischen Kenntnisse|genügten auf einmal nicht mehr, man sprach wie L. von der Relativität der ökonomischen Begriffe, von der geschichtlichen und willkürlichen Entstehung aller großen Rechtsinstitute, acceptirte für Eigenthum und Erbrecht mit großer Gelehrigkeit den Begriff der historisch rechtlichen Kategorie und verwahrte sich gegen alle absolute Lösungen. Aber am meisten hat er auf Freund und Feind durch seine Auffassung von der socialen Aufgabe des Staates gewirkt. Bis vor ihm herrschte in der Theorie und den Journalen die liberale nationalökonomische Schule, welche den Staat auf wirthschaftlichem und socialem Gebiet fast gar keine positive Thätigkeit zuerkannte. L. war es, welcher ausgehend von der deutschen Philosophie dem Staat als die Gesammtpersönlichkeit aller für berufen erklärt, positiv die Cultur, die Wohlfahrt und die Sittlichkeit seiner Bürger zu fördern. Diese Richtung ist seitdem in Deutschland immer stärker geworden, aber vor ihm bestand sie nicht und die besten Argumente des Kathedersocialismus wie des neuen deutschen Staatssocialismus lassen sich mit Citaten aus L. belegen. Es ist richtig, diese Ideen haben in Deutschland einen besonders günstigen Boden gefunden und darum griffen sie durch. Das starke Staatsbewußtsein, das in Preußen sowohl auf Hegel’scher Philosophie als auf der Militärorganisation beruht, das pflichttreue aber auch ausgreifende Beamtenthum, das eine höhere Bildung und eine bessere sociale Position hatte als das ungleich wohlhabendere Bürgerthum, die gesellschaftliche Unbedeutendheit gerade der Mittelclasse, sowie ihre geringe Fähigkeit im conftitutionellen Leben politischen Einfluß zu erwerben, die lange Gewöhnung des Volks an absolutistische Regierungsform und endlich die starte königliche Gewalt, alle diese Momente trugen dazu bei, die neue Auffassung von den Aufgaben des Staats vorzubereiten. Wenn L. so auf die Gebildeten, auf die öffentliche Meinung der oberen Classen nachhaltig eingewirkt hat, so gewinnt er noch mehr an Bedeutung als Begründer der ganzen großen socialdemokratischen Bewegung in Deutschland. Die Geschichte wird den deutschen Socialismus immer an sein Auftreten anknüpfen. Vor ihm bestand das, was man jetzt Arbeiterbewegung nennt, gar nicht. Er war der erste wirkliche Agitator, er war es, der das Classenbewußtsein der Arbeiter wachrief, ihren socialen Gegensatz gegen die besitzenden Classen ihnen in's Bewußtsein brachte und die ganze jetzige Productionsweise und Vertheilung der Güter angriff. Damit war die ganze Tonleiter der künftigen socialdemokratischen Agitation gegeben. Wenn er auch mit seiner ersten Agitation wenig äußeren Erfolg erzielte, wenn auch sein Verein und seine Anhänger nach seinem Tode den Anhängern der Internationale Platz machen mußten, so hat trotz dieser etwas abweichenden späteren Richtung die ganze Bewegung doch ihren Ausgangspunkt in seinem Auftreten. Er hat wie keiner vor ihm die socialistischen Sätze nicht blos theoretisch ausgesprochen, er hat sie unter die Massen geschleudert, praktischer deutscher Socialismus besteht erst seit L.
Es könnte fast scheinen, als ob die Gewährung des allgemeinen Stimmrechts wenige Jahre nach der Lassalle’schen Bewegung ein Erfolg seiner unermüdlichen Agitation für dasselbe gewesen wäre In seinem Hochverrathsproceß, den man gegen ihn wegen seiner Ansprache an die Berliner Arbeiter angestrengt hatte, sagte er fast prophetisch die Dinge voraus, wie sie kommen würden und kamen. Er vertheidigte sich gegen die Anklage, als habe er zu gewaltsamem Umsturz der Verfassung aufgefordert, seine Agitation für das allgemeine Wahlrecht sei zunächst eine friedliche, gerade so wie jene Cobdens gegen die englischen Korngesetze, und sie werde ebenso zum Ziele führen. Es vergehe vielleicht nicht mehr als ein Jahr und Hr. v. Bismarck werde dieser Agitation nachgeben, wie es Peel gegenüber Cobden that und das allgemeine und directe Wahlrecht octroiiren. Der gegenwärtige Zustand sei unhaltbar, das Königthum kann einer|Clique nicht weichen, aber andererseits auch nicht die unregelmäßigen Zustände verewigen. Der Ausweg ist nur das Volk selbst auf die Bühne zu rufen, große auswärtige Conflicte stehen bevor, die nationale Existenz stehe auf dem Spiele und darum müsse man, was man thut, gestützt auf das Volk und getragen vom Volk thun (Hochverrathsproceß S. 65). Es wäre irrig zu glauben, als habe die preußische Regierung das allgemeine Stimmrecht im Jahre 1867 wegen des Drängens der Laffalle’schen Agitation eingeführt, dazu war seine Agitation nicht kräftig genug, allein die Motive der Regierung waren dieselben die er klar vorgezeichnet hatte. Man wollte über die unangenehmen Traditionen der Conflictzeit hinweg an das Volk appelliren und für die große nationale Politik nach dem Krieg die Massen gewinnen.
Aber auch wenigstens diesen Triumph seiner Ideen sollte er nicht erleben. Die letzte Zeit seines Lebens war angefüllt mit Mißerfolgen, Enttäuschungen, inneren Zwistigkeiten im Schooße seines Vereins, die Mehring in seinem ausgezeichneten Buche über die deutsche Socialdemokratie anschaulich schildert. Die Mitgliederzahl des Vereins nahm nicht zu, die Vereinscasse war leer, ein eigenes Organ war nicht zu Stande zu bringen, die große Bewegung blieb aus. L. sah das alles ganz klar ein und in seinen Briefen zu Beginn des Jahres 1864 klagt er über die Erfolglosigkeit der bisherigen Arbeit und über die Abnahme der eigenen Kraft. Aber nach außen hin durfte er das nicht zugeben. Noch einmal raffte er sich auf, um am Rhein eine zweite Heerschau zu halten. Er wurde wie früher stürmisch begrüßt, mit Jubel aufgenommen; aber es war immer nur ein Tageserfolg, der Eindruck einer einzelnen Rede, nachhaltig war selbst dort auf dem günstigsten Terrain die Bewegung nicht. Das Stiftungsfest seines Arbeitervereins feierte er mit einer großen Rede in Ronsdorf am 22. Mai 1864. Noch einmal ließ er die Fanfaren schmettern, nicht blos unter den Arbeitern wachse die Bewegung, auch andere Kreise können sich nicht mehr ablehnend Verhalten, der Bischof von Mainz sei auf seine Seite getreten und schliehlich habe der König in seiner Antwort an eine schlesische Weberdeputation die Nothwendigkeit der Regelung der Arbeiterfrage durch die Gesetzgebung anerkannt. Das sei sein Erfolg. Die Rede coquettirt entschieden mit der Idee des socialen Königthums. Seine zunehmende Erbitterung gegen die liberale Partei, sein starkes Staatsbewußtsein mußte ihn zum Gedanken einer Allianz des Volkes mit dem Königthum gegen die Bourgeoisie führen. Es sind aus dieser Zeit Aeußerungen von ihm über den socialen Beruf des Königthums vorhanden, welche arg contrastiren mit den Reden seines ersten Auftretens und welche die Richtung anzeigen, in welche er wol nach den Ereignissen von 1866 und 1871 hätte treiben können. Er war darum kein Abtrünniger, er war nur ein leidenschaftlicher Politiker, der sein Ziel erreichen wollte, konnte er es allein nicht, so mußte er um einen mächtigen Bundesgenossen aussehen. So schilderte er jetzt auch das Königthum als im Bann seiner Ideen. Er sprach noch stolz und voll Vertrauen in seine Sache, aber der Schatten des baldigen Todes trat bereits über die Stirne des Redners. Der letzte Erfolg seiner Sache sei die unermüdliche Verfolgung seiner Person. Den Berliner Hochverrathsproceß habe er zwar vernichtet und seine Freisprechung durchgesetzt, aber während ihn die Sorge und Arbeit aufreibe, werde er fort und fort angeklagt, werden immer neue Freiheitsstrafen über ihn verhängt. „Ich habe“, rief er aus. „dieses Banner nicht ergriffen, ohne ganz genau voraus zu wissen, daß ich dabei persönlich zu Grunde gehen kann, aber wenn ich beseitigt werde, exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor“. Das war seine letzte Agitationsrede. Vier Wochen darauf mußte er noch seine Berufung vor dem Düsseldorfer Appellgericht gegen seine Verurtheilung wegen der vorjährigen rheinischen Agitationsrede führen. Paul Lindau hat uns|eine interessante Aufzeichnung über diesen letzten rednerischen Waffengang Lassalle's geschenkt. Er sprach wie immer vor Gericht mit Verve und Wirkung. Er wiederholte so ziemlich die Argumente seiner Ronsdorfer Rede, betonte seine Erfolge bei Gebildeten, Volk und König, und sagte mit Stolz: In fünfzig Jahren weide man anders als das Düsseldorfer Gericht über diese große und gewaltige Culturbewegung denken, die aus dem Gewissen eines Mannes hervorging, der die Wissenschaft und die Arbeiter zugleich vertrete. Das Appellgericht setzte die Strafe der ersten Instanz von einem Jahr auf sechs Monate herab.
Mit zerrütteten Nerven ging er nach der Schweiz, wo ihm ein Liebeshandel sein Ende bereitete. L. hatte oft Liebesverhältnisse unterhalten und war ziemlich heftig in seinen Neigungen gewesen, allein er war nicht, was die Franzosen einen homme à femmes nennen. Ein solcher hätte das jahrelange Verhältniß mit der alten Gräfin Hatzfeldt unmöglich ausgehalten. Seine Beziehungen zu den Frauen entsprangen mehr der Eitelkeit und nervöser Laune. Seine aufregenden Kopfarbeiten ließen die animal spirits nicht recht aufkommen. Auf Rigi Kaltbad traf er mit der Tochter des bairischen Gesandten Dönniges zusammen, für die er sich schon in Berlin interessirt hatte. Eine heftige Leidenschaft ergriff ihn für die extravagante und schöne Person, die mit einem Rumänen bereits verlobt war. Die Eltern wollten eine Verbindung mit L. nicht zugeben, da erschien eines Tags Helene Dönniges bei L. und warf sich ihm an den Hals. Er begriff die Situation nicht und führte die Geliebte in das elterliche Haus, um nach allen Regeln der Wohlanständigkeit um sie zu freien. Die Eltern verschlossen L. das Haus und bestimmten die Tochter ihm einen Absagebrief zu schreiben. L., wüthend über die Blamage, forderte Vater und Bräutigam zum Duell. Am 28. August 1864 schoß er sich mit dem Rumänen, der ihn tödtlich traf. Drei Tage darauf starb er.
So fand dieser merkwürdige Mann ein unrühmliches Ende. In der Geschichte wird er als der Vater des deutschen Socialismus fortleben. Ob er die socialistische Bewegung auf den von ihm eingeschlagenen Bahnen hätte halten können, ist zweifelhaft; er wäre wahrscheinlich im Verlaufe der Dinge vor die peinliche Wahl gedrängt worden, entweder mit der staatsfeindlichen Strömung der Internationalen zu gehen oder in irgend eine Beziehung oder Abhängigkeit zu der späteren Socialpolitik des deutschen Reichskanzlers zu treten. Sein früher Tod hat ihm diese schwere Prüfung erspart. Aber nicht blos seine geschichtliche Stellung wird immer eine bedeutende sein, auch seine Persönlichkeit wird noch lange Interesse erregen. Er ist nur recht zu verstehen, wenn man die zwei hauptsächlichen Triebfedern seines Charakters sich vor Augen hält. Einmal war er eine revolutionäre Natur und dann stand er zeitlebens unter dem Einfluß der deutschen Philosophie. Seine kräftige Individualität, sein Selbstbewußtsein, vielleicht auch sein Ursprung, wie dies selbst sein begeisterter Biograph Brandes annimmt, und seine sociale Stellung ließen ihn von Jugend an auf die Seite der Auflehnung gegen alle Ueberlieferung treten. Ein Feind aller bloßen Erhaltung, des bequemen philiströsen Quietismus, des flachen Raisonnirens suchte er immer nach neuen Ideen und neuen Ordnungen. Dieses zum Theil regellose Streben erhielt seine geistige Form durch den Idealismus der deutschen Philosophie. Ein starkes metaphysisches Bedürfniß und eine speculative Auffassung aller Dinge hat ihn immer beherrscht. Auch in der deutschen Philosophie liegt eine Auflehnung nicht blos gegen die hergebrachten Lehren, sondern gegen den gemeinen Verstand überhaupt. Die kräftige geistige Individualität, die sich eins fühlt mit der absoluten Idee, die von einem grundlegenden Princip aus die Welt geistig durchdringen und neu construiren will, war das Ziel und der Inhalt seines Lebens. Er hatte etwas Genialisches in sich im|Sinne der Kraftgenies des Anfangs dieses Jahrhunderts. Es war Sturm in seiner Natur, wie er von seinem philosophischen Helden Heraklit einmal sagte. Er wollte herrschen, er wollte die Dictatur der Einsicht über die Meinungen des gemeinen Verstandes. Er war eine leidenschaftliche Natur und wendete den Hegel’schen Satz, daß nichts Großes in der Welt ohne Leidenschaft geschehen könne, gern auf sich an. Aber es war mehr die Leidenschaft des Kopfes als die Leidenschaft des Herzens. Es war der heftige Wille seine Ideen durchzusetzen, die geistige Ueberlegenheit zur wirklichen Uebermacht zu machen. Darum hat man selbst im Kreise seiner Anhänger oft die Frage aufgeworfen, ob er es denn auch wirklich ehrlich mit den Arbeitern meine, ob er ein Herz für das Volk habe. Gewiß meinte er es ehrlich, denn es waren seine Ideen, seine Persönlichkeit, die er dafür eingesetzt hatte, und diese bethätigen und zur Herrschaft bringen konnte er nur mit Unterstützung der Massen. Jener breite gemüthliche Zug des Volksführers, welcher selbst mit dem Volke gearbeitet und gelitten hat und aus der Tiefe des Gefühls heraus seine Mission beginnt, fehlte ihm allerdings, gerade so wie ihm auch die physischen Eigenschaften eines Massenredners abgingen. Er hatte nicht die breite Brust und die dröhnende Stimme eines O'Connell. Schlank und hoch aufgeschossen sprach er mit einer hohen Kopfstimme. Er fand nicht aus sich selbst die eigenthümlichen Accente populärer Leidenschaft. Seine heftigsten Reden waren das Werk theoretischer Ueberzeugung und Denkarbeit, sein Pathos war darum oft blos rhetorisch und er berauschte sich an den eigenen Worten. Es war etwas gemachtes nicht blos in seinem Auftreten, sondern auch in der ganzen Methode seiner Agitation, aber um so mehr ist ihr relativer Erfolg anzuerkennen. Das Bewußtsein seiner geistigen Kraft erfüllte ihn ganz. Sein Ehrgeiz und seine Eitelkeit waren überaus groß. Er konnte nicht Maß halten, darum war er oft tactlos, herausfordernd und seine vis intemperata wandte sich oft gegen unbedeutende Objecte, wo sie wirkungslos verpuffte. So trug er in sich den Widerstreit großer Anlagen und kleinlicher Ueberhebung. Er hatte ein Werk begonnen, das er mit Recht als eine der größten Bewegungen dieses Jahrhunderts bezeichnete, das er aber mit seinen Kräften nicht durchführen konnte. So brach er zusammen, aber die Bewegung wird an ihrem Ausgangspunkt immer seinen Namen tragen und seine merkwürdige Persönlichkeit wird lange fortleben als eine der interessantesten Figuren dieses Jahrhunderts.
-
Autor/in
E. Plener. -
Zitierweise
Plener, Ernst Freiherr von, "Lassalle, Ferdinand" in: Allgemeine Deutsche Biographie 17 (1883), S. 740-780 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118569910.html#adbcontent