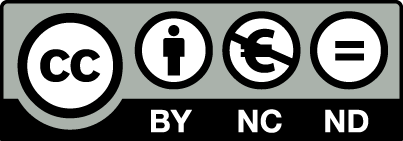Cohen, Hermann
- Lebensdaten
- 1842 – 1918
- Geburtsort
- Coswig (Anhalt)
- Sterbeort
- Berlin
- Beruf/Funktion
- Philosoph ; Hochschullehrer
- Konfession
- jüdisch
- Normdaten
- GND: 118521411 | OGND | VIAF: 12326139
- Namensvarianten
-
- Cohen, Hermann
- Cohen, Hermannus
- Kogen, German
- Kohen, Herman
- Kohen, Yeḥezḳel
- Коген, Герман
- יחזקאל (הרמן) כהן
- Kohen, Hermann
- Kohen, Hermannus
- Cogen, German
- Cohen, Herman
- Cohen, Yeḥezḳel
Vernetzte Angebote
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Personendaten-Repositorium der BBAW [2007-2014]
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte
- EGO European History Online
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- Personen in der Judaica-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt/Main
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Index Theologicus (IxTheo)
- Kalonymos. Beiträge zur deutsch-jüdischen Geschichte aus dem Salomon Ludwig Steinheim-Institut an der Universität Duisburg-Essen
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
Verknüpfungen
Personen im NDB Artikel
- NDB 3 (1957), S. 168 (Cassirer, Bruno)
- NDB 8 (1969), S. 2 (Hartmann, Paul Nicolai)
- NDB 11 (1977), S. 400 (Kehrer, Hugo)
- NDB 13 (1982), S. 205 (Kühnemann, Eugen)
- NDB 13 (1982), S. (Lange, Friedrich Albert)
- NDB 14 (1985), S. 483 (Liebermann, Max)
- NDB 18 (1997), S. 75* (Moos, Paul)
- NDB 18 (1997), S. 752 (Natorp, Paul)
- NDB 19 (1999), S. 302 (Nobel, Nehemia Anton)
- NDB 19 (1999), S. 417 (Odebrecht, Paul Rudolf)
- NDB 19 (1999), S. 418 (Odebrecht, Paul Rudolf)
- NDB 21 (2003), S. 585* (Riegner, Gerhart M.)
- NDB 21 (2003), S. 551 (Rickert, Heinrich John)
- NDB 21 (2003), S. 585 (Riegner, Gerhart M.)
- NDB 22 (2005), S. 86 in Artikel Rosenzweig, Franz (Rosenzweig, Franz)
- NDB 23 (2007), S. 443 in Artikel Scholem, Gershom (Scholem, Gershom)
- NDB 25 (2013), S. 49 in Artikel Stammler, Rudolf
- NDB 25 (2013), S. 199 in Artikel Steinheim, Salomon (Steinheim, Salomon Ludwig)
- NDB 25 (2013), S. 229 in Artikel Steinthal, Chajim (Steinthal, Chajim H.)
- NDB 26 (2016), S. 396 in Artikel Trendelenburg, Adolf
- NDB 26 (2016), S. 692 in Artikel Vaihinger, Hans (Vaihinger, Johannes Carl Eugen)
- NDB 27 (2020), S. 787 ( Wenker, Johann Arnold Georg )
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Cohen, Hermann
Philosoph, * 4.7.1842 Coswig (Anhalt), † 4.4.1918 Berlin. (israelitisch)
-
Genealogie
V Gerson, Lehrer, Synagogenvorsänger;
M Friederike Cohn;
⚭ 1878 Martha († 1942), T des Prof. Louis Lewandowski (1821–94), Kantor u. Synagogenkomponist. -
Biographie
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Dessau und des jüdisch-theologischen Seminars in Breslau nahm C. 1861 seine Studien an der dortigen Universität und später in Berlin auf. Dort trat er in nähere Beziehungen zu A. Trendelenburg und zu dem Sprach- und Völkerpsychologen H. Steinthal. Seine übrigen Lehrer waren A. Boeckh, →Emil Du Bois-Reymond, M. Haupt und K. F. Werder. 1865 promovierte er in Halle zum Dr. phil. Nach Berlin zurückgekehrt, widmete er sich unter anderem naturwissenschaftlichen und mathematischen Studien. In einer Abhandlung „Zur Kontroverse zwischen Trendelenburg und →Kuno Fischer“ (1870) bekundete C. zum ersten Male ein spezielles Interesse an der Philosophie Kants. Er trat für Trendelenburg gegen die Fischersche Interpretation Kants ein. Für die Sachfrage selbst, ob Trendelenburg mit seiner Behauptung einer Beweislücke in der transzendentalen Ästhetik auch gegen Kant recht habe, verwies er auf eine neue Interpretation Kants. Diese war es, die er im folgenden Jahre in seinem Buche über „Kant's Theorie der Erfahrung“ (1871, ²1885) vorlegte. Der reformatorische Anspruch des Buches und der Nachdruck seiner Erörterungen machten auf alle an Kant Interessierten einen solchen Eindruck, daß F. A. Lange kurz nach seiner Berufung nach Marburg (1872) dem Verfasser die Möglichkeit bieten konnte, sich dort mit einer Schrift „Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischen Schriften nach ihrem Verhältnis zum kritischen Idealismus“ zu habilitieren (1873). Als Lange 1876 starb, wurde C. als derjenige, den dieser als seinen „Geistes-Nachfolger“ bezeichnet hatte, auf dessen Lehrstuhl berufen. Er begann damit diejenige Wirksamkeit, die unter dem Namen der Marburger Schule für die studierende Jugend des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eine feste Position bedeutete, mit der sich Philosophen, Erzieher und Politiker auseinanderzusetzen hatten.
Die Fundamente für diese Wirksamkeit legte C. nach dem Rhythmus der drei Kritiken Kants. Er bekennt, in der Meinung aufgewachsen zu sein, „daß Kant überwunden, historisch geworden sei“ (Kants Theorie der Erfahrung, Vorrede, S. 3). Je näher er aber die Kritiken kennenlernte, mit denen man ihn erledigt zu haben glaubte, um so mehr befielen ihn Zweifel und Staunen. Was ihn frappierte, war einmal die Divergenz der Interpreten, die sich gegenseitig des völligen Mißverstehens ziehen, dann aber auch das Maß von Unsinnigkeiten, das man Kant zutraute. Mußte es da nicht „in allem Ernste fraglich werden, worin denn die in den beschreibenden Paragraphen gerühmte Denkergröße des Mannes bestehen mag“ (Kants Theorie der Erfahrung, 1871, S. III)? An zweierlei schien es zu fehlen: Man sah Kant nicht in der Beziehung auf eine relevante und klar erkannte systematische Problematik. Man konnte ihn aber auch so nicht sehen, weil man ihn nicht mit hinreichender Genauigkeit nach den historischen Bedingungen seines Fragens aufzufassen wußte. Die Philosophie kann überhaupt nur in Beziehung auf die in der Vergangenheit hervorgetretenen Versuche systematisch betrieben werden. Freilich nicht so, daß sie diese auf eine frei schwebende Neuerfindung bezieht, sondern indem sie das neu zu Findende von den Ergebnissen der früheren Versuche abhängig macht. Dies ist der neue Impuls, durch den C. den Historismus seiner Epoche den sachlichen Zielen der Philosophie dienstbar zu machen suchte. Dem „Philosophieren auf eigene Faust muß ein Ende gemacht werden: ein in Beziehung auf die Methode abzuschließender Friede muß einen gesetzmäßigen Stand herbeiführen, in welchem die Selbständigkeit ihre in allen Wissenschaften gültige und selbstverständliche Einschränkung findet. Man muß aufhören, in der Nachfolge die Nachahmung zu scheuen; (aufhören) aus Furcht, Kärrner zu sein, Kartenhäuser zu bauen“ (Vorrede zu Kants Begründung der Ethik, S. V.).
Das was C. als das Ergebnis dieser gewandelten Forschungsgesinnung anbot, war eine „neue Begründung der kantischen Aprioritätslehre“. Vorstellungen a priori sind bei Kant Prinzipien, mit deren Hilfe wir die Erfahrung in ihrer Möglichkeit, überhaupt auf Gegenstände bezogen zu sein, allererst hervorbringen. Das ist Kants „neuer Begriff von Erfahrung“. Also besteht die Apriorität aller Prinzipien a priori bei Kant nicht, wie die Zeitgenossen meinten, in ihrem Angeborensein, sondern in ihrer „methodischen Funktion“ als Konstituentien möglicher Erfahrung.
Nun aber ist bei C. (anders als bei Kant) Erfahrung gleichzusetzen mit dem Inbegriffe der Erkenntnisse, die die mathematische Naturwissenschaft gewonnen hat. Für dieses „Faktum der Wissenschaft“ hat die Philosophie in „transzendentaler Methode“ die Bedingungen der Möglichkeit seiner Erzeugung zu suchen. Wenn man nun aber fragt, in welcher Methode denn die Feststellung dieser Bedingungen erfolgen soll, so bleibt dafür nichts übrig als der analytische Nachweis der letzten begrifflichen Elemente, auf denen die Denkbarkeit der in den mathematischen Naturwissenschaften erkannten Gesetzmäßigkeit der Natur beruht. Diese aber ist in ihrer Objektivität lediglich durch die Erfahrung legitimiert. Wie also konnten sich jene Elemente bloß dadurch, daß man sie als Bedingungen einer nur durch die Erfahrung verbürgten Möglichkeit erkannte, die Dinge durch sie zu denken, in Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände jener Erfahrung verwandeln?
C. freilich suchte sich zu helfen, indem er jene obersten Begriffselemente der jeweils vorliegenden Naturwissenschaft als Vorgriffe des Denkens interpretierte, auf denen die Gesetzlichkeit unserer Erfahrungen einschließlich ihrer mathematischen Konstruierbarkeit beruht. Aber wenn eine jede derartige „Hypothesis“ jederzeit durch die fortschreitende Erfahrung selber korrigierbar war, so war Kant offenbar in einen positivistischen Empiristen verwandelt. Und was hätte auf solcher Basis Kants Unternehmen, der menschlichen Erkenntnis feste Grenzen zu setzen und sie innerhalb dieser Grenzen vor der Skepsis zu retten, für einen Sinn gehabt?
Zuletzt meinte Cohen die positivistische Konsequenz seiner Lehre dadurch vermeiden zu können, daß er die Möglichkeit der Hypothesis selber auf eine ursprünglich seinserzeugende Kraft des Denkens gründete. Die Möglichkeit dieses „Denkens des Ursprungs“ glaubte er durch Kants Grundsatz der „Antizipationen der Wahrnehmung“ gefunden. Aber wenn Kant in der Tat die Möglichkeit, Realität in der Erfahrung zu erkennen, auf das Denken und die Anschauung a priori gründete, so heißt das bei ihm in keiner Weise, daß Realität an sich von unserem Denken bedingt sei. Und so blieb auch die metaphysische Urrolle, die C. auf dieser Basis dem Infinitesimalen glaubte zuweisen zu können - ganz abgesehen von ihrer mathematischen Haltbarkeit - ohne Fundament.
Ähnlich macht sich die Grundabweichung von Kant in seiner Interpretation von „Kants Begründung der Ethik“ bemerkbar. Sie interpretierte den kategorischen Imperativ als das Gesetz eines Endzweckes für die unter Bedingungen der Erfahrung möglichen Zwecke des Menschen. Und zwar setzte er diesen Endzweck in das, was bei Kant der Ausdruck des Verhältnisses des Willens zum Gesetze war, nämlich die Autonomie. Das Gesetz hieß also nicht mehr, wie bei Kant, „handle im Einklang mit der Idee einer möglichen Selbstgesetzgebung des Willens“, sondern „mache Dir die Selbstgesetzgebung in der Person eines jeden Menschen zum Zwecke“ - gleichsam als ob Autonomie bei Kant ein Zustand sei, der in bezug auf die empirische Zwecksetzung des Menschen verwirklicht werden könne. Auf diesem Wege verwandelte sich bei C. (wie schon vorher bei Fichte, dessen praktische Philosophie er mit Beifall nennt) die Ethik in eine Ethik nach dem Muster der alten Ethik des Kulturfortschritts. Nun konnte er die Realisierbarkeit des Endzweckes unter den Bedingungen möglicher Erfahrung, wo er sie nach seinen Grundbegriffen suchen mußte, nicht finden. Auch hier mußte er sich mit einer „Hypothesis“ begnügen, die deswegen notwendig sei, weil es sonst keine Ethik, nämlich kein allgemeines Gesetz für den Willen, geben könne. So unbefriedigend das ist, so macht es doch um so deutlicher, wie sich bei C. und seiner Schule der Kategorische Imperativ in ein politisches und soziales Programm verwandeln konnte. Er selbst ist publizistisch vor allem hervorgetreten als Verfechter des Rechtes der Juden, Deutsche zu sein, ohne dafür den Umweg über die christliche Taufe nehmen zu müssen. Den rassischen Sympathien und Antipathien stand er mit großartiger Unbefangenheit gegenüber. Er erkannte sie als eine Realität an, die ihre private Berechtigung habe, aber keine Berechtigung, sich als sittliche Norm zu etablieren. Eine Judenfrage gab es für ihn nur als eine religiöse und politische Frage. Diese Frage glaubte er lösen zu können mit dem Satze von der Kongruenz des ethischen Idealismus Kants sowohl mit dem israelitischen Prophetentum wie mit dem Deutschtum. Derselbe Geist, von dem er die deutsche Kultur beseelt fand, nämlich der des „ethischen Idealismus“, dessen Grundlagen Kant sichergestellt habe, der sprach ihn auch unvermittelt an „aus der Tiefe, aus der Gottinnigkeit, aus der Glut des sittlichen Enthusiasmus der Propheten“. Vom Juden die Taufe fordern, hieß in seinen Augen von ihm die Anerkennung fordern, „daß ihm die wahre Sittlichkeit“ fehle (Allgemeine Zeitung des Judentums, 1.2.1907, S. 52-54). Er übersah in seinem Eifer, daß die philosophische Frage gerade die war, ob der Staat überhaupt „Sittlichkeit“ im Sinne einer religiös begründeten oder nicht begründeten Tugendgesinnung fordern dürfe. Daß er es nicht konnte, das war das wirkliche Ergebnis des kantischen ethischen Idealismus, der sich in seinem Staatsrechte von den theokratischen Ideen des Jesaias und Jeremias doch ganz grundsätzlich unterschied.
1912 ist C. entpflichtet worden - viel gepriesen und öffentlich gefeiert. Privatim bestand doch manche Gegnerschaft gegen ihn, berechtigte und unberechtigte. Den Naturwissenschaftlern blieben seine Begründungen ihres Tuns fremd, und auch sein ethisch begründeter Sozialismus stieß auf Opposition. Die Fakultät berief nach seiner Emeritierung nicht den von ihm gewünschten Schüler E. Cassirer, sondern einen jungen Experimentalpsychologen. C. siedelte nach Berlin über, wo er eine Tätigkeit an der Lehranstalt für Wissenschaft des Judentums, deren Kuratorium er angehörte, übernahm. Seine Schule hat in den Veröffentlichungen dieser Jahre ein Verlassen des bloßen Ethizismus in der Religion sehen wollen. Aber man braucht bloß seinen Ansatz des Sittengesetzes zu betrachten, so sieht man, daß die Prämissen seines Systems ihm dafür kein Fundament liefern konnten.
Im Endresultat muß man von seiner Philosophie sagen, daß sie sich doch der Übermacht das Positivismus und Historismus seines Zeitalters nicht hatte erwehren können. Seine Unterordnung der Philosophie unter den Wissenschaften und Kultur erzeugenden Lebensprozeß, der keine andere Legitimität für sich hatte als seine Faktizität, ließ für eine besondere philosophische Grundfrage eigentlich keinen Raum. In den damit verbundenen Sturz der Philosophie hat er auch Kant mit hineingerissen, und die neue Aufgabe besteht wieder einmal darin, den Unterschied zwischen Kant und dem Kantbilde der Kantianer und Antikantianer an den Tag zu bringen. Das ändert nichts daran, daß C. wie kaum einer seiner Zeit den Stachel des philosophischen Fragens gespürt hat, und dies war auch der Grund, weswegen Kant ihn so übermächtig anzog. Wenn es ihm auch nicht gelungen ist, die Bilanz der kantischen Philosophie mit Zuverlässigkeit zu ziehen, so wird er doch jederzeit einen sichtbaren Platz behaupten als ein Vindikator des Rechtes der Philosophie auf sich selbst in einer Zeit, da diese unter dem Ansturm unphilosophischer Forderungen ihres Fragerechtes beraubt zu werden drohte.
-
Werke
Weitere W Kants Begründung d. Ethik, 1877;
Kants Begründung d. Aesthetik, 1889;
Logik d. reinen Erkenntnis, 1902, ³1922;
Ethik d. reinen Willens, 1904, ⁴1923;
Aesthetik d. reinen Gefühls, 1912, ²1923;
Der Begriff d. Rel. im System d. Philos., 1915;
Die Rel. d. Vernunft a. d. Quellen d. Judentums, 1922;
Bibliogr. in: Neue jüd. Mhh., 2. Jg., 15/16, 1918. -
Literatur
P. Natorp, H. C. als Mensch, Lehrer u. Forscher, 1918;
H. Knittermeyer, in: Lb. Kurhessen V, 1955, S. 13-32 (W, L, P);
Zeichnung v. M. Liebermann (Hamburg, Kunsthalle). -
Autor/in
Julius Ebbinghaus -
Zitierweise
Ebbinghaus, Julius, "Cohen, Hermann" in: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), S. 310-313 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118521411.html#ndbcontent