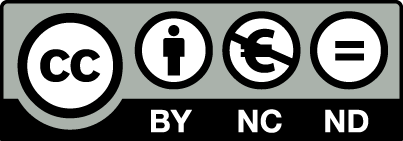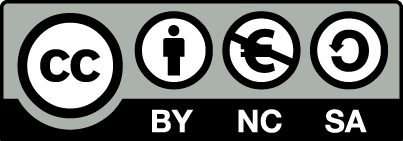Hölderlin, Friedrich
- Lebensdaten
- 1770 – 1843
- Geburtsort
- Lauffen/Neckar
- Sterbeort
- Tübingen
- Beruf/Funktion
- Dichter
- Konfession
- evangelisch
- Normdaten
- GND: 118551981 | OGND | VIAF: 95147974
- Namensvarianten
-
- Hölderlin, Johann Christian Friedrich
- Hölderlin, Friedrich
- Hölderlin, Johann Christian Friedrich
- Scardanelli
- Hölderlin
- Hoelderlin
- Hölderlin, Friedr.
- Hölderlin, F.
- Hoelderlin, Joannes Christianus Fridericus
- Hoelderlin, Christian Johann Friedrich
- Hoelderlin, Christianus Johannes Fridericus
- Hölderlin, J. Ch. Friedrich
- Holderlin, Friedrich
- Holderlin
- Hillmar
- Chailnterlin, Phrēntrich
- chailnterlin, phrezntrich
- Chainterlin
- Chelderlin, Fridrich
- Chelnterlin, Phrēntrich
- chelnterlin, phrezntrich
- Chʹolderlin, Fridrich
- Gelʹderlin, Fridrich
- Gelʹderlin
- Gelʹderlin, Friedrich
- Gelʹderlin, I. Ch. F.
- Gëlʹderlin, Iogann Kristian Fridrich
- Helderlîn, Frîdrîk
- Herudārin
- herudazrin
- Herudârîn, Furîdorihhi
- Hildarlin
- Hoelderlin, Friedrich
- Hoelderlin, Frédéric
- Holḍālina
- holḍazlina
- Gelʹderlin, Fridrikh
- Kholʹderlin, Fridrikh
- Holderlin, Frederich
- Hūldarlīn, Frīdrīš
- huzldarlizn, frizdrizš
- Hölderling, Friedrich
- He er de lin
- Heerdelin
- Hoeldeollin
- Hölderlin, Friedrich Johann Christian
- Hölderlin, Fryderyk
- Hölderlin, Johann
- Hölderlin, J. Ch. F.
- Chailnterlin, Phrēntrix
- chailnterlin, phrezntrix
- He'erdelin
- Helderlin, Fridrih
- Hëlʹdėrlin, Frydrych
- Hölderlin, Johann C.
- Ch'olderlin, Fridrich
- Gel'derlin, Fridrich
- Hölderlin, Johannes Christian Friedrich
- Gëlderlin, Fridrich
- Gëlʹdėrlin, Frydrych
- Helderlin, Fridrikh
- Chiolderlin, Fridrich
- Hoelderlin, Johann Christian Friedrich
- Helderlin, Fridrik
- Holterling
- Hölderlin, Johann Christian Friedrich
- 弗里德里希·荷尔德林
- 荷尔德林, 弗里德里希
- ヘルダーリン
- Гёльдэрлін, Фрыдрых
- Гёльдерлин, Фридрих
- Chailntherlin, Phrēntrich
- chailntherlin, phrezntrich
- Chaintherlin
- Chelntherlin, Phrēntrich
- chelntherlin, phrezntrich
- Chailntherlin, Phrēntrix
- chailntherlin, phrezntrix
- Holtherling
Vernetzte Angebote
- Frankfurter Personenlexikon [2014-]
- * Filmportal [2010-]
- * Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) [2001-2014] Autor/in: Rosmarie Zeller (2009)
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- * Bayerisches Musikerlexikon Online (BMLO) [2005-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1972] Autor/in: Glaubrecht, Martin (1972)
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Wohlwill, Adolf (1880)
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Personen im Personenverzeichnis der Fraktionsprotokolle KGParl [1949-]
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Fröbel-Briefe. Personenindex der Gesamtausgabe
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Edition der Tagebücher Erich Mühsam's
- Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte
- * Die wissenschaftliche Korrespondenz des Historikers Karl Hegel
- EGO European History Online
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- * F.W.J. Schelling: Münchener und Berliner Nachlass (1811–1854)
- Forschungsplattform zu den "Großen Deutschen Kunstausstellungen" 1937-1944
- Diplomatische Dokumente der Schweiz 1848-1975 (via metagrid.ch) [2019]
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Nachlass Sommerfeld beim Deutschen Museum
- * Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- * Briefe an Goethe - biografische Informationen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Archivportal - D
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Landeskunde Entdecken Online - Baden-Württemberg (LEO-BW) [2015-]
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Frankfurter Personenlexikon [2014-]
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
- Personen im Auftrittsarchiv der Wiener Philharmoniker
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
- ADB 13 (1881), S. 794 Korrektur
- ADB 33 (1891), S. 796 Korrektur
- NDB 1 (1953), S. 383* (Arnold, Philipp Friedrich)
- NDB 5 (1961), S. 176 (Fischer, Johann Georg)
- NDB 6 (1964), S. (George, Stefan Anton)
- NDB 8 (1969), S. 83 (Hauer, Josef Matthias)
- NDB 8 (1969), S. 207 (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich)
- NDB 8 (1969), S. 208 (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich)
- NDB 10 (1974), S. 668 (Jung, Alexander)
- NDB 11 (1977), S. 45 (Kalb, Charlotte von, geborene Freiin Marschall von Ostheim)
- NDB 14 (1985), S. 386 (Leuthold, Heinrich)
- NDB 15 (1987), S. 650 (Magenau, Rudolf von)
- NDB 24 (2010), S. 455 in Artikel Sinclair (Sinclair, Isaac Freiherr von)
- NDB 24 (2010), S. 533 (Soemmerring, Samuel Thomas von)
- NDB 24 (2010), S. 716 (Spittler, Christian Friedrich)
- NDB 25 (2013), S. 514 in Artikel Strauss
- NDB 25 (2013), S. 748 in Artikel Szondi
- NDB 26 (2016), S. 356 in Artikel Trakl
- NDB 26 (2016), S. 774 in Artikel Vesper
- NDB 26 (2016), S. 802-803 in Artikel Viëtor
- NDB 27 (2020), S. 266 (Waiblinger, Friedrich Wilhelm)
- NDB 28 (2024), S. 783-784 in Artikel Zuntz
- NDB 28 (2024), S. 245 (Winkler, Hildegard)
- NDB 28 (2024), S. 783 (Zuntz, Albert Günther)
- NDB 28 (2024), S. 784 (Zuntz, Albert Günther)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Hölderlin, Friedrich
Dichter, * 20.3.1770 Lauffen/Neckar, † 7.6.1843 Tübingen. (evangelisch)
-
Genealogie
Aus württ. Rats- u. Pfarrerfam., die d. sog. Ehrbarkeit angehörte;
V Heinrich Friedrich (1736–72), Klosterhofmeister u. geistl. Verwalter in L., S d. Frdr. Jakob (1703–62), Klosterhofmeister u. geistl. Verwalter in L., u. d. Elisabeth Jul. Haselmayer;
M Joh. Christiana (1748–1828), T d. Joh. Andreas Heyn (1712–72), Pfarrer in Cleebronn, u. d. Joh. Rosina Sutor (1725–1802), die wesentl. Anteil an d. Erziehung H.s hatte;
Stief-V Joh. Christian Gock (1748–79), Weinhändler u. Bgm. in Nürtingen, Kammerrat;
Ur-Gvv Joh. Conrad (1672–1719), Pfleger d. Klosters Murrhardt¶ u. geistl. Verwalter in Großbottwar, Wilh. Conrad Haselmayer (1663–1721), Prälat zu Murrhardt;
Ur-Gvm Jeremias Heyn, Bauer u. Metzgermeister in Friemar b. Gotha, Wolfgang Sutor (1690–1763), Dekan in L.; Halb-B Karl Gock (1776–1849), Hof-Domänenrat;
Schw Heinrike (1772–1850, ⚭ 1792 →Theodor Breunlin, 1752–1800, seit 1785 Prof. im ev. Seminar Blaubeuren); - ledig. -
Biographie
H. verlor schon im Alter von 2 Jahren seinen Vater, als Neunjähriger auch den geliebten Stiefvater. So lag seine Erziehung vor allem in den Händen von Mutter und Großmutter. Zur pietistisch frommen Mutter, die freilich die Liebe zu ihrem Sohn hinter ängstlich-beschränkten Lebensforderungen eher verbarg als zeigte, hatte er ein besonders inniges, aber auch spannungsreiches Verhältnis, da er ihr gegenüber seine geistige Freiheit und seine schwäbisch-bürgerliche Verhältnisse sprengende Lebensform verteidigen mußte. Ein übersteigertes Schuldgefühl, vor den Erwartungen der Mutter nach einem gesicherten Leben zu versagen und|auf ihre Hilfe angewiesen zu sein, um dem „Dichterberuf“ leben zu können und er selbst zu werden, hat er nie überwunden. Das Berufsziel H.s, durch Familientradition und württembergische Hochschätzung des Theologenstandes bestimmt, stand schon vor dem Tod des Stiefvaters fest; die Mutter verfolgte es mit besorgter Liebe und frommer Hartnäckigkeit. H. sollte Pfarrer werden, und so besuchte er nach der Nürtinger Lateinschule seit 1784 die niedere Klosterschule in Denkendorf, wo er seine ersten Gedichte schrieb, und seit 1786 die höhere Klosterschule in Maulbronn. Er gewann während dieser Zeit unter anderem den späteren Juristen Chr. L. Bilfinger, F. K. Hiemer und Immanuel Nast, mit dessen Cousine Louise Nast (1768–1839) er sich verlobte, zu Freunden und arbeitete intensiver an seinen dichterischen Versuchen: Freundschafts- und Naturgedichte, vor allem in Odenform, noch unselbständig und bezeichnenderweise am Vorbild „Ossians“, Klopstocks, Schubarts und der Dichter des Göttinger Hains, nicht an dem Goethes, orientiert, doch eigene Töne gefühlvollen Engagements andeutend. 1788-93 besuchte H. das Tübinger Stift, wo er im Rahmen der theologischen Ausbildung auch mit Philosophie, Literatur und Kunst des Altertums vertraut wurde. 1790 legte er das Magisterexamen ab; von seinen beiden Magisterarbeiten bezeugt besonders die „Geschichte der schönen Künste unter den Griechen“ die Konzentration seines Interesses auf die Antike, sie ist jedoch in der Hauptsache Paraphrase von Winckelmanns „Geschichte der Kunst des Altertums“. Im Stift wurde nicht nur H.s Begeisterung für die Antike geweckt. Ebenso wie für Hegel und →Schelling wurde hier für ihn der Grund gelegt für die Beschäftigung mit der kritischen Philosophie Kants, wenn auch weniger von den Professoren direkt, als vielmehr von den Stiftlern selbst, die kennenlernen wollten, was von den Lehrern in Verteidigung orthodoxen Protestantismus' abgelehnt, aber immerhin erwähnt wurde. Kant und die von ihm ausgehende geistige Revolution beherrschten neben der Französischen Revolution Gespräche und Lektüre im Stift. Literarisch wurde für H. hier das Vorbild des jungen Schiller bestimmend. Die Hymnen der Tübinger Zeit zeigen deutlich dessen Einfluß und leiden noch unter Abstraktheit der Thematik und Eintönigkeit des Stils, sind aber geschloßner als die früheren Gedichte. Persönliches Betroffensein von den Verhältnissen im Stift gibt jedoch dem Freiheitspathos mancher Gedichte realen Grund. Auch in den begeisterten, religiös anmutenden Tönen des Preisens der Freundschaft und der Natur kündigt sich über Schiller hinaus die Entwicklung eines eigenen Stils an.
Schon in Maulbronn, stärker und zeitweise übermächtig in Tübingen, zeigte sich H.s Abneigung gegen den Theologenberuf. Der Tübinger Supranaturalismus sagte ihm nichts, religiöse Zweifel und der Drang nach intellektueller Emanzipation, ja, unstillbarer Ehrgeiz plagten ihn: „Ich duld es nimmer! ewig und ewig so/Die Knabenschritte, wie ein Gekerkerter/Die kurzen, vorgemeßnen Schritte/Täglich zu wandeln, ich duld es nimmer!“ Er will den Ruhm und glaubt, nicht eher den „Kelch der Freuden“ genießen zu können, ehe ihm nicht „ein Männerwerk gelinget“, er „den ersten Lorbeer“ erringt. Zum ungestillten Ehrgeiz, aus dem heraus er 1789 die Bindung an Louise Nast löste, und zum gehaßten Berufsziel kam noch die starre Stiftsdisziplin, in die der Duodeztyrann →Karl Eugen kleinlich eingriff und die angesichts der Ereignisse der Französischen Revolution besonders drückend empfunden wurde. Die rebellische Stimmung der Stiftler, vor allem der Mömpelgarder, mit denen H. Kontakt hatte, nährte sich außerdem aus den „Beispielen tyrannischer Willkür in unserem Lande“ (der Stiftler H. Pfaff) und führte dazu, daß sich im Stift ein politischer Club bildete. Wenn auch die Errichtung eines Freiheitsbaumes in Tübingen (wohl 14.7.1793), an der auch H. beteiligt gewesen sein soll, nicht belegbar ist, ist es doch sicher, daß H. den Tübinger revolutionären Zirkeln nahestand; mit einem ihrer „Feuerköpfe“, Christian Friedrich Hiller, war er befreundet. Er unternahm mit ihm und Friedrich August Memminger Ostern 1791 eine Reise in die Schweiz, das „Land der göttlichen Freiheit“, und besuchte Lavater in Zürich. H., der die Mutter mehrmals gebeten hatte, aus dem Stift ausscheiden und Jura studieren zu dürfen, wies auf sein „Temperament“ hin, „wie es so wenig für Mißhandlungen, für Druck und Verachtung taugt“, und ging in der Abwehr der herzoglichen Eingriffe so weit, Rebellion zu predigen: „Die Sache ist gewiß wichtig. Wir müssen dem Vaterlande und der Welt ein Beispiel geben, daß wir nicht geschaffen sind, um mit uns nach Willkür spielen zu lassen.“
Diese Bereitschaft zur Rebellion ist freilich nicht zu trennen von H.s beginnendem Dichtertum und seinem philosophischen Interesse; schon in Tübingen war er bestrebt, Natur, Schönheit, Liebe, Freiheit und Denken nach dem Vorbild der bewunderten Griechen in eins zu empfinden und – was freilich die|gesellschaftliche Situation seiner Zeit nicht mehr erlaubte – zu leben. Die Trennung der Lebensbereiche erfuhr er wie kein zweiter seiner Zeit, den Theoretiker Schiller in den „Ästhetischen Briefen“ ausgenommen, mit einer Intensität, die sein Denken, seine Dichtung und sein Leben bestimmte und schließlich zerstörte. In Tübingen konnte sie noch aufgehoben werden in der Dichterfreundschaft mit →Ludwig Neuffer (einem der wichtigsten späteren Briefpartner) und Rudolf Magenau sowie in der Beziehung zu dem väterlichen Freund G. F. Stäudlin, der in seinem „Musenalmanach“ (1792) und seiner „Poetischen Blumenlese“ (1793) die Tübinger Hymnen H.s veröffentlichte, die Bekanntschaft H.s mit Matthisson und Schiller vermittelte und den jungen Dichter-Rebellen „zu stillem Mitwirken an der Sache der Freiheit“ (Häussermann) ermunterte. Das politische Aufbegehren fand auch philosophisch bestimmte Sublimierung in der Freundschaft mit Hegel und →Schelling, mit denen er in der Losung „Reich Gottes“, die durchaus politisch-utopisch als „Reich Gottes auf Erden“ zu verstehen ist, und in der pantheistischen Parole „Eins und Alles“, die ebenfalls auf die Einheit von Geist, Leben und Wirklichkeit hindeutet, sich einig wußte.
Die Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne in das Joch des Theologenberufs eingespannt zu sein, und zugleich die sehr ehrgeizigen Dichterpläne zu fördern, ließ H. den naheliegenden Hofmeisterberuf ergreifen, in dem er sich Freiheit zu eigener Arbeit erhoffte und doch ein typisches Hofmeisterschicksal in Abhängigkeit und Demütigung erleben sollte. Durch Vermittlung Schillers, mit dem er im September 1793 in Ludwigsburg zusammengetroffen war, erhielt er bei Charlotte von Kalb die Stelle eines Erziehers ihres 9jährigen Sohnes Fritz, die er Ende dieses Jahres, nachdem er das Stift verlassen und die theologische Konsistorialprüfung abgelegt hatte, in Waltershausen/Grabfeld antrat. Erregt von der Nähe der „großen Männer“ in Weimar und Jena, suchte er die Kräfte, die ihm die Natur gegeben, „immer mehr und mehr auszubilden“ und auch als an Rousseau und Kant orientierter Erzieher zu bestehen. Bis etwa Oktober 1794 hatte er mit seiner Haltung, sich dem Knaben als Freund zu zeigen und ohne Strenge das „Bewußtsein seiner sittlichen Freiheit“ in ihm zu wecken, Erfolg, scheiterte aber schließlich an dem moralischen Rigorismus, der ihn ein von ihm und der H.-Literatur so genanntes „Laster“ des Knaben hart verurteilen ließ. Die vergeblichen Korrektionsversuche führten zu ernsten Störungen seiner Arbeitsfähigkeit. Als auch ein Aufenthalt mit dem Knaben in Jena (seit November 1794) und in Weimar (für 2 Wochen) die Lage nicht besserte, wurde im Januar 1795 das Hofmeisterverhältnis gelöst, um dem „Jammer ein Ende zu machen“ (Charlotte von Kalb).
H. ging nach Jena, wo er plante, nach einem halben Jahr Studiums sich entweder zu habilitieren oder die Möglichkeit zu finden, von eigener literarischer Arbeit zu leben. Zwiespältig war diese Zeit auch für H. als Dichter; zwar arbeitete er weiter an dem 1792 begonnenen Roman „Hyperion“, doch die lyrische Produktion versiegte fast ganz, und auch die Arbeit am Roman wurde gestört durch die Begegnung mit der Philosophie Fichtes, den H. in Jena täglich hörte. Fasziniert und zugleich gelähmt von der „Tyrannin Philosophie“, vermochte er es noch nicht, sein eigenes Denken in der Auseinandersetzung mit den Fichteschen Abstraktionen zu klären. Auch das Verhältnis zu Schiller, der ihn zu fördern (Druck des „Fragments von Hyperion“ in der „Thalia“, Vermittlung des „Hyperion“ an Cotta, wo der Roman 1797 erschien, etc.), und zu leiten versuchte, war von Bewunderung, Minderwertigkeitsgefühl und ehrgeiziger, heimlicher Rivalität durchsetzt. Mit den Worten: „die Nähe der großen Geister … schlägt mich nieder und erhebt mich wechselweise“, kennzeichnet H. die Ambivalenz dieser Zeit, aus der heraus er im Juli 1795 Jena beinahe fluchtartig verließ, nachdem sich seine Pläne nicht hatten realisieren lassen, seine Mittel – darunter das „Kinderhonorar“ (Häussermann) von 100 Gulden für den „Hyperion“ – selbst zu seiner zurückgezogenen und bescheidenen Lebensweise nicht mehr ausreichten und keine Aussicht auf eine Stelle bestand. Er lebte, immer in der Furcht, der Mutter zur Last zu fallen und vom Stuttgarter Konsistorium zum Vikarsdienst verpflichtet zu werden, bis Ende des Jahres in Nürtingen. Der Thüringer Aufenthalt war jedoch nicht ohne Nutzen für H.; neben der Erweiterung seiner dichterischen und besonders seiner philosophischen Bildung brachte er ihm die entscheidende Freundschaft mit Isaak von Sinclair, der von Anfang an für die Französische Revolution begeistert war, und durch diesen die Berührung mit dem Fichte nahestehenden „Bund der freien Männer“ sowie die Bekanntschaft mit den republikanisch gesinnten späteren Schriftstellern Casimir Ulrich von Boehlendorff und Siegfried Schmid.
Die bedrückende und dichterisch unergiebige Zeit in Nürtingen – neben der Weiterarbeit|am „Hyperion“ konnte H. nur das Gedicht „An die Natur“ vollenden – fand ein Ende, als er durch die Vermittlung des Arztes und Naturforschers Johann Gottfried Ebel eine Hofmeisterstelle bei dem Bankier Jakob Friedrich Gontard in Frankfurt erhielt, die er im Januar 1796 antrat. Durch die Begegnung mit der Frau des Bankiers, Susette geborene Borkenstein (1769–1802), wurden die Frankfurter Jahre zur glücklichsten und produktivsten Zeit seines Lebens. Er fand in ihr sein Frauenideal: „Majestät und Zärtlichkeit, und Fröhlichkeit und Ernst, und süßes Spiel und hohe Trauer und Leben und Geist, alles ist in und an ihr zu Einem göttlichen Ganzen vereint!“ Die Liebe zu ihr, die sie erwiderte, die in ihrer hohen Idealisierung aber wohl nicht über geistige und seelische Vereinigung hinausging, bedeutete ihm Erfüllung seiner Sehnsucht nach Rückkehr zur Natur im Erlebnis der Liebe, Wiedergewinnung der Identität der Kindheit, Aufhebung der Einsamkeit und Vereinzelung: Erfüllung, wie sie „Hyperion“ in „Diotima“, der Platos „Symposion“ entlehnten Priesterin der Liebe, erlebt hatte und wie sie für H. jetzt Realität gewann und den dichterischen Traum noch zu übertreffen schien. Er nannte sie nach der Gestalt des Romans „Diotima“ und feierte sie in den an sie gerichteten Gedichten als seine „holde Muse“, als „Heilige“ und „Botin des Himmels“. Durch sie fand er innere Ruhe und den Glauben an seinen „Dichterberuf“; er vollendete den 1. Band des „Hyperion“, arbeitete am 2. Band (erschienen 1799) und gewann in den Oden jener Zeit eigene Töne lyrischer Klarheit, die, zeitgenössische Vorbilder überwindend, antike Strenge in deutscher Dichtung vollendet Wiederaufleben ließen. Doch war der Aufenthalt im Gontardschen Hause, der H. auch als Erzieher Erfolge brachte, schon nach einiger Zeit überschattet von Spannungen zu dem geschäftstüchtigen, persönlich achtenswerten, aber amusischen Bankier. Ungestört zusammen waren H. und Susette nur von Juli bis Oktober 1796 während eines Aufenthalts in Kassel, wo der von H. bewunderte W. Heinse zu der Gesellschaft stieß, und in Bad Driburg, durch den Gontard seine Frau und die Kinder vor den befürchteten Kriegsgefahren in Frankfurt bewahren wollte. In Frankfurt führten dann mehr und mehr Verpflichtungen zur Teilnahme an den zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen der Gontards, vor allem aber „der unhöfliche Stolz, die geflissentliche tägliche Herabwürdigung aller Wissenschaft und aller Bildung, die Äußerungen, daß die Hofmeister auch Bedienten wären, daß sie nichts Besonders für sich fordern könnten, weil man sie für das bezahlte, was sie täten, …“ zu Verstimmungen, Krankheit und Störungen der dichterischen Arbeit, die H. nur ertrug, um Susette nahe sein zu können. Ende September 1798 kam es zum Bruch. H. verließ nach einer Auseinandersetzung mit dem Bankier (die Legende berichtet von einem Eifersuchtsausbruch) auf den hilflosen Rat Susettens hin ohne Abschied das Haus. Er fand Zuflucht in Homburg von der Höhe, wo Sinclair, inzwischen hessen-homburgischer Hofrat, sich seiner annahm.
Die Flucht aus Frankfurt entfernte H. nicht nur von der Geliebten, sondern sie bedeutete auch den Verzicht auf den Umgang mit Hegel, dem H. 1797 eine Hauslehrerstelle in der Stadt vermittelt hatte. Auch die Anteilnahme durch den Homburger Hof, an dem der „Hyperion“ begeisterte Aufnahme gefunden hatte, besonders der Glaube der Prinzessin Auguste von Hessen-Homburg an des Dichters „Laufbahn …, die so schön und sicher begonnen“ habe, vermochte H. nicht aus der Zerrissenheit „zwischen Liebe und Haß“, aus Krankheit (Gallenkoliken) und Depression herauszuhelfen. Doch gelang es Sinclair, den Freund für eine Weile aus der Apathie zu lösen, als er ihn im Oktober 1798 auf den Kongreß nach Rastatt mitnahm, auf dem er homburgische Interessen zu vertreten hatte und mit zahlreichen anwesenden Gesinnungsgenossen (Jakob Friedrich Gutsche, Baz, Muhrbeck, Boehlendorff und anderen) die Sache einer „Revolution ganz Süddeutschlands“ voranzutreiben versuchte. H. schloß und vertiefte zahlreiche Bekanntschaften und kehrte aus Rastatt mit neu gewonnenem Lebensmut (Brief an Sinclair vom 24.12.1798) nach Homburg zurück. Er versucht jetzt, seinem Denken und seiner Dichtung Grund zu geben durch das Bekenntnis zu einer Synthese von Philosophie, Politik und Dichtung. Als seine Bestimmung erkennt er die Poesie, die Hoffnung seiner Jugend, von der er auch unter den widrigsten Umständen nur um den Preis der Selbstaufgabe lassen könne. Er verleiht ihr göttlichen Rang, in dem er ihr die Aufgabe beimißt, den Gegensatz von Denken und Handeln, von Philosophie und Politik, dialektisch aufzuheben. Doch bedeutet das keinen Rückzug in die Dichtung, er will „mit allen Kräften … ringen, und mit aller Schärfe und Zartheit“ zusehen, „wie wir alles Menschliche an uns und andern in immer freieren und innigeren Zusammenhang bringen, es sei in bildlicher Darstellung (Dichtung) oder in wirklicher Welt …“ (Politik). Angesichts einer durch die Revolutionskriege auch für Deutschland erhofften Revolution bekennt er sich zur Tat: „… und wenn das Reich der Finsternis mit Gewalt einbrechen will, so werfen wir die Feder unter den Tisch und gehen in Gottes Namen dahin, wo die Not am größten ist, und wir am nötigsten sind.“ Dieses, an anderer Stelle wiederkehrende, auch in dem Sinclair gewidmeten Gedicht „An Eduard“ deutlich werdende Bekenntnis zur revolutionären Tat, die Andeutungen in den Briefen an die Mutter, daß „man jetzt den Menschen nicht alles gerade heraussagen“ könne, daß im „Falle, daß die Franzosen glücklich wären,… es vielleicht in unserem Vaterlande (Württemberg) Veränderungen geben“ dürfte, daß er Mut brauche, wenn er nicht lässig werden wolle in dem, was seine Sache sei, und daß er mit allen Kräften dafür sorgen wolle, daß die Mutter „unter gewissen möglichen Vorfällen kein Unrecht leiden“ werde, lassen vermuten, daß er zumindest geistigen Anteil hatte an den Vorbereitungen zu einer revolutionären Umwälzung und daß er einen Gutteil seiner Zuversicht daraus bezog.
Daß H. im Gegensatz zu dem Tatmenschen Sinclair im Kreise der Homburger „Revolutionsschwärmer“ die Rolle der Dichtung als Verkünderin der republikanischen Ideale und der Versöhnung der Gegensätze in der dichterischen Vision vertrat, geht aus den Briefen an den Bruder vom Jahreswechsel 1798/99 und vom 4.7.1799 hervor. Auch ein Brief Boehlendorffs aus dieser Homburger Zeit bestätigt die revolutionären Hoffnungen und H.s intellektuelle Anteilnahme: „Ich habe hier einen Freund (Sinclair), der Republikaner mit Leib und Leben ist, – auch einen andern Freund, der es im Geist und in der Wahrheit ist, die gewiß, wenn es Zeit ist, aus ihrem Dunkel hervorbrechen werden; der letzte ist Dr. Hölderlin, der Verfasser des Hyperion, einer Schrift, die Epoche zu machen im tiefsten Sinne verdient …“ Auch der Versuch, den Verlust der Geliebten dichterisch aufzuheben in der Vision einer Insel der Seligen, trägt Züge einer aufs Diesseits gerichteten Hoffnung, die aus der Parenthese „oder auch hier“ in Strophe 9, Vers 19 der Elegie „Menons Klage um Diotima“ herausgelesen werden kann. In dem Wunsch „Sprache der Liebenden/Sei die Sprache des Landes,/Ihre Seele Laut des Volkes!“ (Ode „Die Liebe“) verschmilzt diese Hoffnung mit der Utopie einer allgemeinen Liebe, in der die individuelle aufgeht und ihr Verlust aufgehoben ist. Die Zuversicht auf Verwirklichung politischer Träume und auf Wiedervereinigung mit der Geliebten – er hielt von Homburg aus noch fast 2 Jahre lang Kontakt zu ihr durch Briefe und flüchtige heimliche Zusammenkünfte – war zwar von Hypochondrie und Vorahnung des Scheiterns und der endgültigen Trennung gefährdet, gab ihm aber dennoch Halt bei dem Versuch, „endlich einen geltenden Posten in der gesellschaftlichen Welt“ zu erreichen durch seine Dichtung und die Herausgabe einer eigenen humanistischen Zeitschrift: „Iduna, Journal für Damen, ästhetischen Inhalts“, für die er durch Vermittlung Neuffers den Stuttgarter Verleger Johann Friedr. Steinkopf interessieren konnte. Nach dem Eingehen der „Horen“ bestand die Chance, deren Platz einzunehmen und mit literarischen, philosophischen und ästhetischen Beiträgen und Rezensionen auf die Zeitgenossen zu wirken. Vor allem sollte ihm die Zeitschrift die Möglichkeit geben, eine Zeitlang in materieller Unabhängigkeit zu leben. Allerdings verlangte der Verleger, daß neben H. (vorgesehen von ihm unter anderem das Trauerspiel „Empedokles“, an dem er in Homburg schrieb) und seinen Freunden Heinse, Conz, Ebel, S. Schmid auch Namen wie Herder, Goethe, W. von Humboldt, Thümmel, Fichte, →Schelling und vor allem Schiller der Zeitschrift Publikumswirkung verschaffen sollten. H. bemühte sich auch um die Mitarbeit einiger dieser Prominenten, mußte aber nach der nüchternen, mit eigener Erfahrung begründeten Absage Schillers und nach Versuchen des Verlegers, durch einen Redakteur in Stuttgart H. gleichsam das Projekt aus der Hand zu nehmen, den Plan einer eigenen Zeitschrift aufgeben.
Der Hoffnung beraubt, seine „Existenz auf eine honette Art“ zu sichern, mittellos – die in Frankfurt ersparten 500 Gulden waren durch Krankheit und Teuerung vorzeitig verbraucht – und nur unter ängstlichen Skrupeln Geldsendungen (aus den Zinsen des väterlichen Vermögens) von der Mutter erbittend, zuletzt in der blinden Zuversicht auf die Vermittlung einer Stelle durch Schiller getäuscht, mußte er Ende Mai 1800 Homburg verlassen. Das bedeutete die endgültige Trennung von Susette Gontard und zugleich das Scheitern seines letzten Versuchs, sich eine bescheiden gesicherte und seiner dichterischen Berufung gemäße Stellung zu schaffen. Nach kurzem Aufenthalt in Nürtingen fand er im Hause des befreundeten Kaufmanns Christian Landauer in Stuttgart Aufnahme. Er beabsichtigte, Privatunterricht zu geben, für Steinkopf zu schreiben und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Leiden und Enttäuschungen, vermutlich auch das endgültige Scheitern der Revolutionsversuche in Schwaben (März 1799 Zurücknahme versprochener|französischer Unterstützung, November Auflösung der Landstände und Verhaftung des Revolutionärs Baz und anderen), hatten H. psychisch und körperlich tief geschädigt, doch lebte er durch die herzliche Aufnahme bei Landauer (Gedicht „An Landauer“, das Wohlstand und ruhige Tätigkeit des Freundes preist) und den Kontakt mit Neuffer, dem Bildhauer Scheffauer, mit F. Haug und L. F. Huber für eine Zeitlang wieder auf. In dem Bruchstück eines Briefes an den Bruder: „Ich würde in dieser schönen und großen Zeit und in der Ruhe und Freiheit, die ich habe, wohl sagen können, daß ich wahrhaft lebte, wenn nicht noch alte Leiden in mir zuweilen“, das hier abbricht, ist die Stimmung des Stuttgarter Aufenthaltes angedeutet: Obwohl H. während Sommer und Herbst dieses Jahres mit zahlreichen Oden und Elegien den Gipfel seines dichterischen Schaffens erreichte und ein Gesuch an das Konsistorium ihn von der Pflicht zum Pfarrdienst freistellte, scheinen jene „alten Leiden“ und ein „dringendes Bedürfnis nach Ruhe und Stille“ ihn aus der Heimat fortgedrängt zu haben. Schon im Herbst begann er, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Im Januar 1801 übernahm er in Hauptwil/Schweiz bei dem Kaufmann Anton von Gonzenbach sein drittes Hofmeisteramt, wie bei jedem Neubeginn wiederum mit Zuversicht und einem Hochgefühl, das durch das Erlebnis der Alpen und die aus dem Frieden von Lunéville (9.2.1801) genährten Hoffnungen auf ein neues Zeitalter, auf „Tage der schönen Menschlichkeit“ bis zur Euphorie sich steigerte. Doch schon nach einem Vierteljahr verlor H. auch diese Stellung. Im März 1801 schrieb er an Landauer: „Überhaupt ists seit ein paar Wochen ein wenig bunt in meinem Kopfe.“ Er beklagte sein „Einsamsein“, das ihn auch aus jener Lage „nur immer unwiderstehlicher“ zurückdränge, die er gewählt habe, um sich „selbst herauszufinden“. Er erfuhr, „je länger ichs mir verschwiegen habe, dies, daß ich ein Herz habe in mir, und doch nicht sehe wozu? mich niemand mitteilen, hier vollends niemand mich äußern kann“. Dieser Zustand dürfte Anlaß gegeben haben zu der rücksichtsvollen, familiäre Veränderungen anführenden Kündigung Gonzenbachs vom 11.4.1801.
Nach Nürtingen zurückgekehrt, wandte sich H. im Juni ein letztes Mal an Schiller und erbat dessen Rat und Hilfe für seinen Plan, nach Jena zu gehen und dort Vorlesungen über griechische Dichtung zu halten. Als Schiller und Niethammer, an den sich H. ebenfalls gewandt hatte, nicht antworteten und auch Verhandlungen mit Cotta wegen der Herausgabe seiner Gedichte zu nichts führten, entschloß er sich, nach Frankreich zu emigrieren: „Ich bin jetzt voll Abschieds. Ich habe lange nicht geweint. Aber es hat mich bittre Tränen gekostet, da ich mich entschloß, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen, vielleicht auf immer. Denn was hab ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen. Deutsch will und muß ich übrigens bleiben, und wenn mich die Herzens- und die Nahrungsnot nach Otaheiti triebe“ (auf jene Südsee-Insel, die, von Georg Forster beschrieben, von →Heinse, →Gerstenberg, →Claudius, auch →Klopstock, →F. L. Stolberg und →Voß als Asyl deutscher Dichter erträumt worden war). Nach einer großenteils zu Fuß zurückgelegten, über Straßburg, Lyon (der Weg über Paris war ihm aus Sicherheitsgründen von den französischen Behörden verwehrt worden) und die verschneiten Höhen der Auvergne führenden harten Winterreise trat H. Ende Januar 1802 seine letzte Hofmeisterstelle an: bei dem hamburgischen Konsul und Weinhändler Daniel Christoph Meyer in Bordeaux. Er blieb auch hier nur ein Vierteljahr. Es ist nur eine Vermutung, daß er wegen des Ansinnens, als Prediger für die evangelische Gemeinde in Bordeaux zu wirken, die Stadt schon Anfang Mai wieder verließ; sein psychischer Zustand – aus den beiden allein erhaltenen Briefen aus Bordeaux erkennbare Zurücknahme von Gefühl und Anteilnahme am Schicksal der Seinigen als deutliches Anzeichen beginnender Schizophrenie – mag zur Erklärung hinreichen. Die Heimreise, wohl ebenfalls zumeist zu Fuß, führte ihn innerhalb von 4 Wochen über Paris nach Straßburg. Von dort nach Nürtingen – ⅙ der Entfernung Bordeaux–Straßburg – benötigte er mehr als 4 Wochen, was die Überlieferung, H. sei auf dieser Strecke überfallen und ausgeraubt worden, wahrscheinlich macht. Jedenfalls erschien er etwa Mitte Juni 1802 abgerissen, in wilder Erregung in Stuttgart, gleich darauf in Nürtingen. Durch den Aufenthalt bei den Freunden in Stuttgart Anfang Juli ein wenig beruhigt, traf ihn dort der Brief Sinclairs mit der Nachricht vom Tode Susette Gontards. In tiefer Verstörung floh er in die Geborgenheit des mütterlichen Hauses, wo er, von Anfällen blinder Raserei heimgesucht, erst allmählich wieder ruhiger wurde. Von Sinclair Ende September 1802 auf eine Reise zum Reichstag nach Regensburg mitgenommen, begegnete er dort den revolutionär gesinnten Freunden Fritz Horn und Leo Freiherr von Seckendorf sowie dem Landgrafen von Hessen-Homburg und kehrte in relativ ruhigem Zustand nach Nürtingen zurück. Er arbeitete 1802/03 an der Hymne|„Patmos“, mit der ihn vermutlich der Landgraf beauftragt hatte, an den Übersetzungen der Tragödien „Ödipus“ und „Antigonä“ des Sophokles, die durch die Vermittlung Sinclairs April 1804 bei dem Verleger Friedrich Wilmanns in Frankfurt erschienen, und an der Überarbeitung einiger früherer Oden zu den „Nachtgesängen“ für Wilmanns' „Taschenbuch der Liebe und der Freundschaft“ (1805, schon September 1804 erschienen).
Sinclairs Bemühungen, den Freund zu sich nach Homburg zu holen und ihm dort eine bleibende Heimstatt zu schaffen, hatten gegenüber der Mutter erst Erfolg, als Landauer ihr vorstellte, daß der Aufenthalt H.s in Homburg das einzige Mittel sei, ihn zu heilen, zumal er demnächst an der Reihe sei, ein Pfarramt antreten zu müssen, wovon er auf keinen Fall etwas wissen dürfe. Sinclair, der seit Dezember 1802 die Leitung der hessenhomburgischen Regierung innehatte, erwirkte die Anstellung H.s als Bibliothekar in Homburg – 200 Gulden einer eigenen Besoldungserhöhung, mit denen er schon eine Zeitlang H. unterstützt hatte, ließ er ihm als Gehalt aussetzen- und holte ihn im Juni 1804 von Nürtingen ab. In Stuttgart hielten sich die Freunde über eine Woche auf; Sinclair führte in der von Revolutionsgerüchten erfüllten Stadt politische Gespräche mit befreundeten Vertretern der Landstände und der revolutionären württembergischen Reformpartei, die sich im erbitterten Kampf mit Kurfürst Friedrich II., „dem bösesten und begabtesten Sohne des Hauses Württemberg“ (Treitschke), befanden, und er „hielt H. keineswegs davon fern“ (Kirchner). Spuren der Anteilnahme H.s an dieser später für Sinclair, Seckendorf und Baz, nach den Forschungen Kirchners auch für H. gefährlichen politischen Verschwörung finden sich in einem Brief H.s an Seckendorf und in dem Gedichtentwurf „Dem Fürsten“, wo dem „vom Himmel herabsingenden Dichter der bösartige, finstere Mann (Kurfürst Friedrich II.) gegenübergestellt (wird), um den das Verhängnis des Todes schwebt, fast als wäre über ihn beschlossen, was die Freunde in ihrem Gespräch an der Abendtafel bei Baz sich ausgemalt hatten“ (Kirchner). Es deutet alles darauf hin, daß Sinclair in Homburg besänftigend auf H.s Gemütszustand wirken konnte. Ja, eine briefliche Äußerung dieses vertrautesten Freundes gegenüber H.s Mutter „nicht nur ich, sondern außer mir noch 6-8 Personen, die seine Bekanntschaft gemacht haben, sind überzeugt, daß das, was Gemüths Verwirrung bei ihm scheint, nichts weniger, als das, sondern eine aus wohlüberdachten Gründen angenommene Äußerungs Art ist“, scheint zu belegen, daß H. aus zwar pathologischer, aber bei den befürchteten Verfolgungen verständlicher Angst nach außen hin seine Krankheitssymptome als Schutzschild gebrauchte und übersteigerte. Die Beschäftigung H.s mit den Übersetzungen Pindars und eigenen hymnischen Entwürfen während dieses zweiten Homburger Aufenthalts zeigen jedenfalls, daß er seine psychischen und geistigen Kräfte auf diese letzten Arbeiten noch zu konzentrieren versuchte.
Der endgültige Zusammenbruch erfolgte erst, nachdem 1805 Sinclair, Seckendorf, Baz und andere auf Grund einer Denunziation in Württemberg der Prozeß gemacht worden war und H., der in der Denunziation und in den Erstverhören als Mitwisser einer Verschwörung gegen Kurfürst Friedrich II aufgetaucht war, ein ärztliches Gutachten aus Homburg, daß er völlig wahnsinnig sei, vor dem Schicksal seiner Freunde bewahrt hatte. Nach den Untersuchungsberichten soll er immer wieder geschrien haben: „Ich will kein Jacobiner seyn, fort mit allen Jacobinern! Ich kann meinem gnädigsten Churfürsten mit gutem Gewissen unter die Augen tretten!“ Als dann im August 1806 mit der Mediatisierung Hessen-Homburgs H.s Aufenthalt in Homburg unmöglich wurde und man ihn nach Tübingen überführte, fürchtete er in wahnhafter Angst offensichtlich, wie Sinclair in württembergische Haft verschleppt zu werden: „H. schrie, daß "Harschier“ ihn wegholten und wehrte sich mit seinen ungeheuer langen Fingernägeln so heftig, daß der Mann (der ihn begleiten sollte) ganz mit Blut bedeckt war“ (Landgräfin Caroline von Hessen-Homburg).
Der von nun an völlig im Wahn versunkene Dichter kam nach Tübingen in die Autenriethsche Klinik, wo die dort vorgenommenen Kuren nach dem Bericht Chr. Th. Schwabs seinen Zustand nur verschlimmerten. Im Sommer 1807 gab man ihn in die verständige Pflege des wohlhabenden und gebildeten Tischlermeisters Zimmer in Tübingen. In einem kleinen Erkerzimmer im 1. Stock des Zimmerschen Hauses am Neckar lebte er noch 36 Jahre lang, allmählich von Paroxysmen frei, doch in beständiger Umnachtung. Seine stereotypen, förmlichen Briefe an die Mutter, die starren Reimgedichte, die er zumeist auf Wunsch von Besuchern schrieb, sowie die Berichte W. Waiblingers, der sich 6 Jahre lang seiner annahm, und Chr. Th. Schwabs zeigen einen vollständigen Rückzug H.s auf die eigene, verworrene Innenwelt. Bei serviler Höflichkeit gegen Besucher schützte er sich im Wahn vor jeder Erinnerung, jedem Gedanken, jedem gegenwärtigen|Eindruck, die Emotionales anzurühren drohten. Seinen Unterhalt bestritt die Familie aus den Zinsen des väterlichen Vermögens, das die Mutter peinlich verwaltete und vermehrte, und mit Hilfe einer im Oktober 1806 bewilligten württembergischen Unterstützung für den ehemaligen Stiftler von jährlich 150 Gulden Als er starb, war H., der solange er klaren Geistes war, sich von Armut bedroht sah, ein wohlhabender Mann.
H. selbst hat nur den „Hyperion“ und, verstreut in Zeitschriften, eine Anzahl von Gedichten sowie die Sophokles-Übertragungen veröffentlichen können. Den Zeitgenossen war sein Werk, von dem er sich Ruhm und hohe Wirkung erhofft hatte, nahezu unbekannt. Nur die engsten Freunde, idealistisch gesinnte Revolutionäre, verkrachte Genies, einige mit ihm auch das Schicksal der Geisteskrankheit teilend, doch kaum einer mehr als dichtender Dilettant, glaubten an seine Größe. Sinclair konnte nach 1806 in Fr. Schlegel, Tieck, C. Brentano, am tiefsten in Bettina Brentano (Die Günderode, 1840), Begeisterung für die Dichtungen H.s wecken. Doch haben die Romantiker sich mehr in H. gespiegelt als ihn in seiner Eigenart erkannt. Für die Verbreitung seines Werkes vermochten sie kaum etwas zu tun: Die Rezension einiger Gedichte H.s durch A. W. Schlegel (1799) und die des „Hyperion“ durch Görres (1805) sowie die späte, umso nachdrücklichere Anerkennung durch A. von Arnim (1828) drangen gegenüber dem flachsten Unverständnis in den führenden Rezensionsorganen der Zeit nicht durch. Schiller kam über die anfängliche Anerkennung genialischen Talents bei H. nicht hinaus und äußerte sich nicht einmal über den „Hyperion“; Goethe stellte ihn gar mit dem reimenden S. Schmid auf eine Stufe. Aus landsmännischer Verbundenheit haben einige Schwaben, die das Genie H.s kaum begriffen und vor angeblichen Spuren des Wahnsinns ängstlich zurückschreckten, das meiste für die Erhaltung und Verbreitung seiner Dichtung getan: 1826 gaben G. Schwab und Uhland die erste Gedichtauswahl heraus (²1843), unter Weglassung aller unverstandenen Arbeiten; Chr. Th. Schwab besorgte die erste Werkausgabe (Sämtliche Werke, 2 Bände, 1846), der er eine Biographie beifügte, die noch heute Quellenwert besitzt; Waiblinger kümmerte sich jahrelang um den Wahnsinnigen und schrieb die erste, allerdings für die Zeit vor 1806 sehr fehlerhafte, für die Kenntnis der Zeit der Umnachtung außerordentlich wertvolle Biographie H.s. Impetus und jugendlich-rebellischen Gehalt der Dichtungen H.s verstand in dieser Zeit nur Herwegh. Außergewöhnlich für das 19. Jahrhundert ist die enthusiastische Würdigung des zeitweiligen Außenministers der 3. französischen Republik, P. Challemel-Lacour, eines Freundes Herweghs, der H. einen der größten Lyriker nicht nur seines Landes, sondern aller Zeiten nannte. Sonst kannte man den Dichter kaum, repräsentativ war die Ansicht R. Hayms, der ihn als „Seitentrieb der romantischen Poesie“ abtat. Dilthey behandelte H. mit geschichtlichem Verständnis und betonte den Zusammenhang des „Hyperion“ mit der „Tragödie der neuen Menschheitsideale, wie sie H. und seine Freunde eben damals am Verlauf der Französischen Revolution erlebten“. Nietzsche fühlte in H. einen Verwandten im dionysischen Geist. – In seiner dichterischen Größe und im wahren Umfang erkannt, wenn auch von vornherein mit der verhängnisvollen Hypothek eines esoterischen Heroenkults belastet, wurde das Werk H.s erst durch N. von Hellingrath und den Georgekreis. Die ahistorische, moderne nationalistische Kategorien in H. projizierende Begeisterung für den Dichter ergriff von hier aus die Jugendbewegung und die Generation um den 1. Weltkrieg, die sich nach 1918 um ihre Ideale betrogen sah. Die Hypostasierung H.s zum Propheten eines „Geheimen Deutschland“ und dessen zukünftiger Größe, verbunden mit dem Mythos vom kommenden „Dritten Reich“, wurde aufgenommen und zu zynischer Perversion gesteigert von den Nationalsozialisten, denen moderne Mythologen unter den Germanisten und Philosophen in die Hände arbeiteten. Von nachhaltiger, doch rational schwer nachvollziehbarer Faszination waren dabei Heideggers Deutungen der H.schen Dichtung (seit 1936, 1951 unverändert wiederaufgelegt), nach denen H. das „Wesen der Dichtung“ eigens dichte als „worthafte Stiftung des Seins“ und als einziger abendländischer Dichter aus der Seinsentfremdung durch die Vernunft zurückführe zu den Ursprüngen des Seins. Doch erfährt man aus dieser Interpretation weniger etwas über H.s Dichtung und geschichtliche Position als über die konservative Kulturkritik des Philosophen Heidegger. Neuere Forschung hat denn auch seine Ergebnisse mit philologischen und erkenntnistheoretischen Argumenten mehr oder weniger entschieden kritisiert (P. de Man, K. Gründer, H. J. Schrimpf und andere). Die von ihm übernommene nationalistische These von der „vaterländischen Umkehr“ H.s wurde von Adorno, W. Hof, L. Ryan und P. Szondi entkräftet; R. Minder sieht in ihr die Projektion der „Fehlleistung der vaterländischen Kehre“ Heideggers 1933/34.
Neben diesen und anderen Ideologisierungen hat jedoch gewissenhafte philologische Forschung, ausgehend von der 1. kritischen Ausgabe durch Hellingrath, Seebaß und L. von Pigenot und der kritischen Ausgabe Zinkernagels, das verstreute und entstellt überlieferte Werk H.s gesammelt, entziffert, kommentiert und ihm überzeugende Textgestalt gegeben in der Großen Stuttgarter Ausgabe F. Beißners. Nach 1945 wurden vor allem in immanenter Interpretation Probleme der poetischen Struktur erörtert und, in Besinnung auf den Text, mit Hilfe sorgfältiger Analysen zahlreiche politische, religiöse und philosophische Legenden zerstört. H.s Bedeutung für die Moderne wurde entdeckt, und sein Werk fand internationale Anerkennung: „In H. hat man nicht nur einen ‚Seher', sondern auch einen formbewußten Künstler höchsten Ranges, ja in seinen Gedichten den Gipfel der deutschen Oden-, Elegien- und Hymnendichtung anzuerkennen gelernt. Er steht in der Tradition der klassischen deutschen Dichtung; seine Gestaltung der antiken Versmaße in deutscher Sprache hat nicht ihresgleichen“ (Ryan). Von den nationalistischen Fesseln befreit, wird seine Dichtung in aller Welt gelesen und erforscht. Aber erst in jüngster Zeit wurde begonnen, H. auch als politischen Dichter seiner Epoche zu verstehen (nicht, sein Werk aus dem Hintergrund der Zeit zu lösen und es gerade dadurch für aktuelle politische Zwecke verfügbar zu machen), ihn aus dem neuen Getto der reinen Poesie zu befreien und zu erkennen, daß sein Leben und Werk eng mit den Idealen, Kämpfen und Niederlagen der Französischen Revolution und ihren Auswirkungen auf Deutschland verknüpft war. Die Analyse der historisch-politischen Bedeutung H.s unternahmen jedoch keine deutschen Germanisten, sondern der Ungar G. Lukács, der schon 1934 den „Hyperion“ die „objektivste Citoyenepik der bürgerlichen Entwicklung“ genannt hatte, und französische Germanisten, an ihrer Spitze P. Bertaux, der den Jakobiner H. und Sänger einer schwäbischen Republik freilegte (1969). Die durch seine Deutungen ausgelöste Diskussion könnte den Anstoß bilden zu neuen interpretatorischen Anstrengungen, so daß das Werk H.s nicht mehr nur in seiner dichterischen Eigenart und Größe, sondern auch in seiner historischen und politischen Rolle anerkannt wird.
Die Dichtungen H.s bedürfen wie die kaum eines seiner Zeitgenossen der Interpretation, Analyse und Entschlüsselung. Ihr Verständnis wird nicht nur erschwert durch die Dunkelheiten seines Stils, die komplizierte Syntax, die unter dem Gesetz der rhythmischen Stauung und Entladung steht und dem Vorbild der griechischen Sprache folgt, sondern vor allem auch durch die mythologischen Einkleidungen ihrer Gegenstände. – Zahlreiche Einflüsse haben H.s Werk geprägt: der schwäbische Pietismus, dessen Gefühlsreichtum und -intensität und dessen Naturfrömmigkeit in seiner Dichtung in säkularisierter und pantheistischer Gestalt erscheinen, Rousseaus zivilisationsfremde Verabsolutierung der Natur und sein Freiheitswille, eingeschränkt und korrigiert von den ethischen Postulaten Kants, als Gegenkraft gegen allzu abstrakten Subjektivismus in der Auseinandersetzung mit Fichte jedoch wiederaufgenommen, sowie die Anfänge geschichtlichen dialektischen Denkens der Freunde Hegel und →Schelling. Übergriffen und in allen Bereichen durchformt wurden diese Einflüsse von H.s Verehrung der griechischen Welt, die er erlebte als jenes Zeitalter der Menschheit, in dem die Ideale der Humanität: Freiheit, Schönheit, Liebe und Identität des Menschen mit der Natur im Erlebnis der Götter, rein verwirklicht waren und die auf neuer Stufe wiederherzustellen er als die Aufgabe seiner, der „reißenden Zeit“ ansah. Dies Griechenideal steht von Anfang an im Zusammenhang mit der eigenen Zeit. Es ist republikanisch-demokratisches Ideal. In den Einkleidungen und Metaphern der griechischen Welt und ihrer Götter erscheinen in der Dichtung H.s die utopischen Hoffnungen, die von der Französischen Revolution ausgelöst worden sind. So bestimmt Griechenland das Gesamtwerk H.s, beginnend mit der Tübinger „Hymne an den Genius Griechenlands“, die vor allem die Freiheit Griechenlands preist, über den „Hyperion“, der im Freiheitskampf der Neugriechen von 1770 die Ideale und Niederlagen der Französischen Revolution widerspiegelt und die deutschen Zustände hart kritisiert, über die Fragmente der „Empedokles“-Tragödie bis hin zu den sogenannten Vaterländischen Gesängen, die die geschichtliche Dialektik von Griechenland und Abendland zum Gegenstand haben und Deutschland die Rolle der Vermittlung griechischen Geistes für eine prophetisch gesehene Zukunft zuweisen. Der Bezug auf die eigene Zeit in der dichterischen Konfrontation Griechenlands und seiner Mythologie mit der Neuzeit, besonders auch der Landschaft und den Zuständen Deutschlands, ist der politische Grundton des H.-schen Werkes. Es ist kaum aktuelle oder gar offen ausgesprochene politische Dichtung, wenn auch Gedichte aus der optimistisch getönten Homburger Zeit wie „Der Tod fürs Vaterland“, das Bertaux mit Grund die „deutsche Marseillaise“ genannt hat,|und „An Eduard“ aktivistische Töne anschlagen und unter den späteren die Oden „Gesang des Deutschen“ und „An die Deutschen“ jene Hoffnungen auf eine „künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles Bisherige schamrot machen“ werde, dichterisch wiederaufnehmen, die H. 1797 in einem Brief an Ebel an die Rolle der Deutschen geknüpft hat. Der tiefere politische Sinn der Dichtung H.s liegt in ihrer menschheitsgeschichtlichen Perspektive. Ähnlich wie bei Hegel und später bei Marx nimmt die Menschheitsgeschichte auch in H.s Denken ihren Ausgang von einem „Goldenen Zeitalter“ (Griechenland), um im Durchgang durch eine Zeit der Entfremdung von der Natur, die zu deren Eroberung und Beherrschung notwendig ist und in der der Mensch die Aufgabe hat, „den ewigen Vollendungsgang der Natur zu … vervollkommnen“, schließlich auf höherer Stufe in eine neue Identität des Menschen mit sich selbst und der „vervollkommneten“ Natur zu münden.
In dieser Dialektik der Geschichte nimmt für H. die Dichtung die Rolle der Mittlerin zwischen den Mächten der Natur (den Göttern) und den Menschen ein. So erhält in idealistischer Kunstanschauung, die zugleich politischphilosophische Weltsicht ist, die Dichtung höchsten geschichtlichen Rang. Vor dem Hintergrund der Tragik des eigenen Lebens ist das Werk H.s, das dieser Rolle gerecht werden sollte, Gefährdungen ausgesetzt gewesen, und es spiegelt in jähen Wechseln hoffnungsvolle Zuversicht, Freude, Schmerz, Trauer und verborgene Prophetie angesichts aktuellen Scheiterns: „Hyperion“ zerbricht am Kleinmut und an der Schwäche der Menschen, „Diotima“, in deren Liebe und Schönheit er höchstes Glück nach dem Scheitern im politischen Kampf erfuhr, stirbt im Roman, wie auch H. in der Realität seine „Diotima“ verliert; das Drama „Der Tod des Empedokles“, das offenbar den Opfertod des sizilianischen Sehers angesichts eines der Natur und den Göttern entfremdeten Volkes als Aufruf zu republikanischer Umkehr – „Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr“ – deuten sollte, blieb in seinen drei Fassungen Bruchstück, und die Dichtungen nach 1800 verbergen in schwer zugänglicher mythologischer Metaphorik die griechisch republikanischen Ideale und weisen prophetisch auf eine zukünftige Zeit. Dieses Verbergen der Ideale in dunkler mythologischer Rede hat das Spätwerk H.s zahlreichen Deutungen ausgesetzt. Die Deutung Bertaux', daß nach dem Scheitern der schwäbischen Revolutionsversuche H. in seiner Dichtung die jakobinische Utopie einer Wiederkehr Griechenlands, die soviel Parallelen mit der antiken Drapierung der 1. französischen Republik aufweist, der verschwiegenen „Mutter Erde“ anvertraue für zukünftige Zeiten, hat, im Blick auf das von den Idealen der Freiheit, Gleichheit, Schönheit und brüderlichen Liebe geprägte Gesamtwerk, die größte Wahrscheinlichkeit für sich. In der Tradition der Dichter, die, wie H. W. Jäger nachwies, in der Verehrung der Griechen und ihrer Polis-Verfassung antiabsolutistische, demokratische Ziele verfolgten, nimmt H. den höchsten Rang ein. Im wesentlichen rhythmisch vollendete, klare, wohltönende Lyrik, auch in der Prosa des „Hyperion“ und den Versen des Dramas „Empedokles“, birgt und verbirgt sein Werk in mythologischer Gestalt Hoffnungen und jugendlich reine Ideale, deren Interpretation und geschichtliche Einordnung vor dem Hintergrund der Französischen Revolution zugleich die Aufgabe ist, diese Dichtung in ihrer Größe und in ihren idealistischen Grenzen darzustellen.
-
Werke
Weitere W Sämtl. Werke, Hist.-Krit. Ausg., begonnen durch N. v. Hellingrath, fortgeführt durch F. Seebaß u. L. v. Pigenot, 6 Bde., 1913–23, ³Bd. 1-4, 1943;
Sämtl. Werke u. Briefe, Krit.-hist. Ausg., hrsg. v. F. Zinkernagel, 5 Bde., 1913-26 (der krit. Apparat blieb ungedr.);
Sämtl. Werke (Große Stuttgarter Ausg.), hrsg. v. F. Beißner u. (ab Bd. 6) A. Beck, bisher 7 in 11 Bänden, 1943-1970 (Bd. 7, 2 u. 3 in Vorbereitung), danach ohne d. krit. Apparat, aber m. d. gekürzten Erll.: Sämtl. Werke (Kleine Stuttgarter Ausg.), hrsg. v. dens., 6 Bde., 1944-62;
Sämtl. Werke in 1 Bd., hrsg. v. F. Beißner, 1961;
Werke, Briefe, Dokumente, ausgew. u. m. Nachw. u. Erll. v. P. Bertaux, 1963;
Werke u. Briefe, hrsg. v. Jochen Schmidt n. F. Beißner, 2 Bde., 1969;
Sämtl. Werke, hrsg. v. G. Mieth, 4 Bde., 1970. -
Nachlass
Nachlaß: Stuttgart, Landesbibl. (in Photokopien im H.-Archiv, Bebenhausen b. Tübingen); Homburg v. d. H., Stadtbibl.; Marbach, Schiller-Nat.-mus. - H.-Ges. (gegr. 1943), Tübingen; H.-Jb.: Iduna, Jb. d. H.-Ges., hrsg. v. F. Beißner u. P. Kluckhohn, 1, 1944, ab Jg. 2, 1947 u. d. T. H.-Jb., hrsg. v. dens., ab Jg. 9, 1955/56, hrsg. v. W. Binder u. A. Kelletat.
-
Literatur
ADB XII;
H.-Bibliogr., bearb. v. F. Seebaß, 1922;
H.-Bibliogr. f. d. J. 1922-37 (in Vorbereitung);
H.-Bibliogr. 1938–50, bearb. v. M. Kohler u. A. Kelletat, 1953;
H.-Bibliogr. 1951–55, 1956-58, 1959-61, 1962-65, bearb. v. M. Kohler, in: H.-Jb. 9, 1955/56, 11, 1958/60, 12, 1961/62, 14, 1965/66. - Forschungsberr.:
f. d. J. 1902-25: A. v. Grolman, in: DVjS 4, 1926;
f. d. J. 1926-33: J. Hoffmeister, ebd. 12, 1934;
f. d. J. 1933-40: H. O. Burger, ebd. 18, 1940;
f. d. J. 1940-55: ders., ebd. 30, 1956;
Forschungsberr. v. A. Beck, in: H.-Jb., 1944 (Iduna) -52. - Zur Wirkungsgesch.: A. Pellegrini, H., Storia della critica, 1956, erweitert u. dt. u. d. T.
F. H., Sein Bild in d. Forschung, 1965. -
E. Cassirer, H. u. d. dt. Idealismus, in: ders., Idee u.|Gestalt, 1921;
K. Viëtor, Gesch. d. dt. Ode, 1923, ²1961, S. 147-64;
J. Hoffmeister, H. u. Hegel, 1931;
ders., H. u. d. Philos., 1942, ²1944;
F. Beißner, H.s Überss. a. d. Griech., 1933, ²1961;
ders., H., Reden u. Aufsätze, ²1969;
ders., H.s Götter, Ein Vortrag, 1969;
ders., Geschichte d. dt. Elegie, 1941, ²1961, S. 172-91;
P. Böckmann, H. u. s. Götter, 1935;
P. Bertaux, H., Essai de biographie intéieure, 1936;
ders., H. u. d. Franz. Rev., 1969;
N. v. Hellingrath, H.-Vermächtnis, 1936, ²1944;
W. Michel, Das Leben H.s, 1940, Neudr. 1963;
M. Kommerell, H.s Empedokles-Dichtungen, in: ders., Geist u. Buchstabe d. Dichtung, 1940;
W. F. Otto, Der Dichter u. d. alten Götter, 1942;
E. Müller, H., Stud. z. Entwicklung s. Geistes, 1944;
G. Lukács, H.s Hyperion [1934], in: ders., Goethe u. s. Zeit, 1947, ³1955;
W. Killy, Bild u. Mythe in H.s Gedichten, Diss. Tübingen 1948 (ungedr.);
W. Kirchner, Der Hochverratsprozeß gegen Sinclair, ein Btr. z. Leben H.s, 1949, neue, verbesserte Aufl. mit e. Nachw. besorgt v. A. Kellotat, 1969;
ders., H., Aufsätze zu s. Homburger Zeit, hrsg. v. A. Kelletat, 1967;
M. Heidegger, Erll. zu H.s Dichtung, ²1951;
M. Corssen, Der Wechsel d. Töne in H.s Lyrik, in: H.-Jb. 4, 1951;
W. Binder, H.s Odenstrophe, ebd. 5, 1952;
ders., Dichtung u. Zeit in H.s Werk, Habil.schr. Tübingen 1955;
ders., Sprache u. Wirklichkeit in H.s Dichtung, in: H.-Jb. 9, 1955/56;
R. T. Stoll, H.s Christushymnen, 1952;
B. Böschenstein, Konkordanz zu H.s Gedichten nach 1800, 1964;
W. Hof, H.s Stil als Ausdruck s. geistigen Welt, 1954;
ders., Zur Frage einer späten Wendung oder Umkehr H.s, in: H.-Jb. 11, 1958/60;
B. Allemann, H. u. Heidegger, 1954, ²1956;
M. Delorme, H. et la Rév. Française, 1959;
W. Schadewaldt, Hellas u. Hesperien, 1960;
L. Ryan, H.s Lehre vom Wechsel d. Töne, 1960;
ders., F. H., 1962, ²1967 (W, L);
ders., H.s Hyperion, Exzentr. Bahn u. Dichterberuf, 1965;
H., Btrr. zu s. Verständnis in unserm Jh., hrsg. v. A. Kelletat, 1961;
U. Häussermann, H. in Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten, 1961 (W, L, P);
J. Rosteutscher, H., Der Künder d. großen Natur, 1962;
U. Gaier, Der gesetzl. Kalkül, H.s Dichtungslehre, 1962;
P. Raabe, Die Briefe H.s, 1963;
Th. W. Adorno, Parataxis, Zur späten Lyrik H.s, in: ders., Noten z. Lit. 3, 1965;
A. Beck, Forschung u. Deutung, Ausgew. Aufsätze z. Lit., 1966;
ders., H. als Republikaner, in: H.-Jb. 15, 1967/68;
R. Minder, H. unter d. Deutschen, in: ders., Dichter in d. Ges., 1966;
P. Szondi, H.-Stud., 1967;
K.-R. Wöhrmann, H.s Wille z. Tragödie, 1967;
H.-W. Jäger, Pol. Kategorien in Poetik u. Rhetorik d. 2. Hälfte d. 18. Jh., 1970;
ders., Pol. Metaphorik im Jakobinismus u. im Vormärz, 1971;
Über H., Aufsätze v. Th. W. Adorno, F. Beißner, W. Benjamin, W. Binder, B. Böschenstein, W. Killy, M. Kommerell, L. Ryan, W. Schadewaldt, E. Staiger, P. Szondi, K. Viëtor, hrsg. v. J. Schmidt, 1970;
H., Eine Chronik in Text u. Bild, hrsg. v. A. Beck u. P. Raabe, 1970 (P, auch z. Fam., Susette Gontard u. z. Freundeskreis);
J. Schmidt, H.s Elegie „Brod u. Wein“, Die Entwicklung d. hymn. Stils in d. eleg. Dichtung, 1968;
G. Lepper, Zeitkritik in H.s „Hyperion“, in: Festgabe f. H. O. Burger, 1968;
J. Scharfschwerdt, H.s „Interpretation“ d. „Contrat social“ in d. „Hymne an d. Menschheit“, in: Schiller-Jb. 14, 1970;
H., Zum 200. Geb.-tag, Kat. d. Ausstellung d. Schiller-Nat.mus. Marbach a. N., 1970;
W. Binder, H.-Aufss., 1970. - Zur Geneal.:
H. W. u. E. Rath, Ahnenliste H., in: 50 J. Fam.forschung in Südwestdtld., 1970;
H. Decker-Hauff, F. H.s Vorfahren, ebd. -
Porträts
getönte Bleistiftzeichnung, Jugendbildnis, 1786 (Stuttgart, Württ. Landesbibl.);
getuschter Schattenriß, H. als Magister, 1790 (ebd. u. Marbach, Schiller-Nat.mus.);
Pastellbild v. F. K. Hiemer, 1792 (Marbach, Schiller-Nat.mus.);
getuschter Schattenriß, um 1797 (ebd.);
Kohlezeichnung v. J. G. Schreiner, 1825/26 (Frankfurt/M., Goethemus.);
Wachsrelief d. greisen H. v. W. Neubert, wohl um 1840 (Marbach, Schiller-Nat.mus.);
Bleistiftzeichnung v. Louise Keller, 1842 (ebd.), danach Stahlstich f. d. Titelbild d. 2. Aufl. d. Gedichte, 1843;
Stahlstich v. K. Mayer, nach e. Zeichnung v. L. Keller, n. 1843, idealisierend n. F. K. Hiemers Pastell, das maßgebende H.-Bild d. 19. Jh.;
alle abgebildet bei Beck/Raabe, s. L;
s. a. O. Güntter, Die Bildnisse H.s, 1928. -
Autor/in
Martin Glaubrecht -
Zitierweise
Glaubrecht, Martin, "Hölderlin, Friedrich" in: Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 322-332 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118551981.html#ndbcontent
-
Hölderlin, Johann Christian Friedrich
-
Biographie
Hölderlin: Johann Christian Friedrich H. wurde am 20. März 1770 in dem württembergischen Städtchen Lauffen am Neckar geboren. Bereits am 5. Juli 1772 verlor er seinen Vater, den Klosterhofmeister Heinrich Friedrich H., und die Erziehung des Knaben war zunächst dem Einfluß der Mutter und Großmutter überlassen. Nachdem er die Lateinschule zu Nürtingen absolvirt und das Landexamen bestanden hatte, besuchte er von 1784—88 die Klosterschulen von Denkendorf und Maulbronn, um für das theologische Studium vorgebildet zu werden. Schon in dieser Periode äußerte sich seine poetische Befähigung, welche durch die Dichter des Alterthums, sowie andererseits durch Klopstock und den Macpherson’schen Ossian angeregt wurde.
Im Herbst 1788 bezog H. das theologische Stift zu Tübingen. Obwol bereits in frühen Jahren der Einsamkeit nachhängend und zu grübelnder Melancholie geneigt, gewann der durch Schönheit, Bildung und edle Sinnesart ausgezeichnete Jüngling hier bald einen Kreis von vortrefflichen Freunden, unter denen Neuster und Magenau seine Liebe zur Dichtung theilten, Hegel und später der 1790 ins Stift gekommene Schelling mit ihm durch gleiche philosophische Bestrebungen verbunden waren. Schon damals wurde H. durch die harmonievollen Schöpfungen des griechischen Geistes mächtig ergriffen; und doch erscheint er in mancher Hinsicht wie ein Nachzügler der Sturm- und Drangperiode, deren Losungsworte „Natur“ und „Freiheit“ nicht nur seine Jugendpoesien, sondern in gewissem Sinne die Zielpunkte aller seiner Dichtungen bezeichnen.
Die schwärmerische Liebe zur Natur, welche H. seit den träumerischen Tagen seiner Kindheit eigenthümlich gewesen, war durch die Entbehrungen, welche ihm die Disciplin jener klösterlichen Bildungsanstalten auferlegte, sowie durch den Verwandten Zug der unter Rousseau's Einfluß stehenden zeitgenössischen Litteratur verstärkt worden. Die poetische Neigung, in der Natur nicht nur den Widerhall des eigenen Gemüthslebens zu vernehmen, sondern mit Berg und Wald, mit Wolken und Gestirnen, wie mit beseelten Wesen zu Verkehren, verband sich mit dem Studium antiker Philosophen, Spinoza's und wahrscheinlich auch der philosophischen Briefe Schiller's, um jenen Pantheismus zu erzeugen, welchen Rosenkranz treffend als die dichterische Bevorwortung Schelling's und Hegels bezeichnet hat.
Auch an Hölderlin's Freiheitsbegeisterung hat die Beschäftigung mit dem classischen Alterthum erheblichen Antheil; doch vermögen wir daneben den Einfluß von Klopstock's Teutonismus und Schubart's Tyrannenhaß, von Rousseau's Contrat social und Schillers Don Carlos zu verfolgen. Solchen Anregungen entsprechend ist Hölderlin's politischer Enthusiasmus bald mehr patriotisch, bald kosmopolitisch gefärbt, bald auf die Vergangenheit, bald auf die Gegenwart und Zukunft gerichtet. Noch ehe H. seine schönsten Weisen zum Ruhme der Heroen von Marathon anstimmte, besang er die „Heldenschatten“ der Burg Tübingen und die „heiligen Kämpfer“ der Eidgenossenschaft, und mächtiger noch als solche der Vorzeit gewidmete Klänge ertönen die Jubellieder, welche der Beginn der französischen Revolution in ihm hervorrief. Auch H. huldigte, wie Hegel und Schelling, den politischen Tendenzen, welche im Anfang der neunziger Jahre unter den Tübinger Studenten zur Geltung gelangt waren; und wenn gleich die Erzählung, daß er mit jenen Genossen einen auf dem Marktplatz oder an den Ufern des Neckars aufgerichteten Freiheitsbaum umtanzt habe, in den Bereich des Mythus gehört, so ist doch unzweifelhaft, daß er für die Politische Wandlung in Frankreich die lebhafteste Sympathie bekundete und in begeisterten Hymnen die Wiederkehr der langentbehrten Freiheit und die beginnende Vollendung der Menschheit feierte.
Die Harmonie des Universums und die harmonische Entwicklung des Menschengeschlechts bilden überhaupt das Grundthema seiner Jugendgedichte, gleichviel ob sie an „die Stille" oder an „die Schönheit", an „die Freiheit“ oder an „den Genius der Tugend“ gerichtet sind. Wenn der Gedankengehalt dieser Poesie vorzugsweise durch Schiller, hier und da auch durch Heinse bestimmt worden ist, und wenn dieselbe an das Vorbild des ersteren in formeller Hinsicht fast ausnahmslos erinnert, so fesselt sie uns trotz dieses Mangels an Originalität als Ausdruck einer idealistischen Jünglingsnatur, welche gleichmäßig durch dichterischen und philosophischen Schwung emporgetragen, beseligt durch Liebe und Freundschaft, wie durch enthusiastische Zukunftshoffnungen den Jubel des reichbeglückten Herzens in melodischen Rhythmen erklingen läßt.
Freilich gesellten sich diesem Frohlocken der Jugend frühzeitig genug Klagen der Wehmuth hinzu, um dasselbe schließlich völlig zu übertönen. Indem H. in der Poesie sich namentlich der Lyrik widmete, unter den Künsten die Musik bevorzugte (wie er denn als ein besonders begabter Schüler des Flötenspielers Dulon bezeichnet wird), und indem er andererseits in wissenschaftlicher Hinsicht sich hauptsächlich dem Gebiet abstracter Speculation zuwandte, so trugen alle seine Lieblingsbeschäftigungen dazu bei, sein inneres Leben zu vertiesen, seinen Idealismus zu steigern und ihn von den realen Verhältnissen längere Zeit fern zu halten. Da die Berührung mit den letzteren indessen nicht völlig ausbleiben konnte, ergaben sich naturgemäß eine Reihe bitterer Enttäuschungen. „Dies ist das heilige Ziel meiner Wünsche und meiner Thätigkeit — dies, daß ich in unserm Zeitalter die Keime wecke, die in einem künftigen reifen werden“ — so schrieb er in der letzten Zeit seines Universitätsaufenthalts an den ihm innig verbundenen Halbbruder. Zur Hebung und Besserung des Menschengeschlechts hoffte er beitragen zu können, und doch war — da er zum Eintritt in die theologische Carriere sich nicht zu entschließen vermochte — das Hofmeisterthum die einzige Berufsthätigkeit, die ihm Zeit seines Lebens zu Theil geworden.
Die erste Einführung Hölderlin's in diese Art der Wirksamkeit ist wegen der begleitenden Umstände von Interesse. Schiller, im J. 1793 von Charlotte v. Kalb beauftragt, ihr einen Erzieher für ihren Sohn zu empfehlen, hatte, nachdem ein früherer Vorschlag keinen Anklang gefunden, während seines Aufenthalts in Schwaben sein Augenmerk auf Hegel gerichtet. Da dieser indessen um dieselbe Zeit eine ähnliche Aufforderung aus Bern erhalten, so verwandte sich der württembergische Rechtsgelehrte und Dichter G. Stäudlin in einem an Schiller gerichteten Schreiben (vom 20. September 1793) für H., den „gewiß nicht wenig versprechenden Hymnendichter“, aufs angelegentlichste, indem er sich zugleich für die Reinheit seines Herzens und seiner Sitten und für die Gründlichkeit seiner Kenntnisse verbürgte. Nachdem Schiller hierauf die — freilich zunächst nur flüchtige — persönliche Bekanntschaft Hölderlin's gemacht und über ihn in wohlwollenden, der Hauptsache nach günstigen Ausdrücken berichtet hatte, erfolgte das Engagement. Einige Zeit darauf verließ H. das württembergische Heimathland, aus dessen beengender Sphäre er nach Schwabenart hinausstrebte, und für welches er doch Zeitlebens die rührendste Liebe und Anhänglichkeit bewahrt hat.
Der Aufenthalt Hölderlin's bei Frau v. Kalb zu Waltershausen im Grabfeld unweit Meiningens gestaltete sich zunächst völlig nach seinem Wunsch. Die mit Einsicht und Eifer begonnene pädagogische Thätigkeit hatte wenigstens anfänglich großen Reiz für ihn. Dazu kam, daß Frau v. Kalb nicht nur durch die mütterliche Freundschaft, die sie ihm zu Theil werden ließ, seine Dankbarkeit erweckte, sondern ihn auch durch die Tiefe und Klarheit ihres ungewöhnlichen Geistes zur Bewunderung fortriß. Beide waren überhaupt verwandte Naturen, und es ist mit Recht darauf hingewiesen worden, daß sich in den hinterlassenen|Aufzeichnungen der Charlotte v. Kalb „der schwärmerisch inbrünstige Stil Hölderlins“ wiederfindet. Solcher inneren Gemeinschaft ungeachtet vermochte jene Stellung dem jugendlichen Dichter keine dauernde Befriedigung zu gewähren. Bereits gegen Ende des J. 1794, da er mit seinem Zögling nach Jena geschickt worden, war er Schiller sowol wie Fichte näher getreten und hatte reiche Anregung von ihnen empfangen. So entstand der Beschluß, im Anfang des J. 1795 seine bisherigen Beziehungen zu lösen und im Verkehr mit jenen Männern eine Zeitlang ausschließlich seiner Selbstbildung zu leben. Schiller bekundete für seinen talentvollen Landsmann das wärmste Interesse, und sein „kolossalischer Geist“ übte auf den begeisterten Jünger einen mächtigen, diesem fast erdrückend erscheinenden Einfluß aus. Gleichzeitig ward H. durch die gewaltige Persönlichkeit Fichte's gefesselt, in dessen Lehre er sich, durch das gründliche Studium der Kant’schen Philosophie vorbereitet, mit Eifer vertiefte, und dessen feuriger Vortrag seine Begeisterung entzündete. Der Wunsch, längere Zeit in der Umgebung der von ihm verehrten Männer zu leben und später vielleicht selbst in Jena Vorlesungen zu halten, wurde durch die äußeren Verhältnisse vereitelt.
Muthmaßlich im Juni 1795 kehrte H. in das Mutterhaus nach Nürtingen zurück. So oft auch in der Fremde ihn Sehnsucht nach den Seinigen ergriffen, so vermochte doch auch daheim die zunehmende Niedergeschlagenheit seines Gemüths keine Heilung zu finden. Es fehlte ihm hier sowol an einem befriedigenden Beruf wie an Nahrung für das eigene Geistesleben: und immer schwerer ward es ihm, den Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit in allen kleinen und großen Verhältnissen des Lebens zu überwinden, immer mehr wurde er Fremdling in der ihn umgebenden Welt. Bezeichnend ist die Klage in einem Brief an seinen Freund Neuner, daß er die Menschen nie verstehen lerne, ohne einige goldene kindische Ahnungen aufzuopfern; und nicht minder trifft auf ihn zu, was er zur Charakteristik seines Romanhelden Hyperion sagen läßt, daß er nämlich an einem Tage siebzigmal vom Himmel auf die Erde geworfen werde. Wie in seinen Briefen, so ist in seinen Gedichten Schwermuth die Grundstimmung, aus welcher nur ein rasch vorübergehender Traum ihn zeitweilig zu erlösen schien.
Im Anfang des J. 1796 erhielt H. durch Vermittelung seines Freundes Sinclair eine Hofmeisterstelle bei dem Kaufmann J. F. Gontard in Frankfurt a. M. Die Gemahlin desselben. Susette geb. Borkenstein aus Hamburg, war durch Schönheit, Charakter und harmonische Geistesbildung ausgezeichnet. Da ihr vorzugsweise die Sorge für die Erziehung der Kinder oblag, so geschah es, daß H. ihr näher trat und sich dem Zauber ihres Wesens nicht zu entziehen vermochte. Sie erschien ihm als das Ideal einer weiblichen Natur. Begeistert nannte er sie eine Griechin, was für ihn den Inbegriff des Hohen und Edlen bedeutete. Sein Leben, das ihm nichts mehr werth gewesen, ward verjüngt, gestärkt und erheitert, und auch seine Poesie floß reicher und freudiger. Doch das in den Liedern „an Diotima“ mit so Hellem Jubelton besungene Glück konnte seiner Natur nach nicht von Dauer sein. Obwol H. — wie es scheint — in der Aeußerung seiner Leidenschaft nie die Grenze des Erlaubten überschritten, so trug doch das Verhältniß den Keim des tragischen Ausganges in sich. Unter den inneren Kämpfen, welche H. zu bestehen hatte, kehrte der frühere Trübsinn zurück. Schließlich war es ein herber Zusammenstoß mit dem Herrn des Hauses, welcher ihn zum schleunigen Verlassen jener Stellung bestimmte (Herbst 1798).+) Hiergeändert aus: Zu S. 730. Z. 7 v. u. [d. Red.] ist zu bemerken, daß nach einem Brief Hölderlin's an seine Mutter vom 10. October 1798 (vgl. Kelchner a. a. O. S. 10) zu schließen — sich der Abschied des Dichters von Herrn Gontard in höflichen Formen vollzog.
H. begab sich jetzt zu Sinclair nach Homburg, wo ihm der theilnehmende Zuspruch des letzteren und der Verkehr mit trefflichen Menschen wol einige Beruhigung gewährte, aber die unheilvolle Wunde nicht zu lindern vermochte. Als im November 1798 Sinclair von dem Landgrafen Friedrich V. von Hessen-Homburg zum Congreß nach Rastadt abgesandt wurde, entschloß sich H., der Einladung des Freundes Folge leistend, ihn dahin zu begleiten. Indessen war der Eindruck, welchen er dort von der politischen Erniedrigung Deutschlands empfangen mochte, wol dazu angethan, seine melancholische Gemüthsstimmung noch mehr zu verdüstern. Gegen Ende des Jahres kehrte er nach Homburg zurück, um in unablässiger Beschäftigung mit der Poesie und Philosophie Trost zu suchen.
Bot der Hymnus den entsprechenden dichterischen Ausdruck für die frohe Begeisterung der akademischen Jugendtage Hölderlin's, wie nicht minder für die weihevolle Stimmung seiner Liebe zu Diotima dar, so ist doch der Grundton in der Mehrheit seiner Dichtungen, namentlich aus späterer Zeit, durchaus elegisch. Mit Wehmuth blickte er nicht nur auf das eigene Jugendglück zurück, sondern auch auf das dahingeschwundene Jugendalter der Menschheit. Je mehr die damaligen Zustände Deutschlands mit seinem Humanitätsideal in Widerspruch standen, um so tiefer versenkte er sich in die Welt des Hellenenthums, welche seine Phantasie zu einem verlorenen Paradies der Menschheit umgestaltete. In diesem Sinne, wie in manchen anderen Beziehungen, ist keine andere Dichtung so charakteristisch für H. wie sein Roman Hyperion. Der erste Entwurf desselben stammt aus der Tübinger Zeit. Um die Veröffentlichung des Werks machte sich namentlich Schiller verdient, der ein Fragment im vierten Bande seiner Thalia mittheilte und alsdann Cotta zur Herausgabe des Ganzen veranlaßte. Nach mannichsachen Umarbeitungen, welche nicht zum mindesten durch die eigenen Lebenserfahrungen Hölderlin's hervorgerufen waren, erschien der erste Band des Romans 1797, der zweite 1799. Die Behandlung des Gegenstandes in Briefen erinnert an das Vorbild der neuen Heloïse und des Goethe’schen Werther's, doch sind die Briefe im Hyperion meist nicht der unmittelbare Ausdruck des jüngst Erlebten, sondern sie berichten der Mehrheit nach über Dinge, dir sich vor geraumer Zeit zugetragen. Es bewirkt daher die angedeutete Einkleidung, daß, ähnlich wie bei Macpherson's Offian, die dargestellten Ereignisse — auch Glück und Lust — als längst entschwundene, in melancholische Beleuchtung gerückt werden, und daß um so leichter die Erzählung des Thatsächlichen sich in den lyrischen Ausdruck der Empfindung verflüchtigt. Ergibt sich hieraus schon, daß H. den Erfordernissen eines Romans und speciell eines historischen Romans, der im J. 1770 zur Zeit des von Katharina II. geschürten Griechenaufstandes spielen sollte, nur wenig zu genügen im Stande war; so erscheint seine Dichtung andererseits im höchsten Grade beachtenswerth, wenn wir sie ausschließlich als eine Aneinanderreihung poetischer Selbstbekenntnisse betrachten. Um die Hingebung des Helden an einen verehrten Lehrer, seine ideale Freundschaft und Liebe, sein zartes, erregbares, alles Große mit glühendem Enthusiasmus ergreifendes Gemüth zu schildern, durfte der Dichter nur sein eigenes Seelenleben in Worte fassen. Der Gram des Helden über die Versunkenheit des modernen Griechenlands verkündet Hölderlin's Empfindungen über die Erniedrigung Deutschlands. Ist die Schilderung von Hyperion's thatkräftigem Eingreifen, um die Befreiung seines Vaterlandes und die Wiedergeburt des alten Hellas zu bewirken, ein verklärtes Spiegelbild dessen, was H. ersehnte, so klingt uns andererseits in den wehmüthigen Berichten von des Helden Mißerfolg der Nachhall so mancher schmerzlicher Enttäuschungen des Dichters entgegen. Zum Schluß findet Hyperion Trost und Frieden durch völlige Hingebung an die Natur, in deren Echooße auch H. stets von neuem Genesung suchte. Und nicht nur sein Gefühlsleben, sondern seine gesammte religiös-philosophische Weltanschauung hat H. in seinem Roman niedergelegt, seinen Pantheismus, seine Ideen über Schönheit und Kunst, seine Ansichten über den Entwicklungsgang der Menschheit, welche er hier in den Worten zusammenfaßt: „Von Kinderharmonie sind einst die Völker ausgegangen, die Harmonie der Geister wird der Anfang einer neuen Weltgeschichte sein.“
Wol noch weniger als zum Romandichter im gewöhnlichen Sinne des Worts mochte H. zum Dramatiker geschaffen sein. Dennoch hatte ihn insbesondere das Studium der griechischen Vorbilder zu Versuchen auch auf dem Gebiete der Tragödie begeistert. Wie er bereits in Waltershausen den Plan zu einem Drama „Der Tod des Sokrates“ gehegt, so hatte er später den spartanischen König Agis zum tragischen Helden erwählt und sich mit diesem Thema sowol in Rastatt, wie in Homburg beschäftigt+) Hiergeändert aus: S. 732. Z. 5 ff. [d. Red.] ist das über Hölderlin's „König Agis“ Gesagte zu tilgen, da es nach Litzmann's Ausführungen zweifelhaft erscheint, ob H.Hölderlin ein Drama unter diesem Titel geschrieben hat. . Die damals vollendeten Bruchtheile der Dichtung scheinen indessen verloren zu sein. Dagegen besitzen wir sehr ansehnliche Fragmente von dem Drama „Der Tod des Empedokles“, zu dessen Ausführung H. in Homburg seine Kräfte vorzugsweise concentrirte. Ist Hyperion nur der auf neuhellenischen Boden verpflanzte H., so sollte im Empedokles gleichsam sein erhöhtes und idealisirtes Selbst zum Ausdruck gelangen. Der Held dieser Dichtung erscheint als Berather und Wohlthäter seines Volks, als Vertrauter der Natur und Kündiger tiefsinniger Weisheit. Aehnlich, wie es H. früher bei der beabsichtigten Behandlung von Sokrates' Tod vorgeschwebt haben mochte, galt es hier, das Leid des hoch über seinem Volke stehenden und schmählich von ihm verkannten Philosophen zur Darstellung zu bringen. Andererseits scheint es, daß der durchaus im Pantheismus lebende Dichter in diesem seinem großartigst angelegten Werke den geheimen Widerspruch, der in der pantheistischen Weltauffassung begründet ist und die aus demselben hervorgehende Tragik veranschaulichen wollte. Tritt uns diese Absicht Hölderlin's vor Allem in den Monologen des Empedokles und in dessen Unterredungen mit seinem Jünger Pausanias entgegen, so bekunden die männlichen und weiblichen Nebenfiguren, daß es dem Dichter an Talent zur Charakterzeichnung keineswegs völlig gebrach. Auch sind unter den ausgeführten Scenen einige, welche sich durch vollendete Anmuth und Durchsichtigkeit der Diction auszeichnen; daneben freilich finden sich solche, in welchen die Rede den zum Licht strebenden Gedankenreichthum nur unvollkommen durchschimmern läßt.
H. hatte den Wunsch gehegt, wenigstens solange in Homburg unabhängig zu leben, bis er den „Empedokles“ zu einiger Reife gebracht: doch Kränklichkeit durchkreuzte seinen Vorsatz. Auch der Plan, durch die Begründung eines Journals „Iduna“ auf die ästhetische Bildung der Nation einzuwirken und zugleich die eigene Existenz zu sichern, scheiterte vollständig, da es ihm an der ausreichenden Unterstützung geeigneter Mitarbeiter fehlte. Der unter Anderen zur Betheiligung aufgeforderte Schiller versagte nicht nur diese, sondern bemühte sich zugleich, auf Grund seiner 16jährigen Erfahrungen, das an sich ziemlich Undankbare und in Hölderlin's Lage geradezu Aussichtslose eines solchen Unternehmens unumwunden darzuthun.
Unter solchen Umständen lenkte H. seine Blicke wieder auf das württembergische Heimathland, und der Gedanke tauchte wol einmal in ihm auf, nunmehr daselbst als Pfarrvicar in die geistliche Carriere einzutreten. War doch durch den poetischen und philosophischen Pantheismus der fromme Glaube seiner Kindheit im Herzen Hölderlin's nimmer ausgelöscht worden, vielmehr in dem Gedichte zum 72. Geburtstag der Großmutter (1799) zu rührendem Ausdruck gelangt. Dennoch vermochte H. auch jetzt keinen entscheidenden Entschluß in der angedeuteten Richtung zu fassen. Es wirkte dabei mit, daß er befürchtete, beim Antritt eines Amts die freie Muße zu schriftstellerischer Thätigkeit einzubüßen. Trotzdem kehrte er, dem Wunsche der Seinigen folgend, im Sommer 1800 nach Schwaben zurück, schon damals körperlich herabgekommen und von reizbarster Gemüthsstimmung. Doch schien es, als ob er auf heimathlichem Boden noch einmal von frischem Lebensmuth angeweht werden sollte. Zeitweilig wenigstens erfreute er sich der langentbehrten inneren Ruhe, und die Aussicht auf einen nahen|Friedensabschluß erweckte in ihm die freilich allzu optimistische Hoffnung, daß nun auch eine bessere Periode für Deutschland bevorstehe, in welcher Liebe und Gemeingeist über den Egoismus herrschen und „das deutsche Herz seine geheimen, weitreichenden Kräfte entfalten werde.“
Im Januar 1801 übernahm H. eine Hauslehrerstelle zu Hauptwil unweit Constanz, kehrte indeß bereits nach einigen Monaten zurück. Der Hofmeisterthätigkeit endlich überdrüssig geworden, hoffte er eine befriedigendere Wirksamkeit zu erlangen, wenn er Gelegenheit fand, einer akademischen Jugend die Früchte seiner Studien auf dem Gebiet der griechischen Litteratur und Philosophie mitzutheilen. Er beabsichtigte sich in Jena als Docent niederzulassen und rechnete dabei — wie es scheint — vor Allem auf die Unterstützung Schiller's. Aber auch dieses Vorhaben scheiterte. Der Subsistenzmittel entbehrend mußte H. aufs neue der Heimath den Rücken wenden, um wiederum eine Hauslehrerstelle anzutreten — dieses Mal in dem fernen Bordeaux bei dem Hamburgischen Generalcommissär (Consul) D. Ch. Meyer. Ende Januar 1802 traf er daselbst ein. Ueber die Aufnahme, welche er gefunden, äußerte er sich überaus befriedigt. Auch fehlte es nicht an mannichfachen Anregungen. Durch den Anblick von Ueberresten der antiken Cultur und den Verkehr mit den südlicheren Menschen ward ihm das Wesen der Griechen verständlicher als zuvor. Andererseits haben vielleicht gerade der Reichthum der neuen Eindrücke und die Gluth des südlichen Himmels nicht wenig dazu beigetragen, das mehr als einmal in seinen Tiefen betroffene Gemüthsleben des allzu zart organisirten Dichters vollends zu erschüttern. Mehrere Monate war seine Familie ohne Kunde von ihm geblieben, als er in der zweiten Juniwoche 1802 in Bettlertracht, leichenblaß, mit hohlem und wildem Auge als ein Irrsinniger wieder in seinem Heimathlande erschien. Wir wissen nicht, wodurch in letzter Veranlassung dies grausame Verhängniß auf ihn herabbeschworen ward. Im Mai hatte er plötzlich seine Stelle in Bordeaux verlassen, in den heißesten Sommertagen ganz Frankreich von Westen nach Osten zu Fuß durchstreift. Erst einige Zeit nach seiner Heimkehr erfolgte der Tod Diotimas (22. Juni 1802),auf den man früher häufig irrthümlich den Ausbruch von Hölderlin's Wahnsinn zurückgeführt hat.
Die sorgsame Pflege, welche H. zu Nürtingen im mütterlichen Hause zu Theil ward, vermochte zeitweilig seine Genesung zu fördern, sodaß er sich aufs neue in eigenen Gedichten versuchen und andererseits in das Studium der griechischen Dichter versenken konnte. Er beschäftigte sich insbesondere eifrig mit Pindar, und unzweifelhaft durch dieses Vorbild verleitet, erhob er sich in seinen Hymnen „Patmos“, „Die Wanderung“, „Der Rhein“ zu fast noch freierem und gewagterem Flug als zuvor. Aber so eigenartig ergreifend und tiefsinnig einzelne Stellen dieser Dichtungen erscheinen, so gemahnt doch das Unvermögen, sich auf der kühn erstrebten Höhe zu erhalten, au das von Horaz den Nachahmern Pindar's verkündete Ikarische Schicksal. Heilsamer unzweifelhaft war für H. das Studium des Sophokles. Seine (im J. 1804 zu Frankfurt a. M. erschienene) Uebersetzung von König Oedipus und Antigone geben die Dialoge in 5-füßigen (dann und wann mit 6-füßigen untermischten) Jamben, die Chöre in fessellosen Rhythmen wieder; oft ungenau, oft allzu genau, spiegeln sie die Vollendung des Originals nur in unzureichender Weise, dennoch scheint es, daß die maßvolle Schönheit des griechischen Tragikers Hölderlin's Geist in wohlthätigen Schranken hielt und ein weiteres Abirren verhinderte. Im Sommer 1804 war er soweit hergestellt, daß ihn sein Freund Sinclair nach Homburg zu geleiten vermochte. Der Landgraf, der für die deutsche Litteratur das lebhafteste Interesse bekundete, und mit dem Dichter bereits während seines früheren Homburger Aufenthalts persönlich bekannt geworden, ertheilte demselben den Titel eines Bibliothekars, während der getreue Sinclair ihm einen Theil seines Gehaltes abtrat. Soviel Wohlwollen H. aber auch entgegengetragen wurde, so ließ doch nach Verlauf|zweier Jahre die Verschlimmerung seines Zustandes es rathsam erscheinen, ihn in seine Heimath zurückzuführen. Im Herbst 1806 wurde er nach Tübingen in die Klinik von Autenrieth gebracht. Da das hier versuchte Heilungsversahren fehlschlug, wurde er im Sommer 1807 dem Tischlermeister Zimmer in Tübingen zur Pflege anvertraut, in dessen am Neckar gelegener Wohnung er bis an sein Lebensende (7. Juni 1843) geblieben ist.
Als Grundcharakter von Hölderlin's Krankheit wird die aus ungeheurer Erschöpfung hervorgehende Zerstreutheit seines Geistes bezeichnet. Indessen ist es charakteristisch, daß, so verwirrt und sinnlos seine gewöhnliche Rede erschien, seine zahlreichen während der Periode des Irrsinns entstandenen Dichtungen des Zusammenhangs der Gedanken nicht völlig entbehren und noch weniger den Wohllaut des Rhythmus vermissen lassen. Nicht minder bezeichnend, daß auch in diesem traurigen Abschnitt seines Lebens Musik seine Lieblingsbeschäftigung bildete, denn gerade das wurde für ihn in jeglicher Hinsicht verhängnißvoll, daß sein Sinn für Wohllaut und Harmonie zarter und vollkommener ausgebildet war, als bei anderen Menschen. Zufolge dieser seiner Anlage mußten die Mißklänge des realen Lebens ihm unerträglich werden und auf seine Natur schließlich einen zerstörenden Einfluß üben. Ebenderselben Anlage aber verdanken wir die besten seiner lyrischen Gedichte, in welchen die Gedanken gleichsam in Musik umgesetzt, und die antiken Versmaße, insbesondere die alcäische Strophe, mit unvergleichlicher Meisterschaft behandelt werden. Bieten Hyperion und Empedokles, die Jugendgedichte und selbst einige der Lieder an Diotima vorzugsweise ein biographisches und in gewissem Sinne pathologisches Interesse dar, so sind es Hölderlin's eigenartigste, eben so sehr durch Tiefe des Gefühls wie durch Adel der Gesinnung, durch Ideenreichthum wie durch Formvollendung ausgezeichnete Oden: „Das Ahnenbild", „Der blinde Sänger", „Dichtermuth", „Der gefesselte Strom", „Dem Sonnengott", „Mein Eigenthum", welche ihm einen Platz neben den hervorragendsten Lyrikern aller Zeiten sichern. Von kaum geringerer dichterischer Schönheit und zugleich bedeutungsvoll als Zeugnisse der patriotischen Gesinnung Hölderlin's, der trotz der zornvollen Worte im Hyperion den Werth seines Volkes zu schätzen wußte, sind die Dichtungen: „Der Tod fürs Vaterland", „Gesang des Deutschen“, „An die Deutschen“, in welchen letzteren er den nahebevorstehenden Fortschritt von einer einseitig litterarischen Cultur zu einer Periode der Thatkraft mit prophetischem Geiste verkündet und zugleich die Ahnung ausspricht, daß die deutsche Nation vor allen berufen sei, das ersehnte Ideal einer harmonischeren Gesittung zu verwirklichen.
-
Literatur
Vgl. Friedrich Hölderlin's sämmtliche Werke, herausgegeben von Christoph Theodor Schwab (1. Bd. Gedichte und Hyperion. 2. Bd. Nachlaß und Biographie), Stuttgart und Tübingen 1846. Fr. Hölderlin's ausgewählte Werke, herausgegeben von Ch. Th. Schwab, Stuttgart 1874 (mit revidirter Biographie). Ergänzungen hat Schwab im Morgenblatt f. gebildete Leser 1863 Nr. 34 u. 35 und in Westermann's Illustr. D. Monatsheften 30. Bd. S. 650 bis 663, ferner Julius Klaiber in der Festschrift: Hölderlin, Hegel und Schelling in ihren schwäbischen Jugendjahren, Stuttgart 1877, mitgetheilt. Hölderlin's Frankfurter Aufenthalt schildert speciell Carl Jügel, Das Puppenhaus, e. Erbstück in d. Gontard’schen Familie, Frkf. a. M. S. 388—91. Eingehendere Würdigungen Hölderlin's finden sich u. A. bei Alexander Jung, Fr. Hölderlin und seine Werke, Stuttg. u. Tübingen 1848, und bei Haym, Die romantische Schule (Berlin 1870), S. 289—324.
-
Autor/in
Ad. Wohlwill. -
Zitierweise
Wohlwill, Adolf, "Hölderlin, Johann Christian Friedrich" in: Allgemeine Deutsche Biographie 12 (1880), S. 728-734 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118551981.html#adbcontent