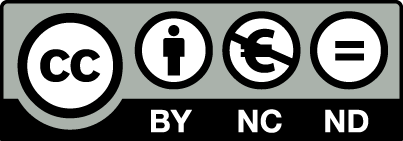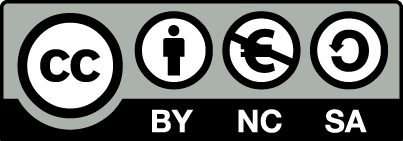Hoffmann, Ernst
- Lebensdaten
- 1776 – 1822
- Geburtsort
- Königsberg (Preußen)
- Sterbeort
- Berlin
- Beruf/Funktion
- Dichter ; Musiker ; Jurist ; Humorist
- Konfession
- lutherisch
- Normdaten
- GND: 118552465 | OGND | VIAF: 29535422
- Namensvarianten
-
- Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm
- Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (seit 1804 aus Verehrung für Mozart)
- Hoffmann, E. T. A.
- Hoffmann, E. Th. A.
- Hoffmann, Ernst
- Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm
- Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (seit 1804 aus Verehrung für Mozart)
- hoffmann, ernst theodor amadeus
- Hoffmann, E. T. A.
- Hoffmann, E. Th. A.
- C. F. A.
- Hoffmann, Ernst Theodor Amadäus
- Hoffmann, Ernst-Theodor-Amadeus
- Hoffmann, Ernesto Teodoro Amedeo
- Hoffmann, Ernest Th. A.
- Hoffmann, Ernst Th. Amadeus
- Hoffmann, E. Th. Am.
- Hoffmann, E. T. W.
- Hoffmann, Ernst Theodor
- Hoffmann, E.
- Hoffmann, Amadeo
- Hoffmann, ETA
- Hôffman, Ernsṭ Têʾôdôr Amadêʾûs
- Hofman, E. T. A.
- Hofman, Ernst Teodor Amadej
- Chofman, Ernst Theodor Amadeus
- Chofman, E. T. A.
- Gofman, Ernst-Teodor-Amadej
- Gofman, Ernst Teodor Amadej
- Gofman, Ė.-T.-A.
- Gofman, Ernst
- Hofmanas, E.T.A.
- Hofmanis, E. T. A.
- Hofuman, E.Te.A.
- Hofuman, E.T.A.
- Hoffmann, Ernesto Teodoro Guillermo
- Hoffmann, Ernst T.
- Chofman, Ernst Teodor Amadeus
- E.T.A. Huo fu man
- E.-T.-A.-Huofuman
- Huofuman, E. T. A.
- Huofuman
- Hoffmann, Ernest T. A.
- Hoffmann, E.T.
- Hôfman, E. T. A.
- Chophman, E. T. A.
- Gofman, Ėrnst Teodor Amadei
- Gofman, Ė.T.A.
- Hofmanas, Ernstas Teodoras Amadėjus
- Hofmanis, Ernests Teodors Amadejs
- Huofuman, En Tai A
- En-Tai-A-Huofuman
- Hôffman, Ernsṭ Têôdôr Amadêûs
- Hoffmann, Ernst T. A.
- Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm Amadeus
- Gofman, Ėrnst Teodor Amadej
- Gofman, T.
- Hoffmann, E.T.A.
- Hoffmann, A. E. Th.
- Gofman, Ernst Teodor Amadei
Vernetzte Angebote
- Bach - digital [2017-]
- * Autorenlexikon (Literaturportal Bayern) [2012-]
- * Filmportal [2010-]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- * Bayerisches Musikerlexikon Online (BMLO) [2005-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1972] Autor/in: Wulf, Segebrecht (1972)
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Muncker, Franz (1880)
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Bach - digital [2017-]
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Aloys Hirt – Briefwechsel 1787-1837
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte)
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Nachlassdatenbank beim Bundesarchiv
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- * Briefe an Goethe - biografische Informationen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- * Künstler im Objektkatalog des GNM
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Archivportal - D
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Personen in Bavarikon [2013-]
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- * Autorenlexikon (Literaturportal Bayern) [2012-]
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
- Archivportal-D
- Objektdatenbank der Museumslandschaft Hessen Kassel
- Interaktiver Katalog des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- Künstler der Online Collection der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
- * Bildindex der Kunst und Architektur - GND-referenzierte Personen [2018]
- * Graphikportal - Akteure (Künstler, Verleger, Auftraggeber etc.) [2018]
- * Künstler im Objektkatalog des GNM
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
Personen im NDB Artikel
- NDB 6 (1964), S. 584 (Goetz, Karl Wolfgang Gustav)
- NDB 8 (1969), S. 86 (Hauff, Wilhelm)
- NDB 8 (1969), S. 289 (Heine, Christian Johann Heinrich)
- NDB 18 (1997), S. 589 (Mundt, Theodor)
- NDB 25 (2013), S. 446 in Artikel Storm (Storm, Hans Theodor Woldsen)
- NDB 25 (2013), S. 619 in Artikel Studer
- NDB 26 (2016), S. 540 in Artikel Uhlendahl (Uhlendahl, Heinrich)
- NDB 27 (2020), S. 840 (Werner, Friedrich Ludwig Zacharias)
- NDB 28 (2024), S. 245 (Winkler, Hildegard)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm (statt Wilhelm seit 1804 Amadeus aus Verehrung für Mozart, E. T. A.)
Dichter, Musiker, Jurist, * 24.1.1776 Königsberg (Preußen), † 25.6.1822 Berlin. (lutherisch)
-
Genealogie
V Christoph Ludwig (1736–97), Hofgerichtsadvokat in K., seit 1782 Kriminalrat u. Justizkommissar in Insterburg, S d. Pfarrers Frdr. Christoph in Tapiau u. d. Maria Elisabeth Voeteri;
M Lovisa Albertine (1748–96), T d. Joh. Jakob Dörffer (1711–74), Konsistorialrat, Hofgerichtsadvokat u. Prokurator in K., u. d. Lovisa Sophia Voeteri;
Om →Otto Wilh. Dörffer (1741–1811), Justizrat in K., →Joh. Ludwig D. (1743–1803), Regierungs- u. Konsistorialrat in Glogau, seit 1798 Geh. Obertribunalrat in B.;
- ⚭ Posen 1802 Michaelina Rorer (1778–1859), T d. Magistratssekr. Michael Rorer in Posen u. d. Josepha v. Winkler;
1 T (jung †). -
Biographie
Um Person und Werk H.s ranken Legenden. Sein Lebenslauf wurde das Paradigma einer exzentrischen romantischen Künstlerexistenz; als „Gespenster-H.“ und Geisterseher, der an seiner Geliebten Julia Mark zum Dichter geworden sei und die Liebe zu ihr lebenslang als nur im Tode Erfüllung findende Liebe des Künstlers besungen habe, ging er in das Bewußtsein der Öffentlichkeit ein. Sein skurriles Wesen und der ausschweifende Lebenswandel, den man ihm nachsagte, aber auch die Figuren seiner Werke, die Wahnsinnigen, Doppelgänger, Geistererscheinungen, die Künstler und Träumer, die Renegaten und die Tiere trugen zu dem Bild von dem unheimlichsten und groteskesten aller Romantiker bei. Schon die Zeitgenossen hatten daran mitgewirkt, J. Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ hat es bestätigt, und die um die Jahrhundertwende einsetzende H.-Forschung vermochte nichts Grundsätzliches daran zu ändern. Sie lenkte zwar den Blick zunehmend auf das Gesamtwerk H.s, vermehrte jedoch die Mißverständnisse, indem sie große Teile dieses Werkes, nämlich die Almanach-Erzählungen, disqualifizierte und die formal kühnste Dichtung H.s, den Roman vom Kater Murr, in seine Bestandteile zerlegte, weil er „in romantischer Willkür unorganisch durchsetzt [sei] mit einer satirischen Fabel, die den Kater zum Helden hatte“ (Hans von Müller). H.s eingehendes Studium der Naturwissenschaften und Medizin, insbesondere seine Beschäftigung mit dem Magnetismus und den Wahnsinnserscheinungen, seine fortschrittlichen juristischen Auffassungen wurden nur vermerkt, ohne daß versucht worden wäre, sie in das Gesamtbild des Dichters, Musikers und Juristen H. einzufügen. Stattdessen wurde eine radikale Scheidung des Künstlers vom Bürger vorgenommen, die bis heute kaum überwunden ist. Gleichwohl hielt schon|1819 ein Jurist (von Trützschler) das „Vorurtheil, daß ein genialer Schriftsteller für ernste Geschäfte nicht tauge“, durch H. für widerlegt. Ein tiefer Widerspruch besteht zwischen den Deutungen und dem Selbstverständnis H.s; wo man romantische Sehnsucht nach dem Unendlichen sah und bedingungslosen Geschichtsfatalismus, sah sich H. selbst als Künstler wie im Amt in die entscheidenden wissenschaftlichen, künstlerischen und gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit gestellt; wo man von einer verzweifelten Zerrissenheit zwischen Künstlertum und Bürgertum sprach, forderte H. mit höchstem künstlerischem Bewußtsein eine „Integration der Teile zu einem Ganzen“. Seine Wirkung auf die französische Literatur (Baudelaire, Dumas), auf Poe, Dostojewskij, Immermann, R. Wagner, Hofmannsthal, Th. Mann und viele andere ist kaum zu überschätzen, seine Bedeutung für die Kriminalerzählung und die sich aus ihr entwickelnden Gattungen ist unbestritten. Formprobleme des Romans, die im 19. Jahrhundert sichtbar wurden und im 20. Jahrhundert zur Krise des Erzählens führten, wurden von ihm vorweggenommen; die moderne Prosa, die autobiographische Formen der Aufzeichnung, der Niederschrift und des Berichts in zunehmendem Maße für sich nutzbar macht, ist ohne ihn nicht zu denken. Unter solchen Aspekten kann das Biographische nur ein erster Schritt zur Erkenntnis seiner Bedeutung sein.
Nach der Trennung seiner Eltern (1778) wuchs H. im Hause der Familie Dörffer in Königsberg auf. Pedanterie und Gleichgültigkeit, Großzügigkeit und Strenge wirkten auf ihn ein, denn mehrere Angehörige der alten Juristenfamilie erprobten ihre Erziehungsgrundsätze an ihm. Mit seinem Freund Th. G. von Hippel dem Jüngeren besprach H. seine Versuche in allen Künsten; gemeinsam lasen sie Rousseaus „Bekenntnisse“, die Werke der Königsberger Dichter Scheffner, Hippel und Hamann, die Ritterromane der Zeit, aber auch die Klassiker und Werke wie Wieglebs „Natürliche Magie“. H. erhielt früh Unterricht in der Musik (durch Chr. W. Podbielsky) und im Zeichnen (durch J. G. Saemann); in der reformierten Burgschule, die er besuchte, erregte er die Aufmerksamkeit des Rektors St. Wannowski, der ihn zu Kunstgesprächen heranzog. Im Frühjahr 1792 nahm H. an der Königsberger Universität das familienübliche Studium der Jurisprudenz auf, das er, ohne den Vorlesungen der Gelehrten aus anderen Fakultäten (zum Beispiel Kants) viel Interesse entgegenzubringen, zielstrebig absolvierte. Daneben widmete er sich der Musik, komponierte nach dem Vorbild Mozarts, gab Musikunterricht (unter anderem an Dora Hatt, die Frau eines Weinhändlers, in die er sich unglücklich verliebte), malte und zeichnete (Historiengemälde, Karikaturen und Porträts) und verfaßte einen (nicht erhaltenen) Roman mit dem Titel „Cornaro“. 1795 bestand er sein 1. juristisches Examen, setzte seine Ausbildung zunächst in Königsberg fort und ging 1796 nach Glogau, wo sein Onkel J. L. Dörffer Regierungs- und Konsistorialrat war.
Die Briefe an Hippel aus dieser Zeit sind Zeugnisse der Krisen und Beglückungen einer vielseitigen und problematischen Künstlernatur, zu der sich H. mehr und mehr entwickelte. Die Konflikte, in die er geriet, sind nicht allein aus dem Gegensatz von Künstlertum und Bürgerlichkeit, juristischem Alltag und künstlerischer Begeisterung zu erklären; sie ergaben sich aus dem Künstlertum selbst, dessen Richtung und Berechtigung er lange nicht erkannte. Zu einer kontinuierlichen Produktion kam H. erst spät, nämlich als es ihm gelang, die Künste, die er ausübte, untereinander und das Künstlerische selbst als Gesamtkonzeption in sein Leben zu integrieren. Die Zeit in Glogau ist aus solcher Sicht eine Zeit der Ungewißheit und des Zweifels. Auch die Verlobung mit seiner Kusine Minna Dörffer, die H. später wieder löste, ist von daher zu verstehen. Als er 1798 nach dem Referendarexamen seine Versetzung ans Kammergericht in Berlin erreichte, pries er sich glücklich, „ein Nest verlassen zu haben, dessen Einsamkeit mir vielleicht … heilsam gewesen ist“. Von den Eindrücken, die er während einer Reise in der Dresdner Galerie empfing, bekennt er, „daß mich die Nacht von Correggio in den Himmel gehoben – daß mich die Magdalena von Battoni entzückt hat, und daß ich mit tiefer Ehrfurcht vor der Madonna von Raphael gestanden habe“. Auch in Berlin nahmen ihn die Theater und Galerien, die Konzerte und die kunstliebenden geselligen Kreise ganz gefangen, ohne daß er seine juristische Ausbildung darüber vernachlässigt hätte: Er bestand die 2. Staatsprüfung im Februar 1800 mit Auszeichnung. Zuvor hatte er sein erstes Bühnenwerk, das Singspiel „Die Maske“, abgeschlossen und der Königin Luise von Preußen mit der Bitte um Protektion übersandt; zur Aufführung kam es nicht. Auch H.s Wunsch, in Berlin bleiben zu können, wo er Bekanntschaft mit F. von Holbein und A. W. Iffland geschlossen und bei J. F. Reichardt Musikunterricht genommen hatte, erfüllte sich nicht; er wurde als Assessor an das Obergericht in Posen versetzt.
Die Posener Zeit hat H. als sein „merkwürdigstes Lebensjahr“ bezeichnet: „Ein Kampf|von Gefühlen, Vorsätzen pp, die sich geradezu wiedersprachen, tobte … in meinem innern – ich wollte mich betäuben, und wurde das was … Prediger, Onkels und Tanten liederlich nennen“. Außer dem Regierungsrat J. L. Schwarz gab es kaum eine „gute“ Gesellschaft für den Juristen, und für den Komponisten, dessen neues Singspiel nach Goethes „Scherz, List und Rache“ allerdings mehrfach aufgeführt wurde, gab es kaum ein Publikum. Mit frechen Karikaturen, die führende Vertreter der Posener Militär- und Zivilverwaltung attackierten, protestierte H. zugleich gegen die Enge und Kleinbürgerlichkeit der Stadt. Eine Strafversetzung nach Płock an der Weichsel war die Folge. Noch vor seiner Übersiedlung dorthin heiratete er. Seine berufliche Tätigkeit ließ ihm Zeit zur Ausübung seiner Künste: „Die Akten werden in die Nebenkammer geworfen, und dann zeichne, komponire und dichte ich wie's komt“. Neben weiteren Kompositionen (Singspiele, Messen, Sonaten) entstand hier die erste gedruckte literarische Arbeit, das „Schreiben eines Klostergeistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt“, in dem H. das Verhältnis von Deklamation und Gesang im Schauspiel behandelt. Vom ersten Erfolg beflügelt, beteiligte er sich an einem Preisausschreiben des „Freimüthigen“ für das beste Lustspiel. Sein Text, „Der Preis“ betitelt, erhielt zwar den Preis nicht, wurde aber lobend erwähnt. Trotzdem ist H. noch nicht auf dem Weg zur Literatur. „Ob ich wohl zum Maler oder zum Musiker geboren wurde“, fragt er sich im Tagebuch. Die Malerei allerdings tritt in den folgenden Jahren zurück. Zwar wird H. noch mehrfach, so in Warschau, Bamberg und Berlin, Räume malerisch ausgestalten und in Bamberg sogar als Theaterdekorationsmaler tätig sein, doch scheint die Entwicklung seiner schöpferischen Begabung im Wesentlichen bereits um diese Zeit abgeschlossen zu sein: Vom Historiengemälde ist er über die Porträtkunst zur Karikatur gekommen, in der er die seinem Beobachtungsvermögen, seiner Freude am überspitzt Treffenden und an der grotesken Übertreibung gemäße Kunstgattung fand. Auch die späteren Illustrationen eigener Werke tragen karikaturistische Züge. Daß er das Malerische (ebenso wie das Musikalische) seinem dichterischen Werk zunutze gemacht hat, belegen die Malerfiguren und Gemäldebeschreibungen, vor allem aber die erzählerischen Kompositionsprinzipien in „Callots Manier“, denen er, aller künstlerischen Weiterentwicklung unerachtet, bis zuletzt treu geblieben ist. H.s Wille zur Kunstproduktion war unbedingt: „es ist als müsse sich bald was großes ereignen – irgend ein KunstProdukt müsse aus dem Chaos hervorgehen! – Ob das nun ein Buch – eine Oper – ein Gemähide seyn wird – quod diis placebit“, schrieb er am Ende der Płocker Zeit, angeregt vom gesellig-künstlerischen Leben Königsbergs, das er vor seiner Versetzung als Rat nach Warschau noch einmal besucht hatte. Diese Unbedingtheit des Ausdruckswillens war Voraussetzung seiner spezifischen Leistung. In Warschau (1804–06) kam H. – eine weitere Voraussetzung seines künftigen Werkes – durch →Julius Eduard Hitzig in geistige und persönliche Verbindung zur Berliner Romantik. Hitzig regte ihn zur Lektüre der Werke A. W. Schlegels, Tiecks, Fichtes, Brentanos und anderer an; ihm verdankt H. den Anschluß an den Geist und den Bewußtseinsstand der Romantik. Daneben traten der Musiker F. A. Morgenroth und der Dichter Z. Werner in nähere Beziehung zu H., der in der neugegründeten „Musikalischen Gesellschaft“ das gesellige Leben der Stadt mitgestaltete. Als Dirigent der Konzerte dieser Gesellschaft brachte er Werke von Mozart, Gluck, Haydn, Cherubini und Beethoven zu Gehör. Im „Deutschen Theater“ erklang seine Bühnenmusik zu Brentanos „Die lustigen Musikanten“, auch die Messe in d-moll wurde aufgeführt. Unter den weiteren Kompositionen sind die Sinfonie in Es-Dur und die Bühnenmusik zu Z. Werners „Das Kreuz an der Ostsee“ hervorzuheben. Eine musikalische Karriere also schien sich anzubahnen, und da H. auch häusliches Glück (seine Tochter Caecilia wurde im Juli 1805 geboren) und berufliche Anerkennung erfuhr, kann man von einer glücklichen Zeit sprechen, die er in Warschau erlebte. Sie fand ein jähes Ende mit der Besetzung der Stadt durch französische Truppen. Die preußische Verwaltung wurde aufgelöst, H. verlor seine Stellung. Im Juni 1807, vor die Wahl gestellt, eine Huldigung →Napoleons zu unterschreiben oder die Stadt zu verlassen, ging er nach Berlin, um dort einen Lebensunterhalt zu finden; seine Familie blieb in Posen. Es sollte das schwerste Jahr seines Lebens werden. Die Stellungssuche erwies sich als aussichtslos, Gelegenheitsarbeiten trugen nichts ein; zu der drückenden Not kam die Nachricht vom Tode seiner Tochter und einer schweren Erkrankung seiner Frau. Die Berliner Bekanntschaften – unter anderem mit Fichte, Schleiermacher, K. F. Zelter, Varnhagen, L. Robert, Chamisso und Iffland – führten zu keiner Hilfe, und seine Kontaktversuche mit auswärtigen Musikverlegern schlugen fehl. Endlich meldete sich auf eine Annonce der Intendant des Bamberger Theaters, Julius Graf von Soden, und bot ihm zum September 1808 die Stelle eines Theaterkapellmeisters an. Damit vollzog H. den Schritt vom Beamten- zum Künstlerleben. Die Bamberger Jahre bringen ihm den Durchbruch zur Dichtung. Gerade weil er die Kunst zur alleinigen Existenzgrundlage machen mußte, konnte er seine erstaunlich konsequente Entwicklung vom Musiker über den Musikkritiker zum Dichter nehmen.
Über Posen, wo er seine Frau abholte, reiste H. nach Bamberg. Die Theaterverhältnisse fand er dort in ziemlicher Unordnung vor. Nur kurzfristig war er als Dirigent und Theaterkomponist für das Theater tätig, das der Schauspieler H. Cuno übernommen hatte. Erst 1810–12, unter der Theaterleitung F. von Holbeins, arbeitete er wieder als Komponist, Theatermaler und -architekt. So war er von vornherein auf eine freiberufliche Tätigkeit (Musikstunden, Musikalienhandel) angewiesen. Durch seine erste musikalische Erzählung „Ritter Gluck“ (1808/09), in der die Erkenntnis des Reiches der Musik über alles Geheimnisvolle triumphiert, kam er in Verbindung mit der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ (AMZ), deren ständiger Mitarbeiter er wurde; schon bald zog man ihn als Rezensenten der Beethovenschen Sinfonien heran. Als Musikkritiker hat H. epochemachend gewirkt. Seine Bedeutung liegt in der Verbindung praktischer Kenntnisse mit romantischen Kunstanschauungen; von der Beschreibung technischer Details führt er bruchlos zu den allgemeinsten Problemen der Tonkunst, oder er geht von Gattungsfragen aus und ordnet das jeweilige Werk souverän ein; dabei gelingt ihm, ohne Verzicht auf die notwendige Fachterminologie und analytische Verfahrensweise, eine plastische und bilderreiche Sprache, die auch dem Laien verständlich ist und ihm tiefe Einsichten in das Wesen der Musik eröffnet. Neben Gluck, Mozart und Haydn, deren Werk H. vorbildlich erscheint, befürwortet er als einer der ersten Beethoven, ist an der Wiederentdeckung Bachs beteiligt und führt die Diskussion der Kirchenmusik-Probleme weiter. Sein musikkritisches Werk, das späteren Generationen vorbildlich wurde, läßt sich in zwei Gruppen gliedern: 1. Rezensionen musikalischer Werke (1808–14), 2. Berichte über Opern- und Konzertaufführungen (nach 1814). Neben dem „Ritter Gluck“ erschienen in der AMZ die Erzählungen „Don Juan“, „Die Automate“ sowie mehrere Bemerkungen und Gedanken der Figur des Kapellmeisters Johannes Kreisler, die H. als alter ego lebenslang begleitete. Das Musikalische vertritt im Werk H.s die Sehnsucht nach dem „romantischen Reich“, das unerreichbar bleibt, aber als Kontrast zu dem Profanen eine der Spannungen konstituiert, ohne die sein Werk undenkbar wäre. In H.s Musikschülerin Julia Mark, zu der er eine leidenschaftliche Zuneigung faßte, hat man, in Anlehnung an romantische Vorbilder (Novalis), den seine Dichtung auslösenden Faktor sehen wollen; gewiß zu Unrecht. H. war bereits der Dichter, zu dem Julia ihn angeblich gemacht hat, als er ihr begegnete; er hat nicht aus dem Erlebnis Dichtungen geschaffen, sondern er hat dieses Erlebnis selbst bereits „literarisiert“ und dichterisch produziert. Im Werk H.s wird das Julia-Motiv zum permanenten Demonstrationsmodell der „Liebe des Künstlers“. Eine wesentliche Bereicherung erfuhr H. durch den freundschaftlichen Umgang mit den Bamberger Ärzten F. Speyer, A. F. Marcus, Weiß und Chr. Pfeufer, die fachlich zu den fortschrittlichsten Medizinern Deutschlands gehörten und an den lebhaften wissenschaftlichen Diskussionen der Zeit über Geisteskrankheiten und ihre Heilmethoden Anteil nahmen. Sie konfrontierten H. mit Geisteskranken und Somnambulen, erläuterten ihm Probleme der Pathologie, Psychologie und des Magnetismus und berieten ihn offensichtlich beim Studium der diesbezüglichen Literatur, das er intensiv betrieb; so las er unter anderem Werke von J. Ch. Reil, G. H. Schubert, J. Ch. Hoffbauer, Ph. Pinel, E. D. A. Bartels, C. A. F. Kluge, F. A. Mesmer. Die Traum-, Spuk-, Wahnsinns- und Gespensterdarstellungen in seinen späteren Erzählungen beruhen auf genauester theoretischer und praktischer Kenntnis der entsprechenden Phänomene. Mit literarischen Werken von Goethe, A. W. Schlegel, Novalis, →Schelling, Tieck, →Jean Paul, H. von Kleist, A. von Arnim, Calderon und anderen versorgte ihn der Weinhändler C. F. Kunz, der ihm auch die persönliche Bekanntschaft mit F. G. Wetzel und →Jean Paul vermittelte. 1813 schloß Kunz, der inzwischen ein „Lese-Institut“ eröffnet hatte, einen Verlagsvertrag mit H. über die „Fantasiestücke in Callots Manier“.
Als Komponist schrieb H. in Bamberg vorwiegend Bühnenmusik zu Fest- und Schauspielen sowie Vokalwerke; von größerer Bedeutung sind das Miserere in b-moll für 4 Solostimmen, Chor, Orgel und Orchester und das Klaviertrio in E-dur sowie die Oper „Aurora“ (Text von F. von Holbein), die als Vorstufe zur „Undine“ gilt und H.s Lösung von seinen bisherigen Vorbildern dokumentiert. Bis auf den späten Höhepunkt der „Undine“, deren Anfänge allerdings ebenfalls in die Bamberger Zeit fallen, liegt damit das musikalische Werk H.s in seinen wesentlichen Teilen vor; zwar beschäftigten ihn noch manche musikalischen Pläne, auch wünschte noch der Dichter der „Fantasiestücke“, daß „mein Nahme nicht anders als durch eine gelungene musikalische Composition der Welt bekannt werden soll“; trotzdem ist bereits um diese Zeit seine musikgeschichtliche Bedeutung erfüllt: H. hat als Komponist und als Musiktheoretiker maßgeblichen Anteil an der Durchsetzung des romantischen Stils. Auffallend, aber nicht genügend beachtet ist die Parallelität seiner Entwicklung in allen von ihm ausgeübten Künsten: Dem Weg zur Karikatur in der Malerei entspricht derjenige zur Kritik in der Musik und derjenige zur Satire und Gesellschaftskritik in der Literatur. Dabei führte ihn dieser Weg zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zuständen, die er als rückständig erkannte. Dieser Auseinandersetzung ist er auch als Jurist nicht ausgewichen. Ihn zum „Prototyp des unpolitischen Menschen“ (W. Harich) zu stempeln, ist verfehlt. In Bamberg verfolgte er gespannt die politischen „Nachrichten, die in das Leben eingehen“; vollends aber wurde er mitten in das Kriegsgeschehen versetzt, als er Bamberg im April 1813 verließ, um Musikdirektor der Theatertruppe J. Secondas in Dresden und Leipzig zu werden. Die Schlacht bei Dresden erlebte er aus unmittelbarer Nähe; seine Eindrücke beschrieb er in mehreren Arbeiten, vor allem in der „Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden“, die Kunz als nichtautorisiertes Flugblatt druckte. H. vertrat, politisch gesehen, die Sache der Befreiungskriege gegen den „Tyrann“ →Napoleon; in grellen Farben schilderte er das Kriegsgeschehen und seine schrecklichen Folgen. Stärker aber noch beschäftigte ihn ein für Kunst und Leben gleichermaßen existentielles Problem: Die Kunst hat angesichts solcher Ereignisse ihre Berechtigung zu erweisen, wenn sie überhaupt eine Berechtigung hat. Diese These wird in der mitten in den Kriegswirren entstandenen Dialogerzählung „Der Dichter und der Componist“ entwickelt. Das reiche poetische Schaffen H.s in der Dresdener und Leipziger Zeit – hier entstanden unter anderem „Der goldne Topf“, „Der Magnetiseur“, „Die Automate“ und der 1. Band der „Elixiere des Teufels“ – ist als Reaktion des „inneren Poeten“ auf die kriegerische Wirklichkeit zu verstehen; dieser „innere Poet überflügelt den Criticus und äußeren Bildner“, heißt es in H.s Tagebuch. Trotzdem war auch der Komponist und der Maler – H. beendete in Leipzig die Komposition der „Undine“ und zeichnete antinapoleonische Karikaturen – noch tätig. Mit seinem Beruf dagegen war er unzufrieden; die Fähigkeiten seiner Musiker waren begrenzt, die Proben mühsam; die Zusammenarbeit mit dem unbeherrschten Seconda erwies sich als schwierig. H. fühlte sich zudem, trotz mancher Bekanntschaften (F. A. Morgenroth, A. Wagner, F. Keller, F. Laun, J. Ettlinger) „ohne Mittheilung, ohne Freunde“, so daß er, als ihm Seconda im Februar 1814 kündigte, nach anfänglicher Niedergeschlagenheit („meine ganze Karriere ändert sich abermals“) entschlossen in den bürgerlichen Beruf zurückstrebte.
In der poetisch ertragreichen Zeit bis zur Wiedereinstellung in den Staatsdienst schrieb H. den 1. Teil der „Elixiere des Teufels“, jene verworrene Familiengeschichte, die ihn, als sie 1815 erschien, zusammen mit den „Fantasiestücken“ weithin bekannt machte. In der Figur des beichtenden Medardus, der durch die Niederschrift seiner Lebensgeschichte die Entschuldigung seiner Schuld erfährt, gestaltete H. autobiographische Probleme in neuer, nicht „privater“ Weise. Medardus ist das Exempel einer Verfahrensweise, nicht das Abbild einer Wirklichkeit. Im Frühjahr 1814 erschienen auch die ersten Bände der „Fantasiestücke in Callots Manier“, die, mit einer etwas gewundenen Einleitung Jean Pauls versehen, im Wesentlichen H.s Beiträge zur AMZ enthielten. Neu war im 1. Band die Skizze „Jaques Callot“, in der H. programmatisch „Callots Manier“ als ein Kompositionsprinzip erläutert, in dem „das Einzelne als Einzelnes für sich bestehend, doch dem Ganzen sich anreiht“, so daß die Erzählungen zu „aus den heterogensten Elementen geschaffenen Kompositionen“ werden. Der 2. Band enthielt neben der Erzählung „Der Magnetiseur“ die „Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza“, in der H. in ironischer Konfrontation des menschlichen Tieres mit dem unmenschlichen Menschen Ereignisse der Bamberger Zeit verarbeitete. Als 3. Band erschien im Herbst 1814 das von H. zeitlebens am höchsten geschätzte Märchen „Der goldne Topf“. Die „Seligkeit“, die dem Studenten Anselmus hier vom Dichter zuteil wird, ist die der poetischen Figur. In ihr allein ist der „heilige Einklang aller Wesen“ noch möglich. Der Poesie fällt also die Funktion zu, das Heterogene zu vereinen, das als solches jedoch zuvor erkannt werden muß. Wo Wirklichkeit und Phantasie als unaufhebbare Kontraste nicht erkannt werden, ist jeder Weg zur Einheit verbaut. Davon ist in der Erzählung „Die Abenteuer der Silvester-Nacht“ im 4. Band (1815) eindringlich die Rede.
Durch die Vermittlung Hippels gelang es H., nach 8jähriger Unterbrechung wieder in den Staatsdienst einzutreten: Zum 1.10.1814 wurde er am Kammergericht zu Berlin, zunächst in untergeordneter Position, eingestellt. Damit beginnt der letzte und kontinuierlichste Abschnitt seines Lebens. Die juristische Arbeit, die er mit Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit und mit großem persönlichem Mut ausübte, gab ihm mehr als nur das bürgerliche Rückgrat einer künstlerischen Existenz. Sie war vielmehr eine Seite der von ihm als notwendig empfundenen „Duplizität“ des Seins und ist deshalb auch für sein künstlerisches Werk wichtig, das in den Berliner Jahren konsequent weitergeführt wurde. Noch vor seinem Dienstantritt vollendete H. die Komposition der Oper „Undine“, die als erste romantische Oper gilt. Sie wurde am 3.8.1816 im Königlichen Schauspielhaus am Gendarmenmarkt mit großem Erfolg uraufgeführt. C. M. von Weber, auf dessen „Freischütz“ H. vorausweist, rühmte das Werk enthusiastisch, das bis zum Brand des Schauspielhauses am 17.7.1817, dem auch die wertvollen Dekorationen K. F. Schinkels zum Opfer fielen, 14mal gegeben wurde; eine geplante Neuinszenierung indes unterblieb. In Berlin gehörte H. als arrivierter Autor und erfolgreicher Komponist bald „zur Gesellschaft“; doch die Atmosphäre im Kaffeehaus Manderlee oder im Weinlokal Lutter und Wegner sagte H. mehr zu als die üblichen „ästhetischen Thees“. Seit dem 12.10.1814 (Seraphinustag) trafen sich die Freunde H., Hitzig, der Arzt D. F. Koreff, die Brüder F. und E. von Pfuel, G. Seegemund, Contessa, Fouqué und Chamisso als „Seraphinenorden“ zu regelmäßigen poetischgeselligen Gesprächsabenden, die, von Chamissos Weltreise unterbrochen, am 14.11.1818 (Serapionstag) in etwas anderer Zusammensetzung wiederauflebten. Die Rahmenhandlung der Sammlung „Die Serapions-Brüder“ überträgt biographische Gegebenheiten in poetische und poetologische Prinzipien. Als Gäste fanden sich gelegentlich ein: Hippel, L. Robert, A. Oetzel, Oehlenschläger, W. von Haxthausen. Neben diese trat als Freund und Zechgenosse H.s der Schauspieler L. Devrient, dessen phantasievolles Temperament ihm in besonderer Weise entsprach. Auch mit Bernhardi und Tieck verkehrte H. freundschaftlich. In den Jahren 1816/17 erschienen außer dem 2. Band der „Elixiere des Teufels“ 8 neue Erzählungen als „Nachtstücke“; bedrohliche, dunkle Mächte und bedrohte Existenzen, Exempel extremer seelisch-geistiger Positionen, stehen hier im Zentrum. Das Grauenvolle, Gespenstische und Unheimliche demonstriert Gefährdungen, denen der Mensch ausgesetzt ist. Vor allem die Gespenstergeschichte „Das Majorat“ zeigt mit ihrer äußeren Gestalt wie mit der Durchführung der Thematik des Gespenstischen den Zusammenhang des Unerkannten in der Kunst mit dem Unmenschlichen im menschlichen Leben. Ruhm und Ruf H.s, aber auch seine Einnahmen als Schriftsteller stiegen schnell; seine begehrten und guthonorierten Beiträge zu den gängigen Almanachen und Taschenbüchern vereinigte er 1819/21 zu der 4bändigen Erzählungssammlung „Die Serapions-Brüder“; das in der Rahmenhandlung entwickelte „serapiontische Prinzip“ fordert von einer Erzählung erlebte Wirklichkeit, erzählerische Kunstform und gesellig-gesellschaftliche Verbindlichkeit. Die Figur des heiligen Serapion, des unbewußten Poeten, ist Gegenstand der Kritik, nicht uneingeschränktes Vorbild der Serapions-Brüder; und dementsprechend ist das Wunderbare, Märchenhafte und Schauerliche in den Erzählungen kein exemplarisches Programm, sondern Bestandteil einer exzentrischen Welt, die im Profanen, in der Spießbürgerlichkeit und Plattheit ihren Gegenpol hat. In solchen „Kontrastierungen“ ist das zyklische Prinzip der „Serapions-Brüder“ zu sehen; dem „reinen“ Märchen „Nußknacker und Mausekönig“ stehen die durch Groteske und Gesellschaftskritik desillusionierenden Märchen „Das fremde Kind“ und „Die Königsbraut“ gegenüber. H.s Kritik geht in beide Richtungen: Sie betrifft den Künstler, der nur Künstler ist, ebenso wie den Bürger. Der Konflikt zwischen den Extrempositionen wird in den Figuren der Erzählungen ausgetragen: der Rat Krespel und Elis Fröbom („Die Bergwerke zu Falun“) gehen an diesem Konflikt, der nur durch Selbsterkenntnis lösbar ist, zugrunde. Die Pflicht zu solcher Selbsterkenntnis ist allen Figuren aufgetragen, und den Weg dahin beschreibt und fördert der Dichter. Traugott („Die Automate“) gelingt diese Leistung; sie gelingt auch dem Fräulein von Scuderi in H.s Kriminal- beziehungsweise Detektivgeschichte, wobei ihre Selbst- und Kunsterkenntnis menschliche Verbindlichkeit erreicht gegenüber der unmenschlichen Künstlerfigur des Cardillac. Der „Zusammenhang der Dinge“ ist, wie gerade diese meisterhafte Erzählung zeigt, keine falsche Harmonisierung der Dinge. Das bestätigen auch die an alten Chroniken orientierten Erzählungen („Kampf der Sänger“, „Meister Martin der Küfner und seine Gesellen“), in denen die „Gemütlichkeit“ des Idyllischen relativiert wird. Der kritische Impuls, der in solcher allseitigen Relativierung steckt, führt zu immer kühneren Gestaltungen des Dualismus und entsprechend zu einer immer grundsätzlicheren Infragestellung der Möglichkeit einer Integration der Teile. Dieser kritische Impuls greift zunehmend auf die Bereiche der bürgerlichen Welt, der Wissenschaften und der Justiz über und macht sie zu Gegenständen der Satire („Klein Zaches genannt Zinnober“, 1819). Aus den satirischen Zügen im Spätwerk H.s hat man unter Hinweis auf die erneute Forderung, genau hinzusehen („Des Vetters Eckfenster“), den Realisten H. konstruieren wollen; doch darf der Zusammenhang mit „Callots Manier“ und dem „serapiontischen Prinzip“ nicht übersehen werden. Satire und Gesellschaftskritik sind auch im Spätwerk H.s nicht isoliert zu betrachten; sie schaffen stärkere Kontraste und bezeichnen damit die Vereinigung des einander scheinbar Ausschließenden als ein noch dringenderes Postulat. Von daher ist die so sichtbar „zerrissene“ Form des parodierten Bildungsromans „Lebens-Ansichten des Katers Murr.,“ (1820/21) zu verstehen, dessen Fragmentcharakter selbst noch Verweisungsfunktion hat. Die „Teile“ dieses Romans (der „Kater-Teil“ und der „Kreisler-Teil“) sind konkret gewordene Ironie; denn die Ironie ist das Darstellungsmittel H.s, das die heterogenen Teile als solche sichtbar macht, während das Erzählprinzip des Humors, zu dem H. mehr und mehr gelangt, sie vereint. Dieses Erzählprinzip will erkannt sein, so daß die Erkenntnisleistung, die H. in seinen früheren Erzählungen noch als Leistung der Figuren demonstriert hatte, nun dem Leser abgefordert wird. Daß dies keine leichte Forderung an den Leser ist, zeigen die Mißverständnisse, denen H.s sinnverwirrendes, aber am weitesten in erzählerisches Neuland vorstoßendes Capriccio „Prinzessin Brambilla“ (1820) und das Märchen „Meister Floh“ ausgesetzt waren, das die Möglichkeit der Erkenntnis in geradezu jeder Hinsicht in Frage stellt.
Mit dem „Meister Floh“ und der damit verbundenen Affäre treten am Ende seines Lebens in fast symbolischer Weise noch einmal der Künstler und der Jurist H. gemeinsam ins Blickfeld. Als Jurist hatte er es nach anfänglichen Hilfsdiensten in Berlin mit Kriminalfällen zu tun. Am 1.10.1819 wurde er Mitglied der „Immediatkommission zur Ermittlung hochverräterischer Verbindungen und anderer gefährlicher Umtriebe“. Hartnäckig und mutig widersetzte er sich mit seinen Kollegen allen Versuchen, die Kommission zu einem politischen Instrument gegen die liberalen und revolutionären Bestrebungen der Zeit zu machen. Das zeigen die überlieferten Gutachten H.s innerhalb der Untersuchungen gegen A. L. Follen, G. L. Roediger, F. L. Jahn und L. von Mühlenfels; H. wies die gegen sie vorgebrachten Anklagen zurück und votierte für die Freilassung der Inhaftierten. Im Rahmen dieser „Demagogen“-Aktionen stieß er mit dem Polizeidirektor K. A. von Kamptz zusammen, dem er unrechtmäßige Eingriffe in einen Untersuchungsvorgang vorwarf. Kamptz seinerseits leitete im Januar 1822, nachdem H. zu seiner Erleichterung bereits aus der Kommission ausgeschieden und in den Oberappellationssenat aufgerückt war, eine Aktion gegen das im Druck befindliche Märchen „Meister Floh“ ein, mit dem Ziel, den Verdacht der gebrochenen Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, der Beamtenverleumdung und der Majestätsbeleidigung bestätigt zu sehen. Nach Beschlagnahme des Manuskripts sah Kamptz, der im Märchen als Knarrpanti karikiert wird, seine Vorwürfe als berechtigt an. Der „Meister Floh“ konnte daher nur in zensurierter Form erscheinen. H., wegen seiner letzten schweren Krankheit nicht vernehmungsfähig, verfaßte eine Verteidigungsschrift, die zu den bedeutendsten poetologischen Äußerungen des Dichters gehört; er betont darin abermals die Notwendigkeit einer Integration der Teile zu einem Ganzen und führt damit die Problematik der Heterogenität der Teile einerseits und des „Zusammenhangs der Dinge“ andererseits fort. Die Erkenntnis des unheilbar Disparaten war ihm bis zuletzt Voraussetzung und Antrieb zur künstlerischen Arbeit. Sein Werk stellt nicht eine heile Welt dar, aber indem es dem künstlerischen Prinzip der Integration des Heterogenen folgt und dieses Prinzip selbst zum Gegenstand des Erkennens seiner Leser macht, gewährt es einen Blick in das verlorene Paradies. Die „Meister-Floh“-Affäre blieb unerledigt. H., der seit Januar 1822 an einer Lähmung litt, die von den Beinen zu den Armen aufstieg, starb, als die Lähmung auf sein Atemzentrum übergriff.
-
Werke
Weitere W Verz. d. Erstdrucke b. G. Salomon u. Goedeke, s. L. - Ausgg.: Auserlesene Erzz., Novellen, Mährchen u. Phantasiestücke, 9 Bde., 1825 (unrechtmäßiger Druck);
Ausgew. Schrr., 10 Bde., 1827;
Erzählende Schrr., hrsg. v. M. Hoffmann, 18 Bde., 1831;
Ges. Schrr., 1844 (mit Federzeichnungen v. Th. Hosemann);
Meister Floh, z. 1. Mal vollst. hrsg. v. Hans v. Müller, 1908;
Sämtl. Werke, hist.-krit., hrsg. v. C. G. v. Maassen, 1908-28 (unvollendet);
E. T. A. H. im persönl. u. briefl. Verkehr, Sein Briefwechsel u. d. Erinnerungen s. Bekannten, ges. u. erl. v. H. v. Müller, 2 Bde., 1912 (P in II, d. geplante 3. Bd. erschien nicht);
Werke, hrsg. v. G. Ellinger, 15|Bde., 1912, ²1927 (P in I u. XI);
Tagebücher u. lit. Entwürfe I, hrsg. v. H. v. Müller, 1915 (d. geplante 2. Bd. erschien nicht);
Musikal. Werke, hrsg. v. G. Becking, 1922-27 (unvollendet);
Dichtungen u. Schrr. sowie Briefe u. Tagebücher, Gesamtausg., hrsg. v. W. Harich, 15 Bde., 1924;
Handzeichnungen, hrsg. v. W. Steffen u. H. v. Müller, 1925;
Poet. Werke, hrsg. v. K. Kanzog, 12 Bde., 1957-62 (mit Federzeichnungen v. W. Wellenstein);
Poet. Werke, eingel. v. Hans Mayer, Anm. v. G. Seidel, 6 Bde., 1958-63;
Sämtl. Werke, unter Mitarb. v. W. Müller-Seidel, F. Schnapp, W. Kron u. W. Segebrecht, 5 Bde., 1960-65;
Briefwechsel, hrsg. v. F. Schnapp, 3 Bde., 1967-69 (P in II);
Tagebücher, hrsg. v. dems., 1971. -
Literatur
ADB XII;
- Bibliogr.: G. Salomon, E. T. A. H. Bibliogr., 1924, ²
1927, Neudr. 1963 (bis 1871);
Goedeke VIII, S. 468-506 (bis 1904), XIV, S. 352-480 (bis 1955);
v. K. Kanzog in 3j. Turnus seit 1962 in: Mitt. d. E. T. A. H.-Ges.;
J. Voerster, 160 J. E. T. A. H.-Forschung 1805-1965, 1967;
- L. Köhn, Vieldeutige Welt, Stud. z. Struktur d. Erzz. E. T. A. H.s u. z. Entwicklung s. Werkes, 1966;
Th. Cramer, Das Groteske bei E. T. A. H., 1966;
C. F. Köpp, Realismus in E. T. A. H.s Erz. Prn. Brambilla, in: Weimarer Btrr. 12, 1966;
V. Terras, E. T. A. H.s polyphon. Erzählkunst, in: German Quarterly 39, 1966;
K. M. Cramer, Die Fragwürdigkeit d. menschl. Identität, E. T. A. H.s Die Elixiere d. Teufels, Diss. Tulane Univ. 1966;
P. Schau, Klein Zaches u. d. Märchenkunst E. T. A. H.s, Diss. Freiburg i. B. 1966;
J. M. McGlathery, The suicide motiv in E. T. A. H.s Der goldne Topf, in: Monatshefte 58, Wisconsin 1966;
U. D. Lawson, Pathological time in E. T. A. H.s Der Sandmann, ebd. 60, 1968;
R. Mühlher, E. T. A. H. u. d. Kunstleben s. Epoche, in: Jb. d. Wiener Gocthe-Ver. 70, 1966;
ders., Gedanken zum Humor bei E. T. A. H., in: Festgabe f. F. Weinhandl, 1967;
K. L. Schneider, Künstlerliebe u. Philistertum im Werk E. T. A. H.s. in: Die dt. Romantik, hrsg. v. H. Steffen, 1967;
W. Segebrecht, Autobiogr. u. Dichtung, Eine Studie z. Werk E. T. A. H.s, 1967;
ders., E. T. A. H.s Auffassung v. Richteramt u. v. Dichterberuf, in: Jb. d. dt. Schillerges. 11, 1967;
ders., E. T. A. H., in: Dt. Dichter d. Romantik, hrsg. v. B. v. Wiese, 1971;
H. R. Frank, E. T. A. H.s Todeskrankheit, in: Dt. Ärztebl. 64, 1967, Nr. 12-14;
V. Sander, Realität u. Bewußtsein bei E. T. A. H., in: Studies in Germanic languages and literature, 1967;
J. A. Lange, The Levels of Suspense in E. T. A. H.s Elixiere d. Teufels, Diss. Univ. of Wisconsin 1967;
J. Nettesheim, E. T. A. H.s Phantasiestück Der Magnetiseur, e. Btr. z. Problem „Wissenschaft“ u. Dichtung, in: Jb. d. Wiener Goethe-Ver. 71, 1967;
H. S. Daemmrich, Zu E. T. A. H.s Bestimmung ästhet. Fragen, in: Weimarer Btrr. 14, 1968;
ders., E. T. A. H.s Tragic Heroes, in: German Quarterly 45, 1970;
G. Wittkop-Ménardeau (Hrsg.), E. T. A. H.s Leben u. Werk in Daten u. Bildern, 1968;
E. Rotermund, Musikal. u. dichter. „Arabeske“ bei E. T. A. H., in: Poetica 2, 1968;
Ch. Karoli, Ritter Gluck, H.s erstes Fantasiestück, in: Mitt. d. E. T. A. H.-Ges. 14, 1968;
B. v. Wiese, E. T. A. H.s Doppelroman Kater Murr, Die Phantasie d. Humors, in: ders., Von Lessing bis Grabbe, Stud. z. dt. Klassik u. Romantik, 1968;
B. Pikulik, Anselmus in d. Flasche, Kontrast u. Illusion in E. T. A. H.s Der goldne Topf, in: Euphorion 63, 1969;
J. M. Ellis, E. T. A. H.s Das Fräulein v. Scuderi, in: Modern Language Review 64, 1969;
R. S. Rosen, E. T. A. H.s Kater Murr, Aufbauformen u. Erzählsituationen, 1970;
W. Nehring, Die Gebärdensprache E. T. A. H.s, in: Zs. f. dt. Philol. 89, 1970;
U. Späth, Gebrochene Identität, Stilist. Unterss. z. Parallelismus in E. T. A. H.s Lebens-Ansichten d. Katers Murr, 1970;
L. B. Jennings, Klein Zaches and his Kin, in: Dt. Vjschr. 44, 1970;
MGG VI (W, L, P, Abb.). Eppelsheimer I-IX. -
Porträts
Bleistiftzeichnung v. W. Hensel, 1821 (Berlin-Charlottenburg, Nat.-Gal.), einziges P v. fremder Hand, Abb. in: E. A. T. H. im persönl. u. briefl. Verkehr II, s. W, u. in: H.s Briefwechsel II, 1968, danach Stich v. J. Passini, Abb. in: Feierstunden, hrsg. v. F. v. Biedenfeld u. Ch. Kuffner, 1822 (seither vielfach reproduziert); zahlr. Selbstporträts, vielfach reproduziert, u. a. Bleistiftzeichnung mit scherzhaften physiognom. Erklärungen, 1815 (?) (1943 verbrannt), danach beschönigender Stich ohne d. physiognom. Erklärungen v. F. C. Rupprecht f. H.s „Fantasiestücke“, ²
1819, u. Radierung v. J. B. Sonderland, Abb. in: H.s Briefwechsel II, 1968. -
Autor/in
Wulf Segebrecht -
Zitierweise
Wulf, Segebrecht, "Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm (statt Wilhelm seit 1804 Amadeus aus Verehrung für Mozart, E. T. A.)" in: Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 407-414 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118552465.html#ndbcontent
-
Hoffmann, Ernst
-
Biographie
Hoffmann: Ernst Theodor Wilhelm H., der sich selbst in nacheifernder Verehrung Mozart's E. T. Amadeus nannte, mit gleichmäßig reichen Anlagen für Poesie, Musik und Malerei ausgestattet, wurde am 24. Januar 1776 zu Königsberg in Preußen geboren. Sein Vater, der 1782 als Criminalrath und Justizcommissär an das Oberlandesgericht in Insterburg kam († 1796 oder 97), ein Mann von vielem Geist, aber von unordentlichen Neigungen, trennte sich schon im dritten Lebensjahre des Sohnes von seiner durch strengere Grundsätze geleiteten Gattin. H. blieb bei der Mutter, die, von Kummer gebeugt, ihr krankhaftes Dasein am 15. März 1796 endigte; auf seine Erziehung hatte neben ihr besonders ihre Schwester († 1803, als „Tante Füßchen“ im ersten Bande des „Kater Murr“ verewigt), ihr Oheim, der im October 1795 gestorbene Justizrath Vöthöry, dem H. im „Majorat“ (in den „Nachtstücken") ein Denkmal setzte, und ihr Bruder, der Justizrath Otto Dörffert († 1811), Einfluß. Während die Tante und der Großonkel dem ungewöhnlichen Geiste des Kindes volles|Verständniß und treueste Liebe entgegenbrachten, hielt ihn der an die größte Regelmäßigkeit und äußere Schicklichkeit gewöhnte Oheim zu Ordnung und Fleiß an. Er übernahm seinen ersten Unterricht und brachte ihm die Anfangsgründe der Musik bei; seine weitere Ausbildung hierin wurde dem Componisten und Organisten Podbielsky übertragen. Frühzeitig wurde der lebhafte Knabe, der sich daheim in der Entfaltung seines Naturells fast immer gebunden fühlte, der deutsch-reformirten gelehrten Schule übergeben, unter deren ausgezeichnetem Rector, dem Prediger Dr. Stephan Wannowski, er anfangs langsam, später, als im innigsten Verkehr mit seinem gleichaltrigen, lebenslänglichen Freunde Theodor Gottlieb v. Hippel († 1843, s. o. S. 466), sein Sinn für die Klassiker erwachte, auffallend rasch fortschritt. Schon früher hatte sich sein musikalisches und malerisches Talent geregt, letzteres von einem entschiedenen Hang, Caricaturen zu zeichnen, begleitet. Am 27. März 1792 wurde H. an der Universität Königsberg immatriculirt. Von den berühmten Lehrern der Hochschule trat keiner dem Jüngling näher, der ohne innere Neigung, aber mit gewissenhaftem Fleiße Jurisprudenz studirte. Nachdem er am 22. Juli 1795 die erste Prüfung bestanden hatte, arbeitete er als Auscultator bei der Regierung seiner Vaterstadt. Bei der Menge gleichstrebender junger Leute fand er weniger zu thun, als er wünschte; so konnte er sich ganz der Kunst hingeben. Er malte Porträte für den Freund, der Königsberg nunmehr verlassen hatte, studirte mit freudigem Eifer die Meisterwerke der Musik, namentlich Mozart's Don Juan, den er zeitlebens aufs höchste bewunderte und 1813 in der allgemeinen musikalischen Zeitung in einem tief greifenden Aufsatz geistreich interpretirte, und versuchte sich in eigenen Compositionen sowie in schriftstellerischen Arbeiten. Kaum hatte er 1795 einen dreibändigen Roman „Cornaro“ vollendet, für den er, weil noch namenlos, keinen Verleger fand, als er einen zweiten ("Der Geheimnißvolle") begann. Eine heftige, von der Freundin erwiderte, durch äußere Verhältnisse aber hoffnungslose Liebesleidenschaft verzehrte ihn auch noch, als er sich ihrem unmittelbaren lähmenden Einfluß auf sein Denken und Thun durch die Entfernung entzogen hatte. Am 15. Juni 1796 traf er in Groß-Glogau ein, um bei der dortigen Oberamtsregierung, wo sein zweiter Oheim († in Berlin im September 1803) als Rath angestellt war, seine Laufbahn fortzusetzen. Der Eifer, mit dem er sich seinem Berufe hingab, setzte ihn in den Stand, im Juni 1798 sein zweites Examen zu machen; aber auch für sein Studium der Künste fand er hier manche Anregung. Gleichwol wirkte die Erinnerung an das, was er in Königsberg verlassen, neu geweckt durch eine Reise dorthin im Frühjahr 1797, zu schmerzlich, als daß ihm nicht Glogau unerträglich hätte scheinen sollen, obwol sich hier schon das Verhältniß zu Maria Thekla Michaelina Rorer, die im Frühling 1802 seine Gattin wurde, anknüpfte. Gern folgte er darum, eben noch durch eine Reise in das schlesische Gebirge und nach Dresden heiterer gestimmt, dem Oheim, welcher zum geheimen Obertribunalsrath ernannt worden war, im August 1798 nach Berlin als Referendar beim Kammergericht. In dem Genuß, den die Kunstausstellungen und Musikaufführungen der Hauptstadt reichlich boten, begann für H. ein neues Dasein des hoffnungsfreudigsten Strebens. Mit frischer Liebe gab er sich auch der juristischen Thätigkeit hin, so daß er sich im Sommer 1799 dem letzten, „rigorosen“ Examen mit dem besten Erfolg unterziehen konnte. Schon am 27. März 1800 wurde er zum Assessor der Regierung in Posen mit uneingeschränkter Stimme ernannt. Die kecke Ausgelassenheit des dortigen Lebens, durch ihre Neuheit für H. doppelt verführerisch, riß ihn zu Ausschweifungen und übermüthig-tollen Einfällen hin, die nicht ohne bittere Folgen blieben. Eine Verspottung des Generals v. Zastrow und anderer hochstehender Personen durch caricaturenhafte Zeichnungen gab Anlaß, den zum|Rath in Posen Designirten im Frühling 1802 als Regierungsrath nach dem einsamen Plock im damaligen Neuostpreußen zu versetzen. Hier sammelte er sich bald im eben begründeten eigenen Familienleben zu ernster, juristischer und künstlerischer Arbeit jeder Art. Der Musik widmete er sich zumeist. Schon in Posen hatte er Goethe's Singspiel „Scherz, List und Rache" componirt und mit Beifall auf die Bühne gebracht; jetzt folgten mehrere Messen und Vespern für Klöster, eine Phantasie und verschiedene Sonaten für das Clavier. Er entwarf (seit dem August 1803) Grundzüge zu einem Aufsatz über Sonaten, übersetzte italienische Canzonetten, begann zwei Singspiele ("Der Renegat" und „Faustine") zu dichten und bewarb sich um den von Kotzebue 1803 ausgesetzten Preis für das beste Lustspiel, indem er sich diesen selbst als Thema wählte: sein Stück „Der Preis" wurde 1804 als das zweitbeste unter allen mitbewerbenden von den Preisrichtern gelobt. Gedruckt wurde (im „Freimüthigen“ vom 9. Septbr. 1803) von allen diesen Arbeiten nur ein kleiner, in ironischem Ton gehaltener Aufsatz über die Einführung des griechischen Chores in Schiller's „Braut von Messina“. Als H. auf die Verwendung seiner Freunde in Berlin im Anfang des J. 1804 als Rath an die Regierung in Warschau versetzt wurde, eröffnete sich seinem künstlerischen Treiben ein weiteres Feld durch neue, litterarisch und musikalisch gebildete Amtsgenossen, von denen er namentlich den damaligen Regierungsassessor Julius Eduard Hitzig (1780—1849) zum Lebensfreunde gewann. Die Begründung einer „musikalischen Ressource“ (1806) gab ihm Gelegenheit zur Ausübung seines mannichfachen Talentes. Er entwarf die Pläne zum Aufbau und zur Ausschmückung des neuen Musikpalastes, er malte selbst in seinen Mußestunden einzelne Zimmer nach seinen originell humoristischen Einfällen aus, er dirigirte die Musikaufführungen, er componirte für Concert, Theater und Kirche. Im December 1804 schrieb er die Musik zu Clemens Brentano's „Lustigen Musikanten“, die er im folgenden April auf die Bühne brachte, darnach zu dem Trauerspiel „Das Kreuz an der Ostsee“ von Zacharias Werner (1768—1823), dessen näheren Umgang er in Warschau genoß. 1805—6 componirte er eine komische Oper „Die ungeladenen Gäste oder der Canonicus von Mailand", 1807—8 eine romantische Oper „Liebe und Eifersucht"; die Texte dazu schrieb und ordnete er selbst, für den „Canonicus“ nach einem französischen Muster, für die zweite Oper nach Calderon's „Schärpe und Blume“. Das politische Geschick Deutschlands wurde über diesem Treiben nahezu vergessen, bis die Folgen der Schlacht von Jena entscheidend auch in Hoffmann's Leben eingriffen. Ende 1806 rückte Murat's Armeecorps in Warschau ein; schon nach wenigen Tagen wurde im Namen des Kaisers die preußische Regierung aufgelöst, ein aus Polen gebildetes Obergericht trat an ihre Stelle. H., der sonst unter der französischen Occupation verhältnißmäßig weniger litt, verlor dadurch sein Amt und Einkommen. Seine Familie, die sich im Juli 1805 durch eine (schon im August 1807 gestorbene) Tochter Cäcilia vermehrt hatte, sandte er mit der ersten sicheren Gelegenheit nach Posen; er selbst folgte, nachdem er ein hitziges Nervenfieber überstanden, im Sommer 1807. Den Gedanken, als Componist in Wien ein Künstlerleben zu beginnen, konnte er aus Mangel an Geld nicht ausführen; unter den trübsten Umstanden verbrachte er ein Jahr in Berlin. Endlich wurde er auf ein Inserat im „Reichsanzeiger“ von dem Reichsgrafen Fr. Julius Heinr. v. Soden (1754—1831) mit der Stelle eines Musikdirectors bei dem unter Soden's Auspicien stehenden Theater in Bamberg (vom 1. Sept. 1808 an) betraut. Er vollendete noch im Februar die Composition einer (später in Bamberg aufgeführten) Oper des Grafen „Der Trank der Unsterblichkeit“ und begab sich dann mit seiner Gattin nach seinem neuen Bestimmungsorte, wo er am 1. Septbr. 1808 eintraf. Hier sah er sich bitter enttäuscht. Graf|Soden hatte sich nach Würzburg zurückgezogen und das ganze Theaterunternehmen dem durch seine Ritter- und Schauerstücke später bekannt gewordenen Heinr. Cuno übertragen, dem alle Mittel und Kräfte fehlten, um die Organisation des Bamberger Bühnenwesens künstlerisch zu betreiben. Nach wenigen Monaten gab H., der auch beim Publicum nicht die wärmste Aufnahme als Capellmeister gefunden hatte, das Musikdirectorat auf und beschränkte sich gegen einen geringen, nicht einmal pünktlich ausbezahlten Gehalt auf die Composition der in den Schauspielen vorkommenden Gelegenheitsstücke. Jedoch schon im Februar 1809 erklärte sich Cuno insolvent. Seine Hauptgläubiger übernahmen die Direction, verfuhren aber nicht nur völlig unkünstlerisch, sondern waren auch „knauserig“ und „grob“ gegen das Personal, so daß H. im Mai 1809 das Theater ganz verließ und durch Unterricht im Clavierspiel und im Gesang, den er auf Empfehlung des musikalisch gebildeten Generalcommissärs Freiherrn v. Stengel in den besten Familien der Stadt ertheilte, seinen Erwerb suchte. Zugleich bot er in einem launigen Briefe dem Herausgeber der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“, Friedr. Rochlitz in Leipzig, seine rein belletristischen oder der Musikwissenschaft dienenden Beiträge an. Gern ging man auf den Vorschlag ein, und schon nach wenigen Tagen übersandte H. die Erzählung „Ritter Gluck“. Zahlreiche Recensionen (von Beethoven's C-moll-Symphonie, seiner C-dur-Messe etc.) und Aufsätze, die in näherer oder entfernterer Beziehung zur Musik standen, folgten, namentlich die charakteristischen Bruchstücke aus dem Leben und den Ansichten des Capellmeisters Johannes Kreisler. Dazu schrieb H. die Artikel über das Bamberger Theater in der „Zeitung für die elegante Welt“. Neu erwachte die Lust zur Malerei: vor allem aber erlahmte nie der Eifer des Componisten: von seinen zahlreichen Arbeiten dieser Art fand die Musik zu Soden's Melodram „Dirna“ (am 11. Octbr. 1809) ungewöhnlichen Beifall. Vollkommen in seinem Element befand sich H., als 1810 Franz v. Holbein (1779—1855), von Glogau her ihm bekannt, die Leitung des Bamberger Theaters übernahm und ihn als Directionsgehülfen annahm, der bald als Architekt, bald als Theatermaler, bald als Compositeur sich versuchte. So brachte er mit dem besten Erfolg einzelne Dramen Calderon's auf die Bühne — er selbst berichtete über diese Aufführungen 1812 in den von Fouqué und Wilhelm Neumann herausgegebenen „Musen" — und componirte unter anderem 1811 von Soden die Oper „Aurora“ und das Melodram „Saul“. Gleichwol blieb seine materielle Lage nicht von jedem Druck frei, obgleich ihm das Erbe seines Onkels in Königsberg einige Erleichterung gewährte. Als aber Holbein im Juli 1812 sich von dem Theater zurückzog, wurden seine Umstände immer trauriger. Nur seine schriftstellerischen, malerischen und musikalischen Arbeiten hielten ihn noch aufrecht. Ernstlich beschäftigte ihn der Entwurf eines größeren Werkes über Musik, „Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers", dessen Fragmente für die „Kreisleriana“ später verwerthet wurden, und die Composition der Oper „Undine“, zu der Fouqué selbst sein Gedicht für H. dramatisirte. Während er sich (seit dem Juli 1812) mit ganzer Seele dieser Arbeit widmete, erhielt er am 27. Februar 1813 von Joseph Seconda einen (durch die Leipziger Freunde vermittelten) Ruf als Musikdirector nach Dresden. Am 21. April verließ er Bamberg, wo er für sein Leben und sein schriftstellerisches Wirken die nachhaltigsten Eindrücke empfangen hatte. Eine heftige Leidenschaft zu Julia, einer seiner Schülerinnen im Gesang, die 1812 einem unwürdigen Gatten zu Theil wurde, bereitete ihm neben geträumten Wonnen quälende Schmerzen, und wenn er auch schließlich einzusehen glaubte, daß „ein großes Phantasma“ ihn täuschte, so blieb das Andenken an die Entrissene für den Schriftsteller noch Jahre lang fruchtbar. Sie fand als Cäcilia und Julia in die „Phantasiestücke“ und in|Kreisler's Lebensgeschichte Eingang; ihr Idealbild schwebte dem Dichter bei den meisten edlen Frauengestalten vor, die klar und lichtvoll aus den nächtlichen Wirren seiner Darstellung hervorstrahlen. — In Dresden fand H. Seconda noch nicht; nach einigen unter dem Einfluß der Kriegsereignisse wechselvoll durchlebten Wochen folgte er ihm am 20. Mai 1813 nach Leipzig, kehrte aber schon am 25. Juni mit seiner Gesellschaft nach Dresden zurück, wo Seconda unerwartet die Erlaubniß, in dem Hoftheater zu spielen, erhalten hatte. Eifrige Thätigkeit wartete seiner hier. Die Aufführungen fanden vielen Beifall, erhielten aber die Mitglieder der Gesellschaft in beständiger Arbeit, daneben vollendete H. vom Juli bis zum December 1813 seine „Undine" und schrieb den „Magnetiseur", das Gespräch „Der Dichter und der Componist“ und das Mährchen „Der goldene Topf“. Noch einmal traten im Herbst die Schrecken des Krieges bei den Kämpfen um Dresden in furchtbarer Nähe an ihn heran; am 9. Decbr. ging er wieder mit Seconda's Truppe nach Leipzig. Eine langwierige, mit gichtischen Anfällen verbundene Brustkrankheit und ein Zerwürfniß mit Seconda bewirkten am 26. Februar 1814 seinen Rücktritt vom Theater; die ihm angetragene Stelle eines Musikdirectors in Königsberg hatte er abgelehnt: so war er wieder ohne sicheres Einkommen, bis ihm durch Hippel's Vermittelung vom preußischen Justizministerium das Anerbieten gemacht wurde, vorläufig ohne festen Gehalt beim Kammergericht zu arbeiten, um später nach seinem Dienstalter als Rath einzurücken. Wie wenig der Vorschlag ihm auch für den Augenblick bot, so ging H. doch darauf ein: am 27. Septbr. 1814 langte er schon in Berlin an. Mannichfach hatte er sich wieder in Leipzig in verschiedenen Künsten versucht, Caricaturen auf die politischen Ereignisse der letzten Tage gezeichnet, vom 8. bis 10. Mai auf Bestellung ein großes Musikstück „Die Schlacht bei Leipzig“, unter dem Namen Arnulf Vollweiler componirt, vor allem „sich fleißig in literis bewegt“. Noch im December 1813 hatte er einen Aufsatz über die Schlacht bei Dresden geschrieben, von dem nur der Schluß, die „Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden" dem Druck übergeben wurde; im März und April 1814 verfaßte er den ersten Theil der „Elixiere des Teufels“, im Mai das (als das schwächste seiner Producte später unterdrückte) romantische Schauspiel „Prinzessin Blandina“ und die düstere Novelle „Ignaz Denner"; beständig schrieb er für die „Allgemeine musikalische Zeitung“, Recensionen, skizzenhafte Erzählungen. Mehrere seiner Beitrüge zu dieser Zeitschrift sammelte er mit vielen noch ungedruckten novellistischen Versuchen zu den vier Bänden der „Phantasiestücke in Callots Manier. Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten“, welche mit einer humoristischen Vorrede Jean Pauls, den H. schon am 30. März 1811 in Bayreuth besucht hatte, 1814—15 bei seinem Bamberger Freunde C. F. Kunz erschienen und so günstig aufgenommen wurden, daß bereits 1819 eine zweite und 1825 eine dritte Auflage davon veranstaltet werden konnte. Die letzten Aufsätze zu diesem Sammelwerke (die Abenteuer der Sylvesternacht, Kreisler's Correspondenz mit dem Baron Wallborn) schrieb er erst in Berlin unter dein Eindruck, den des hier wiedergefundenen Hitzig Freunde, unter ihnen Chamisso und Fouqué, auf ihn gemacht hatten. Für Hitzig's Kinder dichtete er das Mährchen „Nußknacker und Mäusekönig“, für das von Fouqué und Rückert herausgegebene „Frauentaschenbuch" die Erzählung „Die letzte Fermate", für die „Urania auf das Jahr 1817“ den „Artushof"; ferner vollendete er bis zum Schluß des J. 1815 den zweiten Theil der „Elixiere des Teufels“, die sogleich (1815—16) gedruckt wurden. Das ansehnliche Honorar, das er von den Berliner Verlegern derselben, Duncker & Humblot, bereits im Sommer 1815 erhielt, befreite ihn von augenblicklicher Verlegenheit. Gleichzeitig wurde er als Expedient im Bureau des Justizministers mit 800 Thalern|Gehalt vom 1. Juli an angestellt; am 1. Mai 1816 rückte er als Rath in eine vacante Stelle am Kammergericht ein. Andere Ehren warteten des Künstlers H., als am 3. August 1816 seine „Undine“ mit großer Pracht und bestem Erfolg auf die Berliner Bühne gebracht wurde. So getheilt die Stimmen über das Textbuch waren, das Fouqué geliefert, so allgemein und uneingeschränkt lobte man die Musik: Karl Maria v. Weber, der H. am 5. März 1811 in Bamberg kennen gelernt hatte, rühmte 1817 in der „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ die Oper als eine der geistvollsten aus der neuesten Zeit, als ein Werk aus einem Gusse, mit dem er durchaus einverstanden sei. H. wußte das Glück nicht so gut zu ertragen, als zuvor das Unglück. Mit unermüdetem Eifer erfüllte er zwar die Pflichten seines Berufes und widmete sich der Pflege der Künste; die Nächte aber brachte er im an- und aufregenden Verkehr mit übermüthigen Genossen beim Weine zu, wobei er seine körperlichen wie geistigen Kräfte allmählich aufrieb. So gelangten von seinen Werken gerade die, welche am großartigsten angelegt waren, nicht zur Vollendung, neben einer 1817 begonnenen Oper nach Calderon's El galan fantasma vor anderen die „Lichten Stunden eines wahnsinnigen Musikers“. Ein Theil der 1816—17 verfaßten Erzählungen wurde zusammen mit dem völlig umgearbeiteten „Ignaz Denner" 1817 zu den beiden Bänden der „Nachtstücke" vereinigt, während gleichzeitig „Das fremde Kind“ im zweiten Bande der „Kindermährchen“, die H. mit Karl Wilh. Salice-Contessa und Fouqué herausgab, erschien. Im folgenden Jahre entwarf er, in der Form sich an „Rameau's Neffen“ anlehnend, wie ihn Goethe nach Diderot bearbeitet hatte, den Dialog „Seltsame Leiden eines Theaterdirectors“ (Berlin 1819), das Mährchen „Klein Zaches, genannt Zinnober“ (Berlin 1819) und — ebenso auch in den nächsten Jahren — mehrere Erzählungen für das von Stephan Schütze zu Frankfurt a. M. herausgegebene „Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet" (so für 1819 „Doge und Dogaressa“, für 1820 „Das Fräulein v. Scuderi"), für das Leipziger „Taschenbuch zum geselligen Vergnügen“ ("Meister Martin der Küfner und seine Gesellen" 1819, „Signor Formica" 1829 etc.), für die „Urania", den „Berlinischen Taschenkalender“ etc. Diese Novellen sammelte er nebst früheren Aufsätzen 1819—21 in den vier Bänden der „Serapionsbrüder“, vermehrte sie mit neuen und verband sie durch einen fortlaufenden Dialog einiger Freunde, worin er die von Hitzig gestifteten wöchentlichen Zusammenkünfte mit wenigen edleren Genossen in Berlin getreu schilderte, äußerlich zu einem Ganzen. Zur selben Zeit wurde, während H. im Sommer 1819 das schlesische Bad Warmbrunn besuchte, bereits an dem erst 1820 erschienenen ersten Band der „Lebensansichten des Katers Murr" gedruckt, dem 1822 ein zweiter folgte; von dem dritten, großartig entworfenen Theile, an den sich unmittelbar die „Lichten Stunden eines wahnsinnigen Musikers“ anschließen sollten, erschien nach des Verfassers Tode 1826 nur ein Bruchstück. Obwol die Ernennung zum Mitgliede der Immediatuntersuchungs-Commission zur Ermittelung geheimer staatsgefährlicher Verbindungen (1819) und gewisse Nebenarbeiten, wie die Uebersetzung des französischen Textes der „Olympia“ von Spontini, die H. auf den Wunsch des Königs und des im Sommer 1820 nach Berlin berufenen Componisten unternahm, seine Muße sehr beschränkten, behielt er noch Zeit zu neuen schriftstellerischen Arbeiten. Er plante eine Fortsetzung von Tieck's „Merkwürdiger Lebensgeschichte des Abraham Tonelli“ im achten Bande der „Straußfedern"; 1820 verfaßte er, durch echte Zeichnungen von Callot's Hand, die ein Freund ihm geschenkt, angeregt, das im folgenden Jahr zu Breslau erschienene Mährchen „Prinzessin Brambilla“, 1821 auf Andringen der Frankfurter Buchhandlung von Frd. Wilmans den „Meister Floh“, bei dessen Druck 1822 jedoch eine|Episode wegfiel, welche lächerliche Verhältnisse, theilweise von localem Interesse, die dem Verfasser auf amtlichem Wege bekannt geworden waren, persiflirte. Im Herbst 1821 rückte H., dessen Gehalt sich kurz vorher beträchtlich vermehrt hatte, in den Oberappellationssenat des Kammergerichts als Mitglied ein. Nur wenige Monate genoß er die bequemere und freiere Lage, welche ihm diese Beförderung ermöglichte. Nachdem er im folgenden Winter noch einmal fast alle seine näheren Freunde um sich versammelt hatte — auch Hippel weilte vom Herbst 1821 bis zum April 1822 in Berlin —, erlag er am 25. Juni 1822 einer langwierigen Krankheit, der Rückenmarksdarre, deren entsetzliche Schmerzen, mit stets zunehmender Lähmung des Körpers verknüpft, ihn jedoch nicht abhielten, noch in den letzten Wochen eine Reihe der nach seinem Tod herausgegebenen Erzählungen zu dictiren, „Meister Wacht", „Des Vetters Eckfenster", „Die Genesung“ und das Fragment „Der Feind“, die theilweise ein völlig neues, aus der phantastischen Richtung der unmittelbar vorausgehenden Mährchen in das reale Leben zurückführendes Streben bekundeten. —
H. war körperlich wie geistig ungemein beweglich, von Natur aus gut, aber leidenschaftlich angelegt, pünktlich im Beruf, unordentlich im Privatleben, nicht ohne Eitelkeit und Egoismus, der sich bis zum momentanen Haß einer ihn störenden Individualität steigern konnte, überhaupt von der stets wechselnden Laune beherrscht. Die fratzenhaften Verzerrungen und die verborgenen Tiefen der menschlichen Natur zogen ihn am meisten an; seine exaltirt-humoristische Stimmung trieb ihn bald zu den ausgelassensten Sprüngen des tollen Scherzes, bald zu den krankhaften Ideen des Wahnsinns, so daß er beständig geheime Schrecknisse ahnte und Gespenster sah; fast zum fixen Gedanken wurde ihm der Glaube an „die tiefe Ironie, die die Natur in alles menschliche Treiben gelegt", die Ueberzeugung, „daß der Teufel auf alles seinen Schwanz lege". Seine eigenen verworrenen Geschicke, die er, der verfehlten Bestimmung seines Lebens sich bewußt, in seiner zu düsterer Färbung neigenden Phantasie vollends wüste und unlösbar verwickelte, bekräftigten ihn in dieser Anschauung; in seinen Dichtungen, die mit seinem Leben identisch waren, lieh er ihr den mannichfachsten Ausdruck. Das autobiographische Element waltet in allen seinen Erzählungen vor. Nicht nur weitaus die meisten seiner Novellen und Romane knüpfte er an einen Vorgang aus seiner eigenen Erfahrung an, sondern in vielen schilderte er im poetischen Gewande geradezu sich selbst und seine Umgebung überhaupt oder in bestimmten Perioden seines Lebens. Namentlich enthalten die „Kreisleriana", sowol die ersten unter diesem Namen den „Phantasiestücken“ einverleibten Aufsätze als die dem „Kater Murr“ beigegebene fragmentarische Biographie Kreisler's, die eigene Geschichte Hoffmann's, seines musikalisch-künstlerischen Treibens, seines menschlichen Seins und Empfindens namentlich unter dem Einfluß der Bamberger „Marterjahre", die zugleich als „Lehrjahre" den Charakter seines gesammten Dichtens bestimmten. Sie spiegeln sich vornehmlich in den „Phantasiestücken" wieder; aber bei aller schmerzlich-ingrimmigen Ironie, die sich besonders in den Cervantes nachgebildeten „Neuesten Schicksalen des Hundes Berganza" kundgiebt, läßt die kräftig-muntere Darstellung auch ein so sonnig-heiteres Gebilde wie das Mährchen „Der goldene Topf“ zu, nach Hoffmann's eigenem Urtheil sein poetisches Meisterwerk. In düstre, schreckhafte Regionen führen dagegen schon die Stoffe der meisten „Nachtstücke“, in denen der Dichter Eindrücke verwerthete, die er theilweise in der Jugend zu Königsberg und Glogau, theilweise erst in Bamberg und Berlin empfangen hatte. Alle Schauer eines dämonisch über der Freiheit des Menschenlebens waltenden und sie vernichtenden Zufalles, die „geheimnißvollen Verknüpfungen des menschlichen Geistes mit diesen höheren Principien“ enthüllt Hoffmann's einziger vollendeter Roman, „Die|Elixiere des Teufels“, incongruent in seinen beiden Hälften, gleichwol nach einem auf das kunstvollste verwickelten Plane in beständig spannenden Scenen mit sicherer Klarheit und üppiger Kraft dargestellt. Auch zu diesem Werke wie zu den didaktisch-satirischen „Leiden eines Theaterdirectors“ erhielt H. durch Bamberger Erinnerungen den ersten Anstoß. Aeußere Zufälle und innere Stimmungen regten ihn zu seinen Mährchen an, und hier begab er sich, wenn gleich sein Thema meist dasselbe blieb, die Verherrlichung des Lebens in der Poesie, immer mehr in eine phantastische Welt, deren Personen und Gegenstände sich jedoch mit denen der wirklichen vermengen und darum in nebelhafte Schemen zerfließen; der reine Humor, der sich, wie „Prinzessin Brambilla“ allegorisch darstellt, auf den Flügeln der Phantasie aufschwingt, macht immer mehr einer aus Rührung, Skepsis und toller Lust gemischten ironischen Empfindung Platz, in der die grellsten Contraste unvermittelt neben und durch einander wirken. Aehnliches begegnet bei den novellenhaften Erzählungen der „Serapionsbrüder“, die H. theilweise wieder an Erinnerungen aus früherer Zeit anknüpfte, theilweise aber die Stoffe nach den Andeutungen alter Chroniken und Sagenwerke sich bildete. Nicht selten sind es Bruchstücke ohne erklärenden Abschluß, fast immer ohne befriedigende Lösung; die „Nachtseite der Naturwissenschaft“, das Verhältniß des physischen und psychischen Princips in der Natur und im Menschenleben, die Welt der Ahnungen und Träume, die wundervollen Erscheinungen des Magnetismus bilden den Inhalt der meisten dieser Erzählungen, die nicht minder durch diese krankhaft aufregenden Stoffe als durch die H. eigenthümliche Kunst der pikanten Darstellung und den Zauber einer bei aller idealen Phantastik mit sinnlicher Kraft und Klarheit begabten Sprache fesseln. Am stärksten tritt diese äußerste subjective Art der Hoffmannischen Dichtung im „Kater Murr“ hervor, in dem sich alle Eigenarten des Verfassers zusammenfinden, der Hang zur fragmentarischen Darstellung, die Kunst des Contrastes, hier schon äußerlich wirkend durch die Gegenüberstellung der Erfahrungen des philisterhaft gebildeten Katers und der Ereignisse, die das Leben des wahrhaft genialen Kreisler erschüttern und zerstören, die wirre Verschlingung der Fäden der Erzählung, die Lust am Scurrilen, an absonderlichen, schauervollen Abenteuern, die tiefe Ironie, mit welcher die Betrachtung der Welt den Geist des Edlen erfüllt, der unverstanden aus ihr entflohen ist, dem reinen höchsten Genuß der Kunst sich hinzugeben. Von den letzten Erzählungen Hoffmann's gehören einzelne allerdings auch noch ganz diesem Kreise an; in andern aber bezwang der Dichter die wilde Kraft seiner ausschweifenden Phantasie und seines ungezügelten Humors und schilderte objectiv mit ruhiger Kunst natürliche Vorgänge der wirklichen Welt. Wiederholt faßte H. in seinen Schriften die Musik als Vertreterin der Kunst überhaupt; in ihr, zu der er von früher Jugend auf einen natürlichen Beruf erkannte, gelangte er auch öfter und eher zu heiterer Klarheit als in der Poesie und in der bildenden Kunst, deren Studium ihn freilich zunächst zur Porträtmalerei, schließlich aber — und erst hier verrieth sich sein originelles Talent — zur Caricaturzeichnung führte. Mozart und Beethoven waren die Meister, die H. grenzenlos verehrte, für die er durch Wort und That überall zu wirken suchte, daneben Haydn in der Kammermusik, Händel und Bach im Oratorium, in Kirchensachen die alten Italiener, in der Oper Gluck. Cherubini und Spontini. An seinen eigenen Compositionen rühmte die gleichzeitige Kritik die leicht fließenden, aber innig gedachten und sorgfältig verschlungenen Melodien, die effectvolle, technisch vollendete Begleitung, überhaupt die charakteristische und bedeutende Ausführung der einzelnen, namentlich der breiter und voller angelegten Nummern; die künstlerische Abrundung zu einem in allen Theilen mit gleicher Liebe und gleichem Glück behandelten Ganzen sowie die dramatische Haltung|wurde von einzelnen Recensenten vermißt, während Weber gerade den einheitlichen Guß der Musik zur „Undine“ lobte, deren Componist ohne Rücksicht auf den momentanen Beifall stets den Blick auf das Ganze gerichtet habe. Hoffmann's Recensionen und Aufsätze über Musik zeigen nicht blos den mit allen Mitteln und Geheimnissen seiner Kunst vertrauten Musikgelehrten, sondern mehr noch den Dichter, der als poetischer Seher das Wesen der Musik in wunderbarer Tiefe erfaßt und deutet. — Von Hoffmann's Compositionen und Zeichnungen wurden nur unbedeutende, kleinere Stücke durch den Druck und Stich allgemein bekannt; seine dichterischen Schriften erschienen 1827 zu Berlin in einer Auswahl in 10 Bänden, 1827—31 zu Stuttgart in 18 Bändchen, gesammelt in 12 Bänden zu Berlin 1844—45 und 1856—57.
-
Literatur
Aus Hoffmann's Leben und Nachlaß (von Hitzig), 2 Theile. Berlin 1823. Neu aufgelegt 1827 und 1839 mit einigen Nachträgen in „E. T. A. Hoffmann's Erzählungen aus seinen letzten Lebensjahren, sein Leben und Nachlaß“, herausgegeben von Micheline Hoffmann, Band 3—5. —
Z. Funck (C. F. Kunz), Erinnerungen aus meinem Leben, Band 1, Leipzig 1836. —
Mittheilung aus den Acten der Königsberger Universität durch die Güte des Herrn Professors Dr. Friedländer. -
Autor/in
Franz Muncker. -
Zitierweise
Muncker, Franz, "Hoffmann, Ernst" in: Allgemeine Deutsche Biographie 12 (1880), S. 575-583 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118552465.html#adbcontent