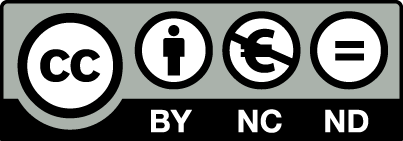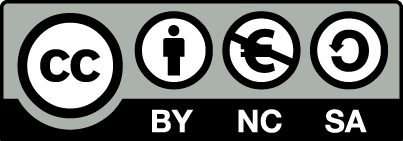Hoverbeck, Leopold Freiherr von
- Lebensdaten
- 1822 – 1875
- Geburtsort
- Nikkelsdorf Kreis Allenstein (Ostpreußen)
- Sterbeort
- Gersau (Schweiz)
- Beruf/Funktion
- preußischer Politiker ; Landschaftsdirektor ; Gutsbesitzer ; Jurist ; Politiker
- Konfession
- evangelisch
- Normdaten
- GND: 118775103 | OGND | VIAF: 40174289
- Namensvarianten
-
- Hoverbeck, Leopold Freiherr von
Vernetzte Angebote
Verknüpfungen
Personen im NDB Artikel
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Hoverbeck, Leopold Freiherr von
preußischer Politiker, * 25.7.1822 Nikkelsdorf Kreis Allenstein (Ostpreußen), † 12.8.1875 Gersau (Schweiz). (evangelisch)
-
Genealogie
V Ernst (1787–1868), Rittmeister, Rittergutsbes., S d. Gutsbes. Ferdinand u. d. Eleonore Frieder. Gfn. v. Eulenburg;
M Wilhelmine (1794–1866), T d. Domänenamtmanns David Thiel u. d. Friederike Carol. Stenzler, ⚭ 1853 Leopoldine (* 1831), T d. Rittergutsbesitzers Gottlieb Käswurm u. d. Karoline Wilwodinger (beide aus Salzburger Emigrantenfam.); 1 Adoptiv-T. -
Biographie
Nach abgeschlossenem Jurastudium in Königsberg und Berlin besuchte H. die Landwirtschaftliche Akademie Regenwalde und unternahm eine Studienreise, um Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Rationalisierung zu erkunden. Dank seiner Erfolge dabei wählte man ihn 1862 zum Landschaftsdirektor für das Departement Mohrungen. Bis zum Tode behielt H. das Amt und erwarb sich große Verdienste um die Landwirtschaft in der Provinz Preußen.|Beeinflußt von seinem langjährigen Freund, dem Radikalliberalen Carl Witt, wandte sich H. seit 1848 zunehmend nationalpolitischen Fragen zu. 1858 wurde er in das Preußische Abgeordnetenhaus gewählt; bald erkannte er die programmatischen Unklarheiten, unter denen die große liberale Partei litt. Dies sowie persönliche Abneigung gegen den Parteiführer Georg von Vincke bewog H., gemeinsam mit Forckenbeck und weiteren, vornehmlich ostpreußischen Linksliberalen die Partei zu verlassen. Diese von Vincke als „Junglitauische Fraktion“ verspottete Gruppe wurde wenige Wochen später der Kern bei Gründung der Deutschen Fortschrittspartei (1861). – Da die Budgetkommission des Abgeordnetenhauses H. zum Berichterstatter für den Militäretat bestellt hatte, konnte er während der gesamten Konfliktszeit an hervorragender Stelle für die Rechte der Volksvertretung streiten. Schon Jahre zuvor war H.s preußischer Patriotismus hinter einer nationalpatriotischen Einstellung zurückgetreten. Er beteiligte sich führend im Nationalverein. Auch jetzt ging es ihm darum, ein demokratisiertes Preußen als sichere Grundlage der erstrebten Reichseinheit entwickeln zu helfen. Von dieser Einstellung her griff er dann als Abgeordneter im Norddeutschen beziehungsweise im Deutschen Reichstag (1867–75) die Bismarcksche, als preußisches Hegemoniestreben empfundene Politik an. Seine Kritik in Fragen der Militärorganisation sowie die distanzierte Haltung gegenüber dem liberalen Kulturkampfkurs wurzelten in denselben nationalpolitischen Erwägungen. – Indessen litt H.s öffentlicher Einfluß unter seinem wachsenden Doktrinarismus. Gleichwohl bekannte sich eine Reihe bedeutender Linksliberaler, vor allem →Eugen Richter, zu H. als ihrem politisch-parlamentarischen Lehrmeister.
-
Werke
u. a. Volkswirtsch. Aufsätze, in: Osteroder Dorfztg., später Neue Dorfztg., hrsg. v. C. Witt, Jgg. 1849-50;
Aufsätze in: Mschr. f. Pomol. u. prakt. Obstbau, hrsg. v. E. Lucas, Jgg. 1854–59, 1871;
Stenograph. Ber. üb. d. Verhh. d. preuß. Abgeordnetenhauses sowie Stenograph. Ber. üb. d. Verhh. d. Reichstages d. Norddt. Bundes bzw. d. dt. Reichstags. -
Literatur
ADB 50;
L. Parisius, L. Frhr. v. H., 3 Bde., 1897-1900 (P);
O. Klein-Hattingen, Gesch. d. dt. Liberalismus I, 1911, S. 332 f. u. ö. (P);
R. Adam, Der Liberalismus in d. Prov. Preußen z. Z. d. neuen Ära u. s. Anteil an d. Entstehung d. Dt. Fortschrittspartei, in: Altpreuß. Btrr., 1933, S. 167 ff.;
W. Kosch, Biograph. Staatshdb. I, 1963, S. 572;
G. Eisfeld, Die Entstehung d. liberalen Parteien in Dtld., 1858–70, 1969;
Altpreuß. Biogr. -
Porträts
Gem. V. G. Graef, 1875/76;
Büste v. O. Lessing. -
Autor/in
Klaus-Peter Hoepke -
Zitierweise
Hoepke, Klaus-Peter, "Hoverbeck, Leopold Freiherr von" in: Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 663 f. [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118775103.html#ndbcontent
-
Hoverbeck, Leopold
-
Biographie
Hoverbeck: Leopold Freiherr von H., preußischer Demokrat, geboren am 25. Juli 1822 zu Nickelsdorf im ermländischen Kreise Allenstein, † am 12. August 1875, entstammte einer niederländischen Familie, die zur Zeit Herzog Alba's in die Mark Brandenburg auswanderte und sich vielfach im brandenburg-preußischen Staatsdienste auszeichnete. Der verdienstvolle Gesandte des Großen Kurfürsten Johann v. H., der in den Freiherrnstand erhoben wurde, und der Hofgerichtspräsident Johann Dietrich v. H. gehörten zu seinen Ahnherren. Ein andrer Herr v. H. erwarb sich zur Zeit Friedrich's des Großen das Verdienst als einer der ersten Edelleute auf seinen Besitzungen die Leibeigenschaft abzuschaffen. Der Vater Leopold's v. H. nahm 1819 als Rittmeister den Abschied, verheirathete sich am 16. Juni 1820 mit der sanftangelegten Wilhelmine Thiel, der Tochter eines Domänenamtmanns im Kreise Angerburg, in dessen Hause bereits einigermaßen demokratische Luft geweht zu haben scheint, und erwarb dann das Gut Nickelsdorf im Ermlande.|Er wurde ein tüchtiger Landwirth, der indeß seine Leute äußerst hart behandelte. Ihrem nach zweijähriger Ehe geborenen Sohne Leopold ließen die Eltern eine spartanische Erziehung zu Theil werden. Die ersten zehn Jahre seines Lebens schlief Leo, wie er genannt wurde, nicht in einem Bette, sondern auf der Diele. Auch ging er in dieser Zeit barfuß. Nachmals scherzte man wol, daß er nach Rousseau’schen Principien erzogen worden sei. Eine Folge der Strapazen, die dem Knaben zugemuthet wurden, war es, daß er auf einem Auge erblindete. Mit zehn Jahren kam er auf das Friedrichscollegium in Königsberg, von dem er am 30. October 1840 mit dem Zeugniß der Reife für die Universität entlassen wurde. Er war kein Musterschüler gewesen, und auch das Abgangszeugniß war nicht glänzend. Am 3. November 1840 als Student der Rechte an der Albertina immatriculirt, absolvirte er dort mit Ausnahme des Sommersemesters 1842, das er in Berlin verbrachte, sein Triennium. Der hünenhafte junge Mann, der seine sechs Fuß maß, wurde ein eifriges Mitglied der Landsmannschaft Littuania, deren Senior er in seinen beiden letzten Semestern war, und zeichnete sich dabei durch einfache Lebensweise aus. Die Berliner Studenten behagten ihm wenig; er nannte sie wol „Zierbengel mit pomadisirten Köpfen“. Dem Corpswesen und der Mensur stand er ablehnend gegenüber. Als die Litauer sich 1848 in ein Corps und eine Landsmannschaft spalteten, blieb er in der Landsmannschaft, die indeß später zu seinem Schmerze ebenfalls ein Corps wurde. Zwar machte er sein erstes juristisches Staatsexamen und leistete den Eid als Auscultator. Er verspürte aber nicht Lust, die Beamtenlaufbahn einzuschlagen, vielmehr hatte er die landwirthschaftlichen Neigungen seines Vaters geerbt. Diesen ging er alsbald nach und bezog im J. 1844 die landwirthschaftliche Schule zu Regenwalde, wo er fleißig Sprengel hörte. Von Juli bis October 1845 unternahm er eine größere landwirthschaftliche Studienreise durch Deutschland. Dabei besuchte er u. a. die landwirthschaftliche Lehranstalt in Möglin im Oderbruch, wo ihm die Eleven nicht sonderlich gefielen, weil sie „halben Berliner Pli" hatten und „wenig thun, als in die Vorlesung gehen“, wie er schrieb. „Sie beachteten mich wenig, weil ich zu Fuß gekommen war und mich ihnen schlechtweg als Oekonom vorstellte“. In Hohenheim bei Stuttgart knüpfte er mit Landwirthen von Bedeutung wie Pabst, Mögling und Lucas Beziehungen an. Heimgekehrt, erhielt er im November 1845 von seinem Vater das Rittergut Adlig-Quetz im Kreise Heilsberg, vier Meilen von Nickelsdorf, zum Geschenk. In diesem „Eulenneste“, wie er wol sagte, führte H. nunmehr acht Jahre ein einsames Dasein. Ein hölzernes Haus diente ihm als Wohnstätte. Nur zwei Mal in der Woche kamen dorthin Zeitungen.
Die Zeit in Adlig-Quetz wurde für ihn bedeutungsvoll durch das Freundschaftsverhältniß, das sich zwischen ihm und dem sieben Jahre älteren Oberlehrer Witt in Hohenstein herausbildete, und die geistige Anregung, die er von diesem sehr radical angelegten Mann empfing. Allmählich trat hinter diesem Geistesbund die Freundschaft, die er mit dem conservativen Theologen Fritz Oldenberg noch in der Littuania geschlossen hatte, zurück. Witt suchte H. für seine demokratischen Anschauungen zu gewinnen. Doch verhielt sich H. dazu anfangs ablehnend, namentlich angesichts der niedrigen Bildungsstufe der Bauern und Arbeiter seiner Gegend. Im J. 1848 hat er sich garnicht an der Politik betheiligt. Ende 1848 trat sogar eine Unterbrechung in seinen freundschaftlichen Beziehungen zu Witt ein. Dann aber knüpfte H. wieder an, indem er für Witt's „Dorfzeitung" Beiträge lieferte. Er schrieb darin über „Einnahmen und Ausgaben des preußischen Staates“ und über „Das Salz“. Die Aufsätze verriethen seine volksfreundliche Ader. Er strebte eine|Beseitigung des Salzmonopols, womöglich jeder Salzsteuer an, und die Erreichung dieses Zieles wurde ein Gedanke seines Lebens. Doch vermochte es ihn auch nicht aus seiner parteilosen Haltung zu reißen, als Witt 1851 im Disciplinarwege abgesetzt wurde. Er vertheidigte seine politische Unentschiedenheit gegen den Freund wol mit den Worten: „Ich halte das starre Festhalten an einer Partei für Lüge und Gewissenlosigkeit gegen das Vaterland“. Es schien ihm am lohnendsten, ganz in der landwirthschaftlichen Thätigkeit aufzugehen. Doch regte sich früh in ihm der Patriotismus. „Deutschlands Einheit geht mir über Alles, und ich gebe ohne Bedenken die Freiheit dafür hin“ schrieb er 1850. Bald erwarb er sich in seiner Gegend als Landwirth großes Ansehen. Im Gegensatz zu seinen Berufsgenossen war er der Jagd abgeneigt. Dafür liebte er die Musik und pflegte eifrig den Gesang. Am 9. December 1853 verheirathete er sich mit Leopoldine Käswurm, der Tochter eines Gutsbesitzers aus der Gumbinner Gegend, deren Familie von den um ihres Glaubens willen vertriebenen Salzburgern abstammte. Bald darauf übernahm er Nickelsdorf von seinem Vater, der mit seiner Frau in die Stadt zog. In Nickelsdorf schien H. ganz Obstbaumzüchter zu werden. Da kam die Regentschaft des Prinzen von Preußen, und nun hielten die freisinnigen Kreisrichter seiner Gegend, mit denen er in Beziehung getreten war, den Augenblick für gekommen, diesen praktischen und doch freiheitlich angelegten Landwirth in die politische Arena vorzuschicken. Am 23. November 1858 wurde H. und ein Clerikaler von den Wahlmännern des damaligen Wahlkreises Allenstein-Ortelsburg ins Abgeordnetenhaus gewählt.
Einmal in die Politik hineingestellt, entdeckte H. bald sein radicales Herz. Schnell und innig freundete er sich mit Forckenbeck an. An Thätigkeit gewöhnt, empfand er es mit Genugthuung, daß er in die Budgetcommission gewählt und zum Berichterstatter beim Militäretat bestellt wurde. „Mir ist das gerade recht“, schrieb er, „da ich wahrhaftig nicht Haus und Hof verlassen habe, um mich hier in Berlin zu amüsiren“. Er schloß sich dem Nationalverein an und entfaltete eine rege Thätigkeit für diesen. Daneben ließ er es sich angelegen sein, bei dem liberalen Ministerium für die Wiederanstellung Witt's zu wirken, was ihm schließlich auch gelang. Bald erkannte er, daß die Partei Wentzel-Schwerin, der er beigetreten war, bei der Verschiedenheit der zu ihr gehörigen Elemente auf die Dauer nicht zusammenhalten würde. Nicht zum wenigsten mißfiel ihm die Anmaßlichkeit Georg's v. Vincke, des Hauptwortführers der Partei. Schließlich kam es bei der Adreßdebatte am 5. Februar 1861 wegen der Haltung der Fractionsmehrheit in der italienischen Frage, die H. und seinen Freunden nicht entschieden genug war, zum Bruch. H., Forckenbeck und noch neun andere, lauter Preußen, traten aus. Vincke spottete laut über die Fraction „Junglitauen“, dabei zugleich wol anspielend auf die akademische Vergangenheit des noch recht jugendlichen Parteiführers H. Am 2. März constituirte sich die Fraction „Junglitauen“. Ihren dreizehn Mitgliedern gesellten sich in der Folge noch sechs zu. H. erwies sich jetzt als zum Fractionsführer geboren. Nicht weil er besonders zum Redner veranlagt war. Es wird nicht viele Parteiführer seines Ranges gegeben haben, die so wenig lange Reden gehalten haben wie er. H. empfand geradezu eine Scheu vor langen Ausführungen, und wenn er gelegentlich weiter ausholen mußte, so fühlte er stets das Bedürfniß, sich zu entschuldigen und sprach auch dann nicht allzu lange. Gewöhnlich hielt er nur Reden bei großen Principienfragen, kaum daß er noch hin und wieder in landwirthschaftlichen Dingen, in denen er so sehr Fachmann war, das Wort ergriff. Es war ihm auch nicht immer gegeben, effectvoll zu sprechen. Dafür besaß er eine große Fähigkeit|schnell die Sachlage zu erfassen. Unzählige Male griff er durch kurze, den Kern der Sache treffende Bemerkungen in die Debatte ein. Dabei lag etwas Schroffes in seinem Wesen, das oft lauten Unwillen bei den Gegnern hervorrief, das aber in einer Zeit erbittertsten Kampfes nur sein Ansehen bei den Freunden mehren konnte. Bei aller Schärfe, ja Derbheit, die litauisch anmuthete, bewegte er sich fast immer in sachlichen Bahnen. Es ist charakteristisch, wie vortheilhaft die Art der Discussion dieses radicalen Volkstribunen von der späteren oppositionellen Dialektik im deutschen Parlament absticht. Er hatte sich so in der Gewalt, daß er niemals einen Ordnungsruf erhielt. Ein großes Geschick bewies H. als Parteiführer auch durch die Verwendung der einzelnen Kräfte seiner Fraction an der richtigen Stelle und bei den Verhandlungen mit anderen Fractionen. So kam es, daß ihm in der Conflictszeit eine Rolle zufiel, wie sie, außer Windthorst, kaum je noch ein Parteiführer im preußischen und deutschen Parlament gespielt hat.
Als H. seine Rolle als Parteiführer begann, spitzten sich die Dinge in Preußen zum Verfassungsconflict zu. Die Mehrheit des Abgeordnetenhauses zeigte ein sehr geringes Verständniß für die Lebensbedingungen des preußischen Staates, und H. als Wortführer zunächst von „Jung-Litauen“ bekundete das nur zu unzweideutig. Erblickte er doch in der dauernden Bewilligung der für die Heeresorganisation geforderten neun Millionen Thaler ohne das Zugeständniß der zweijährigen Dienstzeit die „finanzielle Zerrüttung“ Preußens, wie er es mit dürren Worten am 27. April 1861 erklärte. Er war so durchdrungen von seiner Ansicht, daß er allen Vorwürfen, die ihm aus deren Vertretung gemacht werden konnten, kühn trotzen zu können glaubte: „Man wird uns Opposition vorwerfen, eine tendenziöse, eine faktiöse Opposition und wie alle die Kunstausdrücke lauten; sie werden unter Umständen sich bis zum Landesverrath steigern, und zwar weil man uns imputirt, daß wir damit unser Vaterland wehrlos dem Gegner preisgeben würden. Ich bin der Ansicht durchaus nicht. Ich glaube, daß ich noch nie eine so patriotische Handlung ausgeführt habe, als durch das Nein, welches ich jetzt spreche“. Er erlebte die Genugthuung, daß sich ihm nach Schluß des Landtages eine größere Anzahl namentlich von Berliner Liberalen anschloß, mit denen zusammen er die „Deutsche Fortschrittspartei“ gründete. Das Ziel der Partei war edel und groß. In ihrem Programm hieß es: „Die Existenz und die Größe Preußens hängt ab von einer festen Einigung Deutschlands, die ohne eine starke Centralgewalt in den Händen Preußens und ohne gemeinsame Volksvertretung nicht gedacht werden kann“. Zweifelhaft erschien es nur, ob die Partei die rechten Mittel finden würde, dies Ziel zu erreichen. Die Wahlen zeigten, daß sie im Lande großen Anhang hatte. Ende 1861 zog sie 83 Mitglieder stark in das Abgeordnetenhaus ein. H. selbst war drei Mal in seiner Heimathprovinz gewählt, in Tilsit-Niederung, in Sensburg-Ortelsburg und in Osterode-Neidenburg, ein Zeichen seiner großen Volksthümlichkeit. Er nahm für Osterode-Neidenburg an. Im neuen Hause wurde er wieder in die Budgetcommission gewählt und zum Berichterstatter über die Anträge Hagen, den Ausgangspunkt des Militärconflicts bestellt. Nach einer kurzen Session wurde das Haus aufgelöst. Der Wahlkreis Osterode-Neidenburg, der ihn das vorige Mal nur mit geringer Mehrheit gewählt hatte, entsandte ihn bei den Neuwahlen fast einstimmig als seinen Vertreter wieder hinein. Mit 135 Mitgliedern bildete die Fortschrittspartei bei weitem die stärkste aller Fractionen. Vereint mit der ihr nahestehenden Partei Vockum-Dolffs verfügte sie über eine gebieterische Mehrheit in dem damals aus 350 Mitgliedern bestehenden Hause. Es war begreiflich, wenn H. sich etwas von der aufgeregten Volksstimmung|angesteckt zeigte und so beim Schützenfest in Frankfurt a. M. im Juli 1862 entgleiste, indem er dort die „deutschen Brüder" in einer mit „schneidendem Accent“ gesprochenen Rede apostrophirte: „Seien Sie überzeugt, daß wenn irgendwie die sogenannten preußischen Interessen mit den deutschen Interessen in Zwiespalt kommen sollten, wir die deutschen Interessen bevorzugen“. Das stimmte nicht ganz zum Wahlprogramm seiner Partei. Für einen Verfechter des preußischen Machtgedankens, wie Roon es war, gab es keinen schlimmeren politischen Fehler als Verleugnung der preußischen Interessen. Er verfehlte daher nicht am 12. September, H. wegen jener Wendung zur Rede zu stellen. Doch wußte sich H. geschickt aus der Affäre zu ziehen. Aber gleichzeitig lieferte er einen neuen Beweis dafür, daß der populäre Lärm ihm die Lage in einem schiefen Lichte zeigte. Er behauptete: „Was uns noch einigermaßen in der Achtung von Deutschland und Europa erhält, das ist der Widerspruch, den das Abgeordnetenhaus diesem Ministerium entgegensetzt“. Wenige Tage darauf sah er sich dem Ministerium Bismarck gegenüber.
Hatte H. bisher noch Rücksichten und Versöhnlichkeit gezeigt: die überlegene Kampfesnatur des neuen leitenden Staatsmanns trieb ihn für immer in die Rolle des Intransigeants hinein. H. ahnte garnicht, daß er ganz dem Wunsche Bismarck's entsprechend handelte, wenn er sich unbeugsamer denn je erwies, weil dies der beste Weg für die Regierung war, volle Klarheit in die Lage zu bringen. Zwar ermaß er wol, daß dem Ministerpräsidenten eine große Verschlagenheit zu Gebote stand; er empfand vor ihr ein gewisses Grauen und war geneigt, sie auch da zu sehen, wo sie nicht mitspielte. Gereizt durch die unbedenkliche Kampfesart des Ministers und dadurch gleichsam in die Enge getrieben, wußte er nichts anderes, als sich um so fester an die Doctrin zu klammern, zumal da er nicht erkennen konnte, wohin des kühnen Steuermanns Fahrt ging. So nahm er eine so starre Haltung ein, wie sie der Parlamentarismus selten erlebt hat. Einst hatte gerade H. solche Starrheit als eine Gewissenlosigkeit gegen das Vaterland gebrandmarkt. Nicht unrichtig bemerkt der Kreuzzeitungsredacteur Herm. Wagener über Hoverbeck's Haltung in der Conflictszeit, daß H. von den damaligen Parlamentariern die meisten Anlagen zu einem Conventsdeputirten und zu einem Mitgliede des Wohlfahrtsausschusses gehabt habe. Zuerst rieb H. sich mit Bismarck aus Anlaß der weitausschauenden Alvensleben’schen Convention mit Rußland wegen des polnischen Aufstandes. Ebenso urtheilslos wie stolz sprach er von der „Blamage“ des Ministeriums dabei und meinte gegen Bismarck boshaft, als dieser die Convention eine große Seeschlange nannte, das thäte er wol, weil sie ihn schon recht „scharf gebissen habe“. Den unversöhnlichsten Groll weckte es in ihm, als Bismarck erklärte, er halte sich nicht der Disciplin des Hauses unterworfen. Sein Zorn darüber war ein neues deutliches Zeichen dafür, daß es sich bei dem herrschenden Conflicte schon lange nicht mehr um die Militärfrage an sich, sondern lediglich um die Macht handelte. H. wollte dem Parlamente die entscheidende Stellung im Lande erobern. Gelegentlich führte er einmal aus, daß er dem preußischen Könige in seinem Lande nicht mehr Macht zugestände als dem belgischen; und die preußische Verfassung, die Charte Waldeck, gab ihm auch ein gewisses Recht dazu. Der Kernpunkt aber war, daß Bismarck die Krongewalt“ fester zu stabiliren suchte. Weil sich Bismarck nicht den Willen des Parlaments aufzwingen ließ, kündigte H. am 11. Mai 1863 zornglühend Kampf bis aufs Messer an: „Der Herr Kriegsminister hat uns gefragt, was wir denn unsererseits zu bieten hätten. Dieser Regierung, m. H., nichts!“ So kam es zu der verwegenen Maßregel des Bismarck’schen Preßedicts vom 1. Juni 1863. H. begann zu ahnen, daß es vergebliche Mühe|sein würde, es mit diesem Minister aufzunehmen, und äußerte, er sei so abgemattet und gleichzeitig so verbittert, daß er nichts mehr wünschte, als sich wieder aufs Land zurückzuziehen.
Seine Popularität begann bereits nachzulassen. Bei den Neuwahlen am 20. und 28. October 1863 erhielt er in Osterode-Neidenburg eine weit geringere Mehrheit. Seine Wähler machten seinen Doctrinarismus nicht alle mit. Er aber ließ nicht davon ab, sondern zeigte sich nur noch mehr aufgestachelt. Es war ein Schlag ins Wasser, als ihm der Conservative Moritz v. Blanckenburg, vielleicht inspirirt von seinem Freunde Bismarck, die realpolitische Handlungsweise seines Ahnherrn, des Gesandten Johann v. H. in der bekannten Kalkstein’schen Sache vor Augen hielt. „Glauben Sie nicht“, so rief Blanckenburg, „daß damals kein Zweifel darüber gewesen ist, daß verbriefte und beschworene Rechte dadurch (durch Kalkstein's Gefangennahme) gekränkt wurden? M. H.! Was hat die Weltgeschichte aber nachher dazu gesagt, als die Sache vollendet war?“ Da habe man die Handlungsweise des Gesandten v. H. gepriesen. „Warum denn? Darum, weil die Stände ihr Recht gemißbraucht hatten, weil sie nicht begriffen, daß Preußen mußte ein Großstaat werden! Und m. H., fallen Sie jetzt nicht wieder in denselben Fehler“. Ein solcher Kalkül auf die Erweckung des realpolitischen Verständnisses mußte bei H. vollständig versagen. H. vermochte auch bei seinem Vorfahren nur das Unrecht zu erkennen und erklärte trocken: er würde zu Gunsten keines Fürsten der Welt so handeln. Sein aufgepeitschter Fanatismus bestimmte ihn, der Regierung auch die Mittel zur Kriegführung gegen Dänemark zu verweigern.
Seit Düppel und Alsen begann es ihm deutlicher zu werden, daß er eine verlorene Sache vertrat. „Es ist sehr wohl möglich, daß die Reaction durch Einschüchterung siegt“ schrieb er an Witt. Trotzdem lag ihm nichts ferner als der Gedanke an ein Einlenken. Als er nach dem Kriege in seiner schroff ablehnenden Haltung gegen Bismarck verharrte, suchte ihn selbst Witt umzustimmen, indem er ihm entwickelte, daß der Grundsatz, einem Ministerium, das man beseitigen wolle, dürfe man nichts bewilligen, unrichtig sei. Aber umsonst. Am 15. März 1865 erklärte H. im Abgeordnetenhause mit Emphase aufs neue: „Dieses Ministerium wollen wir bekämpfen, solange es in unseren Kräften steht, gestützt auf unser gutes Recht“. Am 28. April kam es wieder zu einem überaus heftigen Zusammenstoß zwischen ihm und Roon. Voller Verbitterung schrieb H. am 27. Juni von der „widerlichen Aufgabe, sich im Abgeordnetenhause mit Leuten herumzustreiten, die man für ausgemachte Schurken hält". Er sprach gegen Witt von der „frechsten Mißachtung der Gesetze", die die Regierung übe, zu der sie „noch die seelenverderbende Heuchelei füge.“ Aeußerlich wußte er in seinem Auftreten im allgemeinen Ruhe und Kälte zu bewahren. Er wollte seinen Feinden „nicht die Freude gönnen zu sehen, wie tief mich die jetzige Wirthschaft schmerzt“. Doch wurde er gelegentlich wegen eines im Januar 1864 verbreiteten Flugblatts unter Anklage gestellt und schließlich am 9. Januar 1866 der Beleidigung des Staatsministeriums für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurtheilt. Zuweilen gefiel er sich auch darin, das Abgeordnetenhaus ein bischen Convent spielen zu lassen, so als er am 29. Januar 1866 das allerdings unglückliche Urtheil des Obertribunals in der Twesten’schen Sache für ungültig zu erklären beantragte und damit durchdrang. Das Ministerium durfte daraufhin dem Hause in aller Ruhe bemerken, daß es nicht das Recht habe, richterliche Urtheilsprüche anzufechten. H. vermochte in einem solchen Bescheide nur eine unerhörte Beleidigung zu sehen, mußte sich aber wohl oder übel damit abfinden. Seine|unbelehrbare Opposition wurde von seinem Wahlkreise Osterode-Neidenburg bei den Neuwahlen am 3. Juli 1866 damit beantwortet, daß man ihn nicht wiederwählte. Während er drei Jahre vorher fast einstimmig gewählt worden war, sammelte er am Tage von Königgrätz nur 88 Stimmen gegenüber 277 gegnerischen auf sich. Dafür wählte ihn der radicalere Kreis Königsberg-Fischhausen, allerdings auch nur mit knapper Mehrheit.
Resignirt schrieb H.: „Du fühlst es ganz richtig heraus, daß wir jetzt eine traurige Zeit durchleben, nicht nur wegen des resultatlosen Kampfes gegen die brutale Gewalt, sondern noch viel mehr wegen des Abfalles alter Freunde, die uns als unverbesserliche Nihilisten mit einem leichten, aber fühlbaren Fußtritt zum Teufel gehen lassen. Nun wir wollen redlich aushalten, bis das Volk unserer müde ist und uns nicht wiederwählt“. Demgemäß erwies er sich weiter unversöhnlich und trat gegen den Entwurf des Indemnitätsgesetzes ein, jenen Meisterzug Bismarck's, durch den dieser sich ganz zum Herrn der inneren Lage machte und H. für immer als parlamentarischen Machtfactor ausschaltete. War Hoverbeck's einst so mächtige Partei schon bei den Wahlen vom 3. Juli auf 81 Mitglieder herabgesunken, so trat infolge der Stellung zur Indemnität eine völlige Spaltung in der Partei ein. Forckenbeck und Kosch, die mit H. zusammen in Königsberg gewählt worden waren, stimmten für die Indemnität. Ein großer Theil der Partei schloß sich der neugebildeten Fraction der Nationalliberalen an. H. aber sprach am 3. September 1866 die bitteren Worte: „Wir können leicht dem Auslande das scheinbare erkünstelte Schauspiel der Einigung geben, wenn wir alle Differenzen verhüllen und die Rechte des Landes preisgeben. Ich meinerseits habe aber keine Lust dazu. Der Ministerpräsident hat uns die Wucht der vergangenen Thatsachen geschildert. Wir sind weit entfernt von einer Machtanbetung, die wegen äußerer Erfolge die inneren Rechte des Volkes preisgeben könnte. Ich will anerkennen, daß der Ton der Rede des Ministerpräsidenten ein versöhnlicher war. Er hat uns versichert, daß er den Frieden nicht aus Verlegenheit wünsche und sich darauf berufen, daß die Fluth im Innern zu seinen Gunsten zu fließen scheine. Nun, dieses Bild der Fluth könnte ich acceptiren — ich glaube, daß auf die Fluth die Ebbe folgt. Ich sehe mich im Lande um, ob die Früchte der Art sind, daß sie ein festes constitutionelles Regiment für die Zukunft versprechen. Wenn Sie es noch nicht wissen, dann erkundigen Sie sich über den Punkt bei den Leuten, die im Gefängniß schmachten, weil sie das ausgesprochen haben, was die Regierung jetzt selbst anerkennt“. Seine Haltung fand abermals die Mißbilligung seines nächsten Freundes Witt. Unzufrieden mit der Gestaltung der deutschen Dinge schrieb H. am 17. October 1866: „Zweck des Kriegs war nicht etwa die Einigung Deutschlands, sondern die Vergrößerung Preußens, der Domäne Wilhelm's I.“ Seinem unentwegten Groll gab er am 6. December durch den Antrag auf Streichung Bismarck's und Roon's aus der Liste der zu Dotirenden Ausdruck, „weil ich diese Minister noch nicht für mit dem Lande ausgesöhnt halte“. Seitdem hatte H. seine Rolle im Abgeordnetenhause im wesentlichen ausgespielt. Im J. 1868 wurde er noch einmal von seinem heimathlichen Kreise Allenstein-Rössel gewählt. Dann schied er aus dem Landtage aus.
Etwas mehr trat er seitdem im Reichstage hervor. Zwar fiel er bei den Wahlen zum constituirenden Reichstage des norddeutschen Bundes am 12. Februar 1867 in Allenstein-Rössel durch. Auch bei der Wahl am 31. August 1867 zog er nicht nur in Allenstein, sondern auch in Königsberg den Kürzeren. Dafür wählte ihn der 2. Berliner Wahlkreis bei einer Nachwahl am 22. September. Am 3. März 1871 vertauschte er diesen Wahlkreis,|obwol man ihn dort abermals wählte, mit dem von Sensburg-Ortelsburg und behielt diesen auch bei den Wahlen am 10. Januar 1874, unter Ablehnung des ihm im 3. Berliner Wahlkreise zugefallenen Mandats, inne. Der demokratische Boden des Reichstages bot ihm mehr Gelegenheit seine Gesinnungen zu bethätigen als der Landtag. Allerdings entfremdete er sich seinem ehemaligen nahen Freunde Forckenbeck, der H. vergeblich für die norddeutsche Bundesverfassung zu gewinnen suchte. H. bestand ihm gegenüber unentwegt auf der Forderung „Alles oder Nichts“. Auch Witt suchte ihn vergeblich umzustimmen und erinnerte ihn an sein früheres Dictum: „Selbst eine Despotie will ich für einige Zeit in den Kauf nehmen, wenn dadurch die Einheit Deutschlands hergestellt wird“. Obwol Witt wie Forckenbeck und der ebenfalls über Hoverbeck's Doctrinarismus entsetzte H. V. v. Unruh, der Steuerverweigerer von 1848, zur nationalliberalen Partei übertraten, so blieb doch mit diesen das Freundschaftsverhältniß bewahrt. Mehrmals hat H. im Reichstage seinem alten Gedanken der Aufhebung der Salzsteuer Geltung zu verschaffen gesucht. Es war ihm geradezu schmerzlich, als die preußische Regierung von selbst daran ging, das Salzmonopol aufzuheben, und er war offen genug, dies im Abgeordnetenhause am 1. Februar 1867 zu bekennen: „Soll dieser Mann (der preußische Finanzminister)“, so sagte er, „den ich in andern Punkten so lange bekämpft habe, soll es ihm gegeben sein, sich einen Namen in der Weltgeschichte zu machen, der noch unsern Nachkommen bekannt und von ihnen geehrt sein wird, der mit dem englischen eines Gladstone auf gleicher Linie stehen soll?“ Im Reichstage suchte er nun im September 1867 eine Beseitigung der Salzsteuer in absehbarer Zeit herbeizuführen, mußte es aber erleben, daß Forckenbeck ihm die Unthunlichkeit seines Gedankens nachwies. Am 1. Mai 1872 erneuerte er seine Wünsche. Bismarck wies ihn schroff und ungerecht zurück, indem er es als eine politische Heuchelei bezeichnete, wenn man behauptete, daß die Salzsteuer, deren Beseitigung an sich in erster Linie wünschenswerth, aber nicht gut thunlich sei, den armen Mann besonders drücke, solange man noch Brot und Fleisch besteuere. Mögen die Hoverbeck’schen Anträge auf Beseitigung der Salzsteuer nicht ganz des agitatorischen Charakters entbehrt haben, ehrlich gemeint waren sie trotzdem. Die ausgiebigste Gelegenheit fand H. im Reichstage dazu, seinen tiefwurzelnden Haß gegen den Militarismus zu bekunden. Der sieben Jahre nach den Befreiungskriegen geborene Mann bekundete dabei naive Anschauungen wie die: „Das Interesse der Völker ist es niemals anzugreifen, nach dem Interesse der Völker würde niemals ein Krieg entstehen" (17. October 1867). Dem entsprechend wünschte er die Stärke des Heeres auf ein Mindestmaß herabzusetzen, um die „Gewalthaber" zu verhindern, einen Krieg anzufangen; und doch hatte er gelegentlich (am 24. Mai 1861), als er die Anlegung eines Kriegshafens im Jasmunder Bodden befürwortete, selbst gesagt: „Die beste Deckung ist der Hieb". Am 24. April 1869 bezeichnete er die starken Friedensheere als eine Gefahr für die politische Lage und verlangte, daß der norddeutsche Bund, wenn es nicht anders einzuleiten ginge, mit der Entwaffnung beginnen sollte. „Ich glaube, daß wir mit einer derartigen Anforderung der Wehrhaftigkeit unseres Vaterlandes nicht Schaden thun.“ Mit ingrimmigem Hohne glaubte er die Bevorzugung des Adels im Heere geißeln zu müssen (19. VI. 1873). Desgleichen zog er mit Schärfe gegen die Cadettenhäuser zu Felde. „Wir haben jedes mal gefunden, daß die Internate einen gewissen Beigeschmack von Abrichtung mit sich führen“ (6. Juni 1873). Verhaßt war ihm der vermeintliche Aufwand der Diplomatie. Gerade in dieser Beziehung zeigte er sich besonders kleinlich und reizte dadurch oft genug den|Reichskanzler. Ihm schwebte wol das bekannte Wort des großen Königs zu einem seiner Gesandten vor, der sich über die geringen ihm zur Verfügung stehenden Geldmittel beklagte. Es entging ihm dabei aber, daß Friedrich II. sicher gern mehr bewilligt hätte, wenn er dazu irgend in der Lage gewesen wäre. Auf das eifersüchtigste wachte er über den Rechten und Competenzen des Parlaments. Der markanteste Act, den er in dieser Beziehung unternahm, war sein infolge der Verhaftung des Caplans Majunke am 16. Decbr. 1874 gestellter Antrag: „Behufs Aufrechterhaltung der Würde des Reichstages ist es nothwendig, im Wege der Deklaration bezw. Abänderung der Verfassung die Möglichkeit auszuschließen, daß ein Abgeordneter während der Dauer der Sitzungsperiode ohne Genehmigung des Reichstages verhaftet werde“. Die Annahme des Antrages führte zu einem Entlassungsgesuch Bismarck's, der dadurch die in jenem Falle zum Theil mit H. gehenden Nationalliberalen zu spalten beabsichtigte. Durch den bald eintretenden Tod Hoverbeck's wurde es verhindert, daß der Antrag weitere praktische Folgen hatte. Sein von keinerlei sonstigen Erwägungen beeinflußtes Festhalten an formalistischen Gesichtspunkten bekundete H. auch recht greifbar, als er vom Präsidenten Hohenlohe wiederholt Verhängung eines Ordnungsrufes über Miquel verlangte, weil dieser einen fanatischen Elsässer, der den Deutschen den Rang einer gebildeten Nation abgesprochen hatte, der Narrheit beschuldigte (23. März 1873). Nur mit Mühe fügte er sich der Autorität des Präsidenten, der den Ordnungsruf ablehnte.
Vorübergehend trat H. (1867) mit dem deutschen Kronprinzen in Berührung. Dieser sprach ihm dabei seine Verwunderung darüber aus, daß die Fortschrittspartei gegen die norddeutsche Bundesverfassung gestimmt habe. Obwol die Kronprinzessin dem sich vertheidigenden H. secundirte, scheint H., wie es ja auch in der Natur der Sache lag, auf den hohen Herrn nicht sonderlich anziehend gewirkt zu haben. Er war doch eben allzu radical und steifnackig. Gefiel er sich doch auch geradezu in der Hervorkehrung demokratischer Allüren. So bemerkte er am 12. Februar 1868, als sein Freund Löwe-Calbe von dem „chevaleresken Stolze“ gesprochen hatte, den die Abgeordneten aus Preußen bei einer Gelegenheit bewiesen hätten, trocken: „M. H., mir persönlich ist das Wort 'chevaleresk' außerordentlich zuwider. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich garnichts Chevalereskes an mir habe“. Nur „bürgerlichen“ Stolz wolle er für sich beanspruchen. Entsetzlich war es ihm, als er zu den Comitésitzungen, die im Winter 1867/68 aus Anlaß des ostpreußischen Nothstandes unter dem Vorsitz des Kronprinzen stattfanden, im Frack erscheinen muhte. Am liebsten wäre er, um diese „albernen Formen“ zu vermeiden, weggeblieben. Mit Stolz erklärte er im Abgeordnetenhause am 19. Januar 1870: „Ich bin, obgleich Rittergutsbesitzer, doch Demokrat; das ist im Sinne mancher Herren ein undenkbares Ding“.
Er nahm es von Anfang an im Gegensatz zu so vielen andern Volksvertretern äußerst ernst mit der parlamentarischen Arbeit. Bei Schluß der Session fühlte er sich regelmäßig infolge der Anstrengungen, die er sich zugemuthet hatte, tief ermüdet. Nicht zum mindesten nahmen die Fractionssitzungen, denen er fast immer präsidirte, seine Kraft in Anspruch. Völlig frei war er — eine seltene Erscheinung im Parlamentarismus — von Ehrgeiz. So lehnte er 1874 die Stelle eines Vicepräsidenten ab, obwol er vielmehr dazu berufen war als sein darauf für ihn eintretender Parteigenosse Hänel. Es war ihm ein Greuel, wenn ihm Ovationen dargebracht wurden. Interessenvertretungen verabscheute er. Auf dem Congreß deutscher Forst- und Landwirthe in Breslau im J. 1869 gab er die Erklärung ab: „Es sei Aufgabe jedes|Abgeordneten, stets für das zu wirken, was gerecht sei; kein Abgeordneter dürfe Vertreter einer einzelnen Erwerbsclasse sein, jeder habe das ganze Volk zu vertreten. Die Interessenvertreter würden zu Abgeordneten zweiter Classe herabsinken". Schon damals erregten diese Worte lauten Unwillen. Sein stolzer Unabhängigkeitssinn vermochte es nicht, das ihm im Jahre 1861 angebotene Landrathsamt in seinem Kreise anzunehmen. „Ich wäre lieber Kreisrichter, als Oberpräsident“, erklärte er, „am liebsten freilich keins von beiden“.
Bereits im Sommer 1871 sah H. sich genöthigt wegen rheumatischer Leiden nach Kissingen zu gehen. Im Juli 1875 wurde bei ihm, während er sich in Gersau am Vierwaldstätter See aufhielt, ein Herzleiden festgestellt. Diesem fiel er wenige Wochen darauf, am 12. August, an jener schönen Stätte zum Opfer. Am 22. August wurde er in seinem Geburtsort Nickelsdorf begraben. Seine Partei veranstaltete ihm in Königsberg und Berlin Gedächtnißfeiern. Im Berliner Rathhause hielt Virchow ihm die Gedenkrede. Otto Lessing schuf eine Colossalbüste von ihm. Er hinterließ keine leiblichen Kinder, sondern nur eine Adoptivtochter.
Die Parteigenossen durften mit Wohlgefühl auf Hoverbeck's knorrige „Rolandsgestalt“ blicken. Kein schöneres Lob konnte ihm von dieser Seite zu zu Theil werden, als es in der Gedächtnißrede des Königsberger Professors Möller auf ihn enthalten ist: „Jeder Zoll ein echter Demokrat, ist er durchs Leben gegangen ohne Orden und Titel“. Einen Titel hat er freilich gehabt; das Gebiet, auf dem er positiv zu wirken Gelegenheit fand, seine landwirthschaftliche Thätigkeit, brachte ihm im J. 1862 die Stellung eines Landschaftsdirectors für das Departement Mohrungen ein, die er bis zu seinem Tode innehatte. Das Wohlthuendste an seiner Erscheinung ist zweifellos die Geradheit seines Charakters, die etwas Kindliches hat. An seiner Politik, die in ihrer Unfruchtbarkeit ihres Gleichen sucht, ist der deutsche Zug erfreulich. Das Preußenthum, das er ursprünglich festzuhalten gesucht hatte, trat für ihn später ganz zurück. Er begrüßte die Kaiserwürde vornehmlich deswegen begeistert, weil sie eine „schöne Waffe gegen den altpreußischen Particularismus“ wäre. Freilich die Ebbe, die er einst dem Ministerium Bismarck prophezeit hatte, kam nicht. Seinen größten Schüler fand der kluge, arbeitsame und ehrliche, leider aber nur allzu fanatische Doctrinär, der in entscheidender Zeit, zum Handeln berufen, kraftvoll und mannhaft handelte und dadurch seinen Platz in der Geschichte erhielt, in dem ihm freilich nicht nur an Rednergabe, sondern auch an Wissen und Geist überlegenen und schließlich auch realpolitischeren Eugen Richter.
-
Literatur
Ludolf Parisius, Leopold Freiherr v. Hoverbeck. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte. 3 Bände. Berlin 1897—1900. —
Stenographische Berichte des Preußischen Abgeordnetenhauses und des Deutschen Reichstages. —
Eugen Richter, Im alten Reichstag. Berlin 1894. —
Herm. Wagener, Erlebtes II, 15. Berlin 1884. —
Philippson, Forckenbeck. Dresden und Leipzig 1898. —
Erinnerungen aus dem Leben von H. V. v. Unruh. Herausgegeben von Poschinger. Stuttgart 1895. —
Hermann Oncken, Art. Forckenbeck, A. D. B. XLVIII, 630—650. -
Autor/in
H. v. Petersdorff. -
Zitierweise
Petersdorff, Herman von, "Hoverbeck, Leopold" in: Allgemeine Deutsche Biographie 50 (1905), S. 483-492 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118775103.html#adbcontent