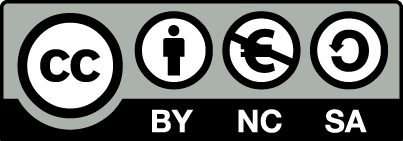Jacobs, Friedrich
- Lebensdaten
- 1764 – 1847
- Geburtsort
- Gotha
- Sterbeort
- Gotha
- Beruf/Funktion
- klassischer Philologe ; Bibliothekar ; Leiter der herzoglichen Bibliothek in Göttingen ; Philologe ; Altertumswissenschaftler ; Gymnasiallehrer ; Schriftsteller ; Übersetzer
- Konfession
- evangelisch?
- Normdaten
- GND: 117039144 | OGND | VIAF: 66498552
- Namensvarianten
-
- Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm
- Jacobs, Friedrich
- Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm
- F. J.
- Jacobs, Christian Wilhelm
- Jakobs, Christian Wilhelm
- Jacobs, Friedericus
- Jakobs, Friedericus
- Jacobs, Fridericus
- Jakobs, Fridericus
- Jacos, Konstantin Friedrich
- Jacos, Constantin Friedrich
- Jacobs, Fridrich
- Jakobs, Fridrich
- Jacobs, Fryderyk
- Jakobs, Fryderyk
- Jacobs, F.
- Jakobs, F.
- Jacobs, Friedrich Chr. Wilh.
- Jakobs, Friedrich Chr. Wilh.
- Jakobs, Christian Friedrich Wilhelm
- Jacobs, Friedrich Wilhelm
- Jakobs, Friedrich Wilhelm
- Jacobi, Friedrich
- Jakobi, Friedrich
- J., F.
- Jacobsius, Fridericus
- Jakobsius, Fridericus
- Jacobsus, Fridericus
- Jakobsus, Fridericus
- Iacobs, Fridericus
- Iacobs, Friedericus
- Iacobsus, Fridericus
- Jakobs, Friedrich
- Giakomps, Phrentrich Kristian Bilchelm
- Jacobs, Fr.
- Jakobs, Fr.
- Jacobs, Friedrich Christian Wilhelm
- Jakobs, Friedrich Christian Wilhelm
Vernetzte Angebote
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Manuscripta Mediaevalia
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Historische Mitglieder der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) [2005-]
- Mitglieder der Sächsischen Akademie der Wissenschaften (SAW) [2003-]
- * Gesamtkatalog deutschsprachiger Leichenpredigten (GESA)
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Alfred Escher-Briefedition (via metagrid.ch)
- Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800
- * Mitglieder der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW)
- * F.W.J. Schelling: Münchener und Berliner Nachlass (1811–1854)
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Archivportal - D
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- * Manuscripta Mediaevalia
- Philologisches Schriftsteller-Lexikon von Wilhelm Pökel (1882)
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Index Theologicus (IxTheo)
Verknüpfungen
Personen in der GND - familiäre Beziehungen
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Jacobs, Friedrich
-
Biographie
Jacobs: Friedrich J. Entsprossen aus einer im Herzogthum Gotha hochangesehenen Juristenfamilie wurde Christian Friedrich Wilhelm Jacobs als der zweite Sohn des Advocaten Wilh. Heinr. J. zu Gotha am 6. Oct. 1764 geboren. Nachdem er den ersten Unterricht in seinem väterlichen Hause erhalten hatte, trat er 1777 in das Gymnasium seiner Vaterstadt ein, an welchem damals durch den trefflichen Rector J. G. Geißler (Bd. VIII S. 528), der classische Unterricht im Geiste Ernestis neu belebt worden war. Einen noch größeren Einfluß auf die Geistesentwickelung des Jünglings gewann seit Geißler's Abgang nach Schulpforte (1779) dessen Nachfolger im Rectorat Fr. A. Stroth, der nicht nur durch die Lebendigkeit seines geistvollen Unterrichts alle zu Liebe und Bewunderung hinriß, sondern auch den jungen J. mit andern strebsamen Schülern zu näherem persönlichen Verkehr an sich heranzog und, wie dieser später oft dankbar gerühmt hat, „durch die freundliche Güte, mit welcher er ihn behandelte, ihn gänzlich dem Stande des Schulmannes gewann.“ Und wie Stroth's Anregung ihn schon jetzt zu ernstlicher Beschäftigung mit Pindar führte, so trieb ihn zugleich der vertraute Verkehr mit seinem begabten Freund Georg Schatz zur selbstständigen Arbeit an seiner inneren Bildung: dieser leuchtete ihm vor mit seinen klaren gedankenreichen Aufsätzen, mit ihm studierte er Lessing's Laokoon, Herders kritische Wälder, Winckelmann's Geschichte der Kunst, und „mächtig angeweht von dem Dufte des Alterthums“, der ihn in seiner classischen Denk- und Ausdrucksweise für sein ganzes Leben bestimmt hat, verfaßte er damals seine mit großem Beifall aufgenommene Schulrede „Ueber die edle Einfalt der Griechen“, welche gewiß schon den Stempel des Jacobs’schen Geistes an sich getragen hat.
Bei seinem Uebergang vom Gothaischen Gymnasium zur Universität nach Jena im Herbst 1781 wählte sich J. nicht das vom Vater gewünschte juristische Studium, sondern im Anschluß an das Vorbild Stroth's die Theologie, in der|freilich die exegetischen Vorlesungen des berühmten Joh. Jac. Griesbach vornehmlich dahin wirkten, die in ihm liegenden Gaben des Kritikers zu wecken, und ihn bald vorwiegend zu philologischen Beschäftigungen hinzogen. Besonders nachdem er „dem gefährlichen Trugbild einer eingebildeten höheren Freiheit und Würde“, welchem der lebhafte junge Mann durch seine Theilnahme an dem Verbindungstreiben der geheimen Orden und Landsmannschaften eine Zeit lang nachjagte, von der wüsten Sittenlosigkeit dieser Kreise abgestoßen, schnell wieder den Rücken gekehrt hatte, wendete er, angeregt durch die Opuscula critica von Toup, der Conjecturalkritik sein ernstes wissenschaftliches Streben zu. Er hörte die philologischen Collegia von Schütz, dem er immer freundlich verbunden blieb, und lebte in enger Studiengemeinschaft mit Imman. G. Huschke und mit dem etwas älteren Fr. K. Manso, mit welchem er für das ganze Leben durch das innigste Freundschaftsband vereinigt gewesen ist. Es ist begreiflich, daß sein damaliges Schwanken zwischen den zwei verschiedenen Lebenswegen auch das Gleichgewicht seiner heitern Seele vorübergehend empfindlich störte, und wir verstehen es, wenn ihm Manso über diese schwermüthige Verstimmung im Nov. 1782 schreibt: „Wie bin ich so froh, liebster Bruder, daß die böse häßliche Laune Dich verlassen hat! Auf dem ganzen Erdenrund muß keine Marter ärger sein, als die Marter dieser vielgestalteten Chimäre etc.“ — oder wenn J. selbst (Person. 264 f.) in Bezug auf diese Lebensperiode von der „Freundin seiner frühsten Jugend“ Auguste von Schlichtegroll, geb. Rousseau, rühmt: „wenn ich zu guter Zeit von einer düstern Sentimentalität, die mir anhing, geheilt worden bin, so ist es der Umgang mit ihr, der meine Augen für die heitern Gegenden des Lebens geöffnet hat.“
Diese Beruhigung für das ganze Leben gewann J. durch seinen entschiedenen Uebergang von der Theologie zur Philologie nach seiner Rückkehr in's väterliche Haus (Herbst 1783), wo er, während des Winters ausschließlich mit griechischer Lectüre beschäftigt, des Vaters Zustimmung dazu erlangte, sich in der Schule Heyne's für seine Wissenschaft völlig durchzubilden. So ging er im Frühling 1784 nach Göttingen, und obwohl ihm Heyne zuerst vom philologischen Studium als einem unsichern Berufswege abrieth, erwarb sich J. doch durch Ueberreichung von Anmerkungen zu Aristophanes' Vögeln und von kritischen Beiträgen zu andern Classikern bald so sehr die Achtung des großen Meisters, daß dieser ihn auf jede Weise in seinem Studium förderte und mit ihm in eine freundschaftliche Verbindung trat, welche bis zu seinem Tode (1812) ohne Unterbrechung fortgedauert hat. In Heyne's Vorlesungen und Seminar wie im anregenden Privatverkehr mit ihm hat sich J. die unverdrossene Tüchtigkeit und kerngesunde Methode der wissenschaftlichen Arbeit angeeignet, welche alle seine philologischen Werke in so hervorragendem Maße auszeichnen. Aber auch von L. Tim. Spittlers knappgedrängten, geistreichen, ebenso jedes gesuchten Schmuckes baaren als inhaltschweren und anregenden Vorträgen über Staatengeschichte hat er sich mächtige Eindrücke bis in seine späten Jahre bewahrt. Indessen war diese erfolgreiche Göttinger Studienzeit nicht von langer Dauer: schon am 29. Aug. 1785 wurde J., dessen umfassende Gelehrsamkeit auch in seiner Vaterstadt schnell die verdiente Anerkennung gefunden hatte, von Joh. Benj. Koppe, eben noch seinem theologischen Lehrer in Göttingen, jetzt Generalsuperintendenten in Gotha, in ein Lehramt am dasigen Gymnasium eingeführt, das, obwohl äußerlich nur höchst mager ausgestattet, doch durch die ihm übertragenen höheren classischen Unterrichtsfächer seiner innersten Neigung völlig entsprach und von ihm 22 Jahre hindurch mit dem segensreichsten Erfolg verwaltet worden ist. Zwar war ihm die gehoffte Befriedigung versagt unter den Augen seines verehrten Rectors Stroth seine Lehrthätigkeit zu beginnen, da dieser schon am|25. Juni desselben Jahres seinen Brustleiden erlegen war, aber der unter Geißler und Stroth zuerst eingetretene Aufschwung der Schule wurde durch Koppe's einsichtige Protephoratverwaltung dauernd befestigt und durch des neuen Directors Fr. W. Döring (Bd. V S. 289) kraftvolle Leitung seit Oct. 1786 bald zu einer ungeahnten Blüthe erhoben, die auch einem weniger hochbegabten Lehrer als J. eine freudige und gesegnete Wirksamkeit leicht gemacht hatte. Mit Döring, dessen naives mehr naturalistisches Wesen seinem tieferen und feineren Geiste zuerst wenig zusagte, gelangte er doch allmählich auch in näheren wissenschaftlichen Verkehr, wie in aufrichtige freundschaftliche Beziehungen. Von seinen Collegen war ihm schon in den eisten Jahren sein intimer Freund Manso der beste Halt; nachdem dieser 1790 nach Breslau berufen worden war, wurde ihm der neue Mathematiker Fr. Kries durch seine gründliche philologische Bildung eine stets verständnißvolle Stütze seiner Bestrebungen und durch die Lauterkeit seines Charakters ein echter Freund für das ganze Leben.
So von der Gunst der Verhältnisse getragen, konnte J. alle die herrlichen Lehrertugenden, die sich in so seltenem Maße in ihm vereinigten, so trefflich zur Geltung bringen, daß er seine Schüler unwiderstehlich mit sich fortriß und mit unwandelbarer Verehrung an sich fesselte. Durch die Macht seiner edlen Persönlichkeit ist er für alle, denen es vergönnt war in Gotha oder München zu seinen Füßen zu sitzen und einen Hauch seines idealen Geistes zu verspüren, ein Bildner und Wohlthäter geworden. In hohem Grade verdient J. unsere Bewunderung auch wegen des rastlosen Fleißes, mit welchem er von seiner ersten Anstellung in Gotha an bis in seine späte Lebenszeit die verschiedenartigen Aufgaben seiner geistigen Thätigkeit bewältigt hat. Es war das nur möglich durch die sorgsamste Eintheilung seiner Zeit, die gewissenhafteste Einhaltung seiner Arbeitsstunden, von der er bis in sein höchstes Alter nicht abgewichen ist. Erfüllt von dem höchsten Interesse für das, was er zu vollbringen sich berufen fühlte, und zugleich getrieben von der Nothwendigkeit seinen ganz unzureichenden Lehrergehalt durch Nebenverdienste zu ergänzen, wußte er, ohne seiner Berufsthätigkeit irgend etwas abzubrechen, nicht nur für zahlreiche Privatstunden, sondern auch für die mit dem J. 1786 beginnende stattliche Reihe seiner schriftstellerischen Arbeiten die nöthige Zeit zu gewinnen. Dabei führte er eine sich von Jahr zu Jahr mehr erweiternde Correspondenz und versagte sich durchaus dem geselligen Umgang nicht. Was diesen letzteren betrifft, so ist J. immer durch den Reichthum seines beweglichen Geistes, durch den lebhaften Sinn für alles Anmuthige und Schöne, durch sein rein menschliches heiteres Wohlwollen und durch die wahrhaft attische Urbanität seiner geistvollen Unterhaltungsgabe Zierde und Seele jedes edeln Gesellschaftskreises gewesen, bis er sich seit dem Eintritt seiner Schwerhörigkeit ungern zur Einsamkeit verdammte: in seinen jungen Jahren bezauberte er, wie seine Freunde immer neidlos bezeugt haben, alles durch die anregende Lebendigkeit und den seinen Humor, der ihm im Umgange zu Gebote stand. Liebenswürdigen Frauen hat er seine zarten Huldigungen gern dargebracht, schon als Jüngling in Oden und Sonetten, und wir wissen, daß der junge Professor die durch Schönheit, heitere Lieblichkeit und den Zauber ihres ganzen Wesens ausgezeichnete Amalie Seidler, die Gattin des Kriegsraths Reichardt in Gotha, mit schwärmerischer Freundschaft verehrt hat, welche noch den 76jährigen Greis bei der Erwähnung ihres Todes († 1805) schreiben ließ: „Eine andre ihres Geschlechtes von gleicher Anmuth und Liebenswürdigkeit habe ich nicht wieder gefunden! (Person. p. 64.) In ihrem Hause verlobte er sich mit ihrer jüngeren Schwester Christiane Seidler, die er am 22. Mai 1792 heimführte; aus dieser glücklichen, wenn auch durch die lange Kränklichkeit der vortrefflichen Frau getrübten Ehe entsprangen vier Söhne Josias Friedrich,Wilhelm, Gustav und Emil, der bekannte Maler, und eine Tochter, Marie, die Mutter des verdienstvollen geographischen Schriftstellers Dr. Ernst Behm.
Seit der Begründung seines eignen Hausstandes lenkte J. sein äußeres Leben, welches von den bedrängenden Sorgen des Hausvaters nicht ganz frei war, in einen noch stilleren und arbeitsvolleren Gang; er mußte es bei der beschränkten Finanzlage des kleinen Staates, dem er für so kärglichen Lohn in so ausgezeichneter Weise diente, noch als eine besondere Huld ansehen, daß der gütige Herzog Ernst II. (Bd. VI S. 308), der sich für das Gedeihen des Schulwesens in seinem Lande lebhaft interessirte und für J. ein aufrichtiges Wohlwollen hegte, ihm durch Vorstreckung eines kleinen Capitals zum Beginn seiner weitaussehenden Bearbeitung der griechischen Anthologie Luft und Muth machte (1797). Erst nachdem sich sein Gelehrtenruhm durch das rüstige Fortschreiten des großen Werkes immer glänzender ausgebreitet hatte und wiederholt vortheilhafte Berufungen an auswärtige Lehranstalten an ihn ergangen waren, kam es zu einer bescheidenen Verbesserung seiner äußeren Lage, indem ihm neben seinem Schulamt (1802) eine Stelle an der Herzogt. Bibliothek übertragen wurde, welche ihm bei mäßiger Arbeit einen Mehrgehalt von 400 Thalern und die willkommene Amtsgenossenschaft von Schlichtegroll und Hamberger einbrachte. Den bibliothekarischen Arbeiten widmete sich J. mit großer Liebe und entwickelte dabei ein solches Geschick, daß er als Bibliothekar seines gleichen suchte. Weit lästigere Geschäfte forderte von ihm (seit 1805) der seit 1804 seinem Vater Ernst II. in der Regierung gefolgte Herzog August Emil (Bd. I S. 681), dem er schon als Erbprinzen wissenschaftliche Vorlesungen gehalten hatte. Dieser geistreiche Phantast, „der Musen und der Grazien verzogner Sohn,“ hatte ihn nämlich dazu ausersehen, bei der Fertigstellung seiner excentrischen poetischen Schöpfungen hülfreiche Hand zu leisten. J. hat diesem Vertrauen nicht ohne eignes inneres Interesse und zur vollsten Zufriedenheit seines Fürsten entsprochen, aber die geniale Willkürlichkeit, mit welcher der Herzog dabei verfuhr, indem er, ohne sich an irgend eine festbestimmte Zeit zu binden, den vielbeschäftigten Schulmann und Gelehrten zu allen Tagesstunden, selbst oft aus der Schule, zu sich rufen ließ, setzten diesen nicht selten in die peinlichste Verlegenheit und machten ihm eine solche Lage, die mit seinen wichtigsten Pflichten und Aufgaben in schroffem Widerspruch stand, auf die Dauer unerträglich.
Aber wenn ihm dieser Umstand auch ohne Zweifel den Gedanken an den Uebergang in einen andern Staatsdienst nahe legen und die Ausführung eines solchen Schrittes erleichtern mußte, so konnten doch weder diese schweren geschäftlichen Hemmungen noch die großen finanziellen Mängel seiner Stellung in Gotha den besonnenen Mann zu blindem Zugreifen bestimmen, als von Baiern aus, wo der edle König Maximilian Joseph seine wohlthätigen Umgestaltungen eben auch auf das höhere Unterrichtswesen auszudehnen begann, durch die Vermittelung des Oberstudienraths Niethammer im J. 1807 an J. die officielle Aufforderung erging, als Professor am Lyceum zu München einzutreten, um durch Gründung und Leitung eines philologischen Seminars den besten Bildungselementen im Lande sichern Eingang zu verschaffen. Er bewog jedoch durch überzeugende Vorstellungen die Regierung den Seminarplan, als von einer Universität unzertrennlich, vorläufig fallen zu lassen und entschloß sich erst nach der reiflichsten Erwägung den neuen ebenso ehrenvollen als vortheilhaften Antrag anzunehmen: denn obgleich er sich nicht verhehlte, daß er seine zwar enge und bescheidne, aber festgegründete und ihm theuer gewordene Lebenslage in der alten Heimat mit einer wenn auch vielversprechenden, aber doch ungewissen Stellung in der Fremde zu vertauschen im Begriff stehe, so erkannte, er es doch als seine unabweisliche Pflicht sowohl sich selbst dem dringenden Rufe zu einer wirkungsreicheren Thätigkeit nicht zu entziehen, als auch seiner Familie die Vortheile bedeutend erhöhter äußerer Mittel und des Eintritts in einen größeren Staat nicht entgehen zu lassen. Nachdem er am 24. Oct. 1807 in einer seiner schönsten Reden, in der er sich mit begeisterten Worten besonders über die hohe Würde und die beglückende Kraft des Lehrerberufs aussprach (Verm. Schr. I, p. 93 f.), „von seiner lieben Schule“ Abschied genommen hatte, traf er als Professor am Lyceum und Mitglied der bairischen Akademie der Wissenschaften nach schwerer Reise mit seiner erkrankten Frau und seinen 5 Kindern am 3. Nov. in München ein, wo nur zu schnell in Erfüllung gehen sollte, was er am 22. Oct. ahnungsvoll an seinen Freund Manso geschrieben hatte: „Die langgewohnte sichre Bahn schließt sich mir, und eine neue thut sich auf, die mit Dunkel umgeben ist. Wie viele Anstöße, wie vieler Verdruß kann darunter laurern! wie manche tückische Fallthür kann sich unter meinen Füßen öffnen!“
Der Anfang dieser Münchener Zeit (Nov. 1807 — Dec. 1810), welche den bewegtesten Abschnitt in Jacobs' Leben bildet, war für ihn durchaus günstig und erfolgreich: der König Max sowie der Kronprinz Ludwig und der Staatsminister Montgelas nahmen ihn sehr freundlich auf; der Präsident der Akademie Fr. Heinr. Jacobi, der ihn sogleich wie einen alten Freund empfangen und ihm seinen schönen Familienkreis eröffnet hatte, führte ihn am 27. Nov. in die philologisch-philosophische Classe der Akademie ein, in der er seinen Amtsgenossen und Freund aus Gotha Fr. Schlichtegroll als Generalsecretär und als Mitglieder Männer wie Niethammer, Franz von Baader, Cajetan Weiller, Friedrich Roth, Jos. Schelling fand, mit denen sich schnell die angenehmsten geselligen Verbindungen anknüpften. Am Lyceum eröffnete er seine Thätigkeit am 7. Dec. 1807 durch die gewichtige Antrittsrede (Verm. Schr. I, S. 103 ff.), in welcher er seine idealen Anschauungen von der wahren Bedeutung und dem unvergleichlichen Werthe der Humanitätsbildung eingehend entwickelte und die Forderungen, die sie an ihre Jünger stellt, mit ergreifenden Worten beleuchtete, durch seine regelmäßigen Vorlesungen aber weckte er schnell einen frischeren Eifer für die classischen Studien und sammelte allmählich auch einen engern Kreis höher strebender Jünglinge um sich, die er in näherem persönlichem Verkehr dauernd in das Heiligthum echter Wissenschaftlichkeit einfühlte. Auch den Beginn seiner Wirksamkeit als Akademiker bezeichnete J. mit dem glücklichsten Erfolg am Stiftungstage der Akademie (28. März 1808) durch seine herrliche Festrede „über die Erziehung der Hellenen zur Sittlichkeit“, in welcher er den auf echter Religiosität und Tugend ruhenden edeln Grundcharakter des hellenischen Volkes als die wahre Quelle alles seines bewundernswürdigen Schaffens in Staatsleben, Wissenschaft und Kunst nachgewiesen hat (Verm. Schr. III, S. 3 ff., wo er in den Zugaben S. 63—374 von allen Hauptphasen und Richtungen des griech. Lebens eindringend zu handeln Gelegenheit nimmt). Noch zweimal hat er dann am Namenstage des Königs Max Joseph (12. Oct.) in der Akademie die Festrede gehalten und glänzende Zeugnisse von seiner geist- und geschmackvollen Gelehrsamkeit abgelegt, 1808 „über einen Vorzug der griechischen Sprache in dem Gebrauche ihrer Mundarten“ (Verm. Schr. III, S. 375 ff.) und 1810 „über den Reichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken“ (ebendas. S. 417 ff.), wozu er noch am 24. Oct. 1810 seine reichhaltige Schrift „über die Memnonien“ (Verm. Schr. IV, S. 3 ff.) in einer Gesammtsitzung der Akademie vorlegte.
Aber weder diese gesegnete Wirksamkeit in Amt und Wissenschaft noch das aufrichtige Wohlwollen, das ihm der König bei jeder Gelegenheit bewiesen und bis an seinen Tod bewahrt hat, noch auch die vorsichtige Zurückhaltung, mit welcher sich J., so lange es möglich war, den eigenthümlich verwickelten Verhältnissen der neuen Heimat gegenüber benahm, konnten ihn auf die Dauer|vor den übeln Folgen der hier bestehenden tiefen Zerwürfnisse sicher stellen. Das seit dem Anfang des Jahrhunderts immer stärker und systematischer hervorgetretene Streben des wohlmeinenden Max Joseph und seines klugen thatkräftigen Ministers, von Montgelas, in die unter Karl Theodor's schlechter Regierung heillos verrotteten Zustände Baierns Licht, Luft und frische Bewegung zu bringen, hatte namentlich für die Umgestaltung des höheren Unterrichtswesens die Heranziehung tüchtiger Männer aus andern deutschen Ländern nöthig gemacht, sowohl um den Lehranstalten einen neuen Aufschwung zu geben, als auch um die ganz im Verfall begriffene bairische Akademie der Wissenschaften mit gesundem Blute zu verjüngen. Die einheimischen Anhänger des alten bequemen Schlendrians empfanden dies natürlich mit dem größten Unwillen. Da sie nun gegen die Regierungsmaßregeln eine directe Opposition nicht zu machen wagten, so wendete sich ihr finsterer Groll gegen die meist aus dem protestantischen Norden berufenen fremden Gelehrten, und es bildete sich gegen diese eine altbairischkatholische Obscurantenpartei, welche hauptsächlich unter der Führung des Akademikers und Oberhofbibliothekars Freih. Christoph von Aretin, eines gewissenlosen blindfanatischen Intriganten, mit unversöhnlicher Feindseligkeit ihr lichtscheues Wesen trieb. Diesen bedenklichen Zustand der Dinge fand J. gleich bei seinem ersten Eintritt in München vor: schon Jacobis akademische Eröffnungsrede (27. Juli 1807), welche die freieren Tendenzen der neuen Akademie kräftig aussprach, war in einer giftigen Gegenschrift von Rotthamer hämisch angegriffen worden, aber J. ließ sich nicht bewegen mit einer öffentlichen Zurückweisung dieses Angriffs aufzutreten, indem er es für die Sache des Gelehrten erklärte, „nicht den Parteigeist zu nähren, sondern den Weg der Wissenschaft still und ruhig zu verfolgen“. Als aber am 27. Mai 1808 Jacobi, Jacobs und mehrere andere der fremden Akademiker durch die Verleihung des neugestifteten bairischen Civilverdienstordens augenfällig ausgezeichnet, viele Altbaiern dagegen, auch Aretin, übergangen wurden, und nun die Partei, durch diese „unverdiente Zurücksetzung“ tief erbittert zu immer gefährlicheren Feindseligkeiten schritt, da sah sich bald auch der friedliche J. in den widerlichen Kampf hineingerissen. Mit der boshaftesten Berechnung wählte Aretin den Frühling des Jahres 1809, wo durch das Einrücken der österreichischen Heere das specifische Baiernthum zu leidenschaftlichem patriotischen Selbstgefühl aufgeregt wurde, zur Veröffentlichung seiner anonymen Schrift „Die Pläne Napoleons und seiner Gegner,“ in welcher mit unerhörter Dreistigkeit den deutschen Protestanten überhaupt und den in Baiern anwesenden norddeutschen Gelehrten insbesondere die Theilnahme an einer weit verzweigten, auf England gestützten und gegen Napoleon's weltbeglückende Pläne gerichteten Liga Schuld gegeben und ihnen nicht nur fanatischer Katholikenhaß, „Anglomanie, Borussismus und Norddeutschheit,“ d. h. eine ganz verächtliche von dem vortrefflichen süddeutschen Charakter grundverschiedene Stammesnatur, sondern auch Verschwörungen gegen die französische Armee und Mordanschläge gegen den Kaiser vorgeworfen wurden. Im 'Morgenboten' wurden diese Verleumdungen im gehässigsten Sinne weiter ausgesponnen, in der 'Oberdeutschen Allgemeinen Litteraturzeitung' erschien, unter der durchsichtigen Hülle der Besprechung einer ganz fingirten Geschichte der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm unter der Regierung der Königin Christina, eine ebenfalls von Aretin verfaßte abscheuliche Satire auf die neue Gestalt der bairischen Akademie und ihre nichtbairischen Mitglieder, namentlich ihren ehrwürdigen Präsidenten Jacobi, über Jacobs streute der schamlose Verleumder während des Kriegs sogar das Gerücht aus, daß er der Verfasser der in München angehefteten Placate sei, in welchen das bairische Heer zum Abfall zu den Oesterreichern aufgefordert wurde. Der greise Jacobi, der sich durch die beispiellosen Verunglimpfungen tief verwundet fühlte, wendete sich wiederholt an den Minister Montgelas um Schutz gegen alle jene Angriffe auf seine Amtsehre, erlangte aber nur vertrauliche Versicherungen von dem ungestörten Fortbestehen des alten Vertrauens zu ihm, aber keine officielle Genugthuung durch strafendes Einschreiten gegen den Sykophanten. Der mannhafte Fr. Thiersch, der eben damals als Gymnasialprofessor nach München gerufen worden war, ergriff sogleich mit seiner schneidigen Schrift „Betrachtungen über die angenommenen Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Procumbit humi bos.“ Partei für seine Freunde gegen den Unsinn. Der ruhige J. aber stand dem schmutzigen Treiben zuerst gelassenen Muthes und schweigend gegenüber, in der Hoffnung, daß nach dem schnellen Abschluß des Kriegs die trüben Gewässer sich bald in ihre Höhlen verlaufen würden. Als aber nach seiner Rückkehr von einem Ausflug nach Gotha (Herbst 1809) die unheimlichen Angriffe sich mit steigender Heftigkeit und Heimtücke erneuerten, als eine neue Zusammenfassung aller bisherigen Beschuldigungen in der boshaftesten Form überall in München verbreitet, ja ihm selbst in's Haus getragen wurde, da hielt auch er sich nicht länger zurück: vom Kronprinzen Ludwig, auf den er in Privatvorlesungen über griechische Geschichte und Literatur einen hochverrätherischen Einfluß ausgeübt zu haben beschuldigt wurde, erwirkte er leicht die eigenhändige Versicherung, daß er diese Beschuldigung nur für eine freche Lüge erklären könne. Der Diffamationsklage, welche Jacobi gegen Aretin am 3. Febr. 1810 beim Münchener Stadtgerichte anbrachte, schloß sich J. mit Schlichtegroll, Niethammer, Hamberger und Breyer offen und amtlich an; weil er es für seine Ehrenpflicht hielt mit seinem Namen für die gute Sache des schwer verunglimpften Freundes einzutreten, wenn er auch von diesem Schritte, dessen Erfolglosigkeit er klar erkannte, bis zum letzten Augenblick entschieden abgerathen hatte; seinem eignen entrüsteten Wahrheitsgefühl aber that er zu derselben Zeit (Frühling 1810) volles Genüge, indem er in der von Becker in Gotha verlegten Schrift „über Sinn und Absicht einiger Stellen der zu München erschienenen Flugschrift: Die Pläne Napoleons und seiner Gegner“ mit vernichtender Schärfe, aber in der würdigsten Haltung die inneren Widersprüche der Aretin’schen Libelle aufdeckte und ihr raffinirtes Lügengewebe schonungslos zerriß.
Wie unerschrocken und ehrenhaft, aber auch wie maßvoll und besonnen steht J. in dieser schwierigsten Zeit seines sonst so stillen Lebenslaufes vor unsern Augen! er vermochte jedoch das lauernde Ungethüm der ungerechten Anfeindung leider mit all seinem frischen Mannesmuthe nicht ganz in den Staub zu treten, und überzeugte sich bald, daß diesen Verhältnissen gegenüber seine Stellung unhaltbar geworden sei. Am empfindlichsten war ihm, daß durch die von Aretin und seinen Gesinnungsgenossen mit beharrlicher Wuth fortgesetzten Wühlereien auch im Lyceum ihm der feste Boden untergraben wurde, indem sich allmählich bei einem Theile der studierenden Jugend eine trotzige Opposition gegen die strengeren philologischen Studien bemerklich machte, welche das bisherige schöne Gedeihen seiner amtlichen Lehrthätigkeit zerstören mußte. Die durch Uhden an ihn ergehende Aufforderung als Gymnasialrector und Universitätsprofessor nach Berlin zu kommen lehnte er zwar ab, weil die Münchener Erfahrungen ihn nicht „zu einer neuen Verpflanzung auf fremden Boden reizen“ konnten, aber dem Herzog August von Gotha, der, sobald er von den großen Widrigkeiten seiner Lage in Baiern hörte, ihn großmüthig zur Rückkehr in die Heimat einlud, gab er bald eine bindende Zusage und setzte auch beim König Max, der ihn durch glänzende Anerbietungen zu halten suchte, entschlossen seine Entlassung aus dem bairischen Staatsdienste durch (Herbst 1810). Der unversöhnliche Aretin freilich verfolgte J. noch bis zum letzten Ende seiner Anwesenheit in München mit den gehässigsten Cabalen, indem er ihn durch zwei Injurienklagen und damit verbundene hohe Cautionsforderungen, ja sogar durch einen deshalb gegen ihn erwirkten polizeilichen Arrestbefehl, an der Abreise zu verhindern suchte; das unmittelbare Einschreiten des erzürnten Königs war nothwendig, um alle diese unerhörten Hemmnisse peremtorisch aus dem Wege zu räumen. J. durste sich in der That Glück wünschen durch seine Berufung nach Gotha als Oberbibliothekar und Director des Münzkabinets, wo er am 7. Dec. 1810 wohlbehalten eintraf, vielen gefährlichen Verfolgungen enthoben zu sein, zumal als bald nachher (28. Febr. 1811) der tückische Mordversuch gegen Fr. Thiersch den Beweis lieferte, wie leicht auch ihn bei längerem Ausharren im Kampfe gegen jene fanatische Partei Frevel und Gewaltthat hätte treffen können.
Für den hier beginnenden zweiten Hauptabschnitt von Jacobs' Leben, die friedliche Gelehrtenzeit in Gotha (1810—1847), muß zunächst hervorgehoben werden, daß er die hohe Achtbarkeit seines Charakters, welche uns aus der bewegten Münchener Periode mit solcher Festigkeit entgegentritt, in all seinem weiteren Denken und Thun in der schönsten Harmonie entfaltet und bewährt hat. Seinen häuslichen Kreis stempelte sein für alles Große und Schöne begeisterter und dabei doch so milder und einfacher Sinn zu einem Muster des edelsten Familienlebens, in welchem alle höheren und geistigen Interessen die sorgsamste Pflege fanden. Der Schreiber dieser Zeilen wird es, solange er lebt, als einen unschätzbaren Segen empfinden, daß ihm in seinen jungen Jahren oft vergönnt war von dem reinen Geisteshauch berührt zu werden, der in diesem Hause wehte. Wie wenig ließ sich J. während seines spätern Lebens durch seine bedeutende Schwerhörigkeit, welche ihm die geselligen Freuden verschloß, in der immer gleich liebenswürdigen Heiterkeit des Gemüthes stören, die einen so wesentlichen Grundzug seines Charakters ausmachte! Mit wie bewundernswerther Fassung trug er als ein rechter Christ die Zeiten schwerer Trübsal, welche ihm nicht erspart geblieben sind, die mehrjährige schmerzhafte Krankheit und den frühen Tod seiner ersten Gattin (27. Dec. 1812), das langsame Hinsterben seines immer besonders geliebten Sohnes, des gelehrten Arztes Friedr. Josias J., der in der Blüthe des männlichen Alters einem epileptischen Leiden erlag (29. Juli 1833) und dem er selbst ein schönes biographisches Denkmal gesetzt hat (Person. S. 556—570), endlich den vorzeitigen Verlust seiner zweiten Gattin, der durch Geist, Herzensgüte und echte Frauenwürde gleich ausgezeichneten jüngsten Schwester seiner ersten Frau, der unvergeßlichen Dorothea Seidler (4. Febr. 1836), von der er unter dem 4. März 1836 an Thiersch schreibt: „In ihr habe ich meine älteste und bewährteste Freundin, die liebevollste Theilnehmerin an allen meinen Schicksalen, meine Hülfe in Allem verloren. Mit ihr ist der frohe Muth, den ich sonst hegte, und die Freude am Leben von mir gewichen.“ (Fr. Thiersch Leben II, 434, vgl. Person. 277.)
Mit gleicher Wärme verfolgte J. die Geschicke des deutschen Vaterlands während der welterschütternden Ereignisse seines Lebens. Wie er, gleich den Besten seiner Zeit, die ersten Anfänge der großen Umwälzung in Frankreich mit froher Hoffnung begrüßt, von ihrer wilden Ausartung sich mit Entsetzen abgewendet hatte, so folgte er zuerst mit Bewunderung, dann mit wachsender Sorge für die Sicherheit des Welttheils den Unternehmungen Napoleons: „Die Fortschritte des Eroberers von Aegypten“, sagt er selbst, „der gleich unbesieglich im Feld und im Cabinet, durch Kunst der Rede noch mehr als durch die Kraft des Schwertes gewann, lenkten meine Blicke immer von neuem auf den macedonischen König, der mir wie das Vorbild des corsischen Eroberers erschien.“ So kam J. beim Wiederausbruch des Krieges 1805, wie Niebuhr zu derselben Zeit, auf den patriotischen Gedanken, der herandrohenden Gefahr gegenüber die Feuerworte des grüßten hellenischen Redners zur sittlichen Erhebung seines eignen Volkes|wirksam zu machen, und veröffentlichte seine „Uebersetzung der Staatsreden des Demosthenes“, welche, wenn auch nur in beschränkteren Kreisen, ihre Wirkung nicht verfehlte, während sie später (1833) wissenschaftlich umgearbeitet und um die Rede vom Kranze vermehrt, so wieder erschien, daß der Verfasser von ihr sagen durfte: „diese zweite Ausgabe konnte in Rücksicht auf die Uebersetzung, die Einleitungen und Anmerkungen für eine erste gelten“ (Person. 266.) Wie tief schmerzlich seine patriotischen Empfindungen in den Jahren 1806 und 1807 gewesen sind, der Schrecken über die jähe Niederlage Oesterreichs und Rußlands, der Unwille über Preußens politische Fehler, die Entrüstung über den hohlen Hochmuth und die rohe Brutalität der Officiere der Rüchel’schen Armee und die schwere Trauer über die Demüthigung des Staates Friedrichs des Großen, das erkennt man aus allen seinen damaligen Briefen und aus seinen späteren Aufzeichnungen, aber man ersieht daraus auch ebenso deutlich, mit wie sicherem Muthe der hellsehende Mann mitten im Jammer des allgemeinen Einsturzes die Hoffnung auf bessere Zeiten fest hielt, wie unerschrocken er vielen der armen preußischen Gefangenen zur Flucht verhalf, wie dankbar er die verhältnißmäßig glimpfliche Behandlung des gothaischen Landes durch den sonst so übermüthigen Sieger als eine besondere Gunst des Geschickes anerkannte. Freilich sah sich J. während der folgenden kritischen Jahre, wie in Baiern durch die Stellung Max Josephs im Rheinbunde, so auch in seiner Heimat durch die franzosenfreundliche Haltung des für Napoleon schwärmenden Herzogs August zur strengsten Zurückhaltung in Bezug auf seine eignen politischen Gesinnungen gezwungen: das Schicksal seines langjährigen Freundes R. Z. Becker, der wegen eines freimüthigen Aufsatzes im Reichsanzeiger aus seinem Familienkreise im Nov. 1811 plötzlich weggeschleppt und bis zum Mai 1818 in Magdeburg gefangen gehalten wurde, mußte ihn noch dringender zur Vorsicht mahnen. Erst als nach der Leipziger Schlacht und nach dem großen Rückzug der Franzosen die vaterländische Begeisterung auch in den an Napoleon gefesselten Staaten zum Durchbruch kam, erst da konnte J. seinem lange mühsam zurückgehaltenen Patriotismus durch mehrere schöne Schriften lebendigen Ausdruck geben. Von diesen durch die Zeitereignisse veranlaßten Schriften sind die „Anrede eines Thüringers an seine Landsleute“ (Dec. 1813) und „Deutschlands Gefahren und Hoffnungen. An Germaniens Jugend“ (1813), in den Personalien (S. 474—498), die zur Zeit des ersten Pariser Friedens geschriebene dritte Schrift „Deutschlands Ehre. Dem Andenken der in dem Kriege gegen Frankreich gefallenen Deutschen gewidmet. Zur Feier des Friedens im Junius 1814“, in den vermischten Schriften (I, 135 bis 262) mit reichen Zusätzen wieder abgedruckt. Daß er auch nach den Freiheitskriegen bis in sein hohes Alter den Gang der öffentlichen Dinge in Deutschland mit der regsten Theilnahme verfolgt und bei allem Wechsel der herrschenden Strömungen immer sein unabhängiges Urtheil sich bewahrt hat, das beweisen zahllose Aeußerungen in seinen Briefen und Schriften. Jeder gewaltsamen Umgestaltung innerhalb der deutschen Staaten ist er in seinem strengen Rechtsbewußtsein freilich grundsätzlich feind, und die Erinnerung an Professor Heinrich's schroffe Ansichten über die Nothwendigkeit weiterer Vergrößerungen Preußens preßt ihm noch spät die Worte ab: „Möge Gott verhüten, daß je wieder solche Gesinnungen in Preußen Wurzel Magen, oder daß dort je wieder die Bahn edler Mäßigung verlassen werde, durch die sich die Regierung Friedrich Wilhelms III. die Achtung der Welt gewonnen hat!“ (Pers. p. 183); aber dem ganzen reactionären Treiben der Metternich’schen Politik sah J. mit schwerem Kummer und tiefster Entrüstung zu, wie er schon am 15. Mai 1814 ahnungsvoll an Thiersch geschrieben hatte: „Jetzt gebe der Himmel unsern Fürsten Weisheit und guten Willen, damit das begonnene Werk auch zu einem|gedeihlichen Ziele komme. Wenn Deutschland, — ich meine die Nation, — jetzt nicht das erste Land von Europa wird, so müssen unglaubliche Fehler gemacht werden!“ (Fr. Thiersch Leben, I, 117). So schreibt er an denselben in Bezug auf die beginnenden Demagogenverfolgungen, Nov. 1819 (das. I, 179): „Wie wenig ist doch das, was die Menschen aus der Geschichte lernen, selbst wenn sie vor ihren Augen geschieht!“ oder (an dens. 3. Nov. 1821, das. I, 206) über die Angst der Cabinette vor der allgemeinen Begeisterung für die griechische Erhebung: „Nichts ist von dem heiligen Brand des Freiheitskriegs zurückgeblieben als ein schmutziges caput mortuum von gemeiner Klugheit und Scheinheiligkeit.“ Noch stärker schreibt er ebenfalls an Thiersch am 2. März 1822 (das. I, 212) in Bezug auf die gegen Prof. Welcker in Bonn eingeleitete Untersuchung: „Fast sollte man meinen, in dem Katechismus des Heiligen Bundes sei Hinterlist, Lüge und Meineid unter die Tugenden gesetzt oder unter die Privilegia der Regierenden, und nur die dürften auf Gunst und Auszeichnung rechnen, die an dem Altare des Baal dienen.“ Ruhiger und objectiver als in dieser und andern brieflichen Aeußerungen entwickelt J. seine gemäßigt liberalen, überall auf gründlichster Kenntniß beruhenden politischen Ansichten in den freimüthigen Aufsätzen, welche er im ersten Band seiner Vermischten Schriften vereinigt hat; so reden die „Bruchstücke über die Forderungen der Zeit“ 1820 dem Werthe der Repräsentativverfassungen, der confessionellen Gleichberechtigung und der Preßfreiheit kräftig das Wort (p. 265—348), und in den „Analecten“ (p. 405 ff.) spricht er sich ebenso klar und gediegen als leidenschaftslos über eine Reihe wichtiger Fragen aus, vornehmlich in „Republikanismus der Zeit. Staatskrankheiten. Akademische Verbindungen. Verstimmung der Zeit. Virtus post numos.“ Bei dieser so stark ausgeprägten patriotisch-deutschen Richtung hat aber J. dem Wohl und Wehe seiner engeren Heimath ein warmes Interesse zu widmen nie versäumt, wie seine Rede zum Andenken Herzogs Ernst II. am 9. Juni 1804 beweist (mit reichen Zusätzen wieder abgedruckt in den Verm. Schr. I, 1—86), ferner die Schriften „Zufällige Gedanken bei einem dem seligen Löffler zu errichtenden Denkmale“ 1816 (Verm. Schr. I, 351 ff.) und „Gothas Dank am Schlusse der Zwischenregierung von seinen Bewohnern ausgesprochen“ 1826. Allen diesen publicistischen Schriften ist in ausgezeichnetem Maße die classische Schönheit der Form eigen, welche J. zu einem hervorragenden deutschen Prosaisten machen, formelle Meisterschaft kennzeichnet alles, was er in der eignen Sprache geschrieben hat und ziert namentlich seine zahlreichen Bildungsschriften und Erzählungen, denen er einen großen Theil seines Ruhmes in der Nation zu verdanken hatte. Den Anfang auf dieser mit so glücklichem Erfolg betretenen Bahn des ethisch-religiösen Erzählers machte er mit seinem „Allwin und Theodor“ 1802, einem Kinderbuche, welches er zunächst nur seinem ältesten Sohn Friedrich Josias zum Geburtstag bestimmt hatte. Für ein etwas reiferes Alter bestimmt folgten später die „Feierabende in Mainau“ 1820, welche anmuthigen Erzählungen zu seinen werthvollsten Geistesproducten zu zählen sind. Schon vorher (seit 1811) war in J. der Gedanke lebendig geworden „durch Religion auf Reinigung und Veredlung des weiblichen Gemüths zu wirken" und während der letzten Krankheit seiner Frau (1812) schrieb er „um ein religiöses Gemüth" zu schildern, „das bei äußeren Stürmen still und unerschüttert auf fester angeerbter Ueberzeugung ruht", die damals außerordentlich viel gelesene Schrift „Rosaliens Nachlaß", welcher er als eine Art von Ergänzung in gleichem Sinne die „Denkwürdigkeiten der Gräfin von Sandoval“ folgen ließ. Seit 1827 vereinigte er diese beiden Werke mit anderen dieselbe Tendenz verfolgenden Arbeiten zu der Sammlung „Die Schule der Frauen oder Schriften zur Belehrung und Bildung des weiblichen Geschlechts“, deren siebenter oder Schlußtheil die bedeutende Erzählung „die beiden Marien“ enthält. Die Kunst des Erzählers übte er in seinem späteren Leben mit besonderer Vorliebe und mit sichtlichem Behagen; seine in Zeitschriften zerstreuten Arbeiten dieser Gattung sind gesammelt in den „Erzählungen“, 7 Bände, Leipzig 1824—1837, von denen er selbst sagt: „In allen verfolgte ich denselben Zweck, die Heiligkeit der Sitten und das Sittliche der Religion in mannigfaltige Formen zu kleiden.“ Doch wie vielseitig sich auch J. in seiner gesammten freieren Schriftstellerthätigkeit darstellt, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß seine gelehrten philologischen Arbeiten die vornehmste Quelle seines Ruhmes gewesen sind. J. war vor allem classischer Philolog, und hauptsächlich auf seiner liebevollen Versenkung in den Geist des griechischen Alterthums ruhte seine schulmännische Tüchtigkeit, sein patriotischer Hochsinn, seine ethische Straffheit, wie seine rednerischen und poetischen Vorzüge. Die Reihe seiner gelehrten Werke, welche alle durch den gewissenhaftesten Fleiß und staunenswerthe Belesenheit nicht minder als durch die Sorgfalt der sauberen Arbeit, die Gesundheit der kritischen Methode und geschmackvolle Behandlung ausgezeichnet sind, eröffnete er mit kritischen Arbeiten, besonders über Euripides: „Specimen emendationum in auctores veteres graecos et latinos", 1786. „Animadversiones in Euripidis tragoedias, acced. animadv. in Stobaei florilegium“, 1790. „Exercitationes criticae in scriptores veteres“, 2 Tomi 1796 sq. Dazwischen besorgte er, als er eine Abschrift der Posthomerica des Tzetzes erhalten hatte, das ganze Werk des byzantinischen Grammatikers: „Tzetzae Iliaca“, 1793, und lieferte eine vortreffliche Uebersetzung des Vellejus Paterculus, 1793. Daneben beschäftigte er sich schon ernstlich mit der griechischen Anthologie, deren Bearbeitung das Hauptwerk seines Lebens werden sollte. Nachdem schon 1793 ein trefflicher Vorläufer „Emendationes in epigrammata anthologiae graecae“ erschienen war, wurde das große Werk mit ausführlichem Commentar in den Jahren 1798—1814 in 13 Bänden vollendet. Als hierauf für die Bibliothek in Gotha eine Abschrift des codex Palatinus, damals noch Vaticanus, erworben ward, ging J. an eine neue Bearbeitung des Textes, der mit kritischem Commentar „Anthologia graeca ad fidem codicis Palatini“, 1814—17, in drei stattlichen Bünden erschienen ist. Eine Blüthenlese aus dieser so viele Spätlinge enthaltenden Sammlung lieferte er 1826 in dem „Delectus epigrammatum graecorum“, welche Ausgabe eine Zierde in der von ihm und Rost ins Leben gerufenen Bibliotheca graeca Gothana bildet. Die griechischen Epigramme auch weiteren Kreisen durch eine deutsche Uebersetzung zugänglich zu machen, hatte er schon durch sein „Tempe“ (2 Bde. 1803) versucht, eine sehr wohl gelungene Uebertragung, die zwanzig Jahre später in völliger Umarbeitung und Erweiterung mit dem Titel: „Griechische Blumenlese“, 1824 (Bd. 2 der Verm. Schriften) neu erschienen ist. Eben so trefflich als diese epochemachenden Arbeiten über die griechische Anthologie sind seine mit reichen Commentaren ausgestatteten Ausgaben des Romans des Achilles Tatius, 1821, von Philostrati imagines et Callistrati statuae (mit Welcker), 1825, der Thiergeschichte des Aelianos, 1832 in 2 Bdn., die kritischen Beiträge zu Athenäos, 1805 und 1813, die köstlichen Lectiones Venusinae (Verm. Schriften V, p. 1—404), durch die er ein neues Leben in die Bearbeitung der Horazischen Gedichte gebracht zu haben überzeugt war (Personalien p. 258), die scharfsinnigen Lectiones Stobenses, 1827, endlich die herrliche Begrüßungsschrift an die Philologen-Versammlung zu Gotha: „Diatribes de re critica aliquando edendae capita duo“, 1840, die sehr bedauern läßt, daß das begonnene Werk ein Torso geblieben ist. Sehr verdienstlich sind auch seine Uebersetzungen der Werke des Philostratus, der Romane des Heliodorus, Longus, Parthenius und Antoninus Liberalis, der Thiergeschichten|des Aelianus, die von 1828 an in rascher Folge erschienen sind und schon durch die Einleitungen und Anmerkungen einen bleibenden Werth besitzen. Wie sich J. durch diese kritischen und exegetischen Werke um die bessere Kenntniß der griechischen Litteratur die größten Verdienste erworben hat, so um den Unterricht der griechischen Sprache durch sein treffliches Elementarbuch, Jena 1805 ff. in 4 Bdn., dessen einzelne Theile vielfache Auflagen erlebt und zahlreiche Nachahmungen hervorgerufen haben. Eben so verdienstlich ist sein mit Döring herausgegebenes lateinisches Elementarbuch, dessen 5. und 6. Theil, die von ihm allein verfaßte Blumenlese der römischen Dichter, ein Meisterstück in seiner Art ist. Bei seiner umfassenden Kenntniß des ganzen Alterthums und bei dem seinen Geschmack, der alle seine Arbeiten auszeichnet, verstand es J. auch, einzelne Seiten und den gesammten Charakter des antiken Lebens mit tiefdurchdringendem Geiste in schöner Form zu behandeln. Er that dies zuerst in dem zur Ergänzung von Sulzer's Theorie der schönen Künste mit seinem Jugendfreunde Georg-Schatz herausgegebenen Sammelwerk: „Charakteristik der vornehmsten Dichter aller Nationen“, 7 Bde., 1792 ff., von dem J. zahlreiche Artikel verfaßt hat. Derselben Richtung gehörten die aus dem Englischen übersetzten „Atheniensischen Briefe über die Geschichte, Sitten, Wissenschaft und Künste der alten Welt“, 1799 f., in 2 Bdn. an. Weit bedeutender sind seine zahlreichen literarhistorischen, antiquarischen und archäologischen Abhandlungen über die verschiedensten Gegenstände des classischen Alterthums, die in den Bänden 3—6 seiner vermischten Schriften gesammelt sind. Eine Ausarbeitung der Vorträge, die J. in den Jahren 1808 und 1809 dem Kronprinzen Ludwig von Baiern gehalten hat, wurde von Wüstemann unter dem Titel Hellas aus seinem Nachlaß 1852 herausgegeben.
Endlich dürfen wir auch nicht stillschweigend an dem vorübergehn, was J. als Bibliothekar in langjähriger Wirksamkeit geleistet hat. Schon in den Jahren 1802 ff., als er die Stelle an der Bibliothek zu Gotha als ein Nebenamt verwaltete, erwarb er sich durch bessere Ordnung des etwas vernachlässigten Institutes große Verdienste. Auch in München wurde seine vorzügliche bibliothekarische Befähigung dadurch anerkannt, daß ihm die Bibliothekscommission der Akademie die Prüfung des von Ign. Hardt ausgearbeiteten Katalogs der griechischen Handschriften übertrug, und er entledigte sich dieses Auftrags, ohne sich durch hämische Anfeindungen und durch die boshafte Entwendung eines Theiles seiner Vorarbeiten irre machen zu lassen, zur rechten Zeit mit dem besten Erfolge; s. den Bericht in den Personalien p. 420—453. Aber seine Hauptthätigkeit auf diesem Felde entfaltete er dann als Oberbibliothekar in Gotha (von Ende 1810 bis 1841): die Vollendung des von ihm früher begonnenen Katalogs der Manuscripte in 2 Foliobänden und die Aufstellung eines neuen systematisch geordneten in 3 Quartbänden ist sein eigenstes Werk; hier wie sonst überall in den Bücherkatalogen giebt seine saubere zierliche Handschrift Zeugniß von der Geduld und Sorgfalt, mit wecher er alle seine zahllosen Eintragungen ausgeführt hat. Ein besonders hohes Verdienst um die Gothaische Bibliothek wie um die Wissenschaft überhaupt erwarb sich J. noch in den letzten Zeiten seiner Wirksamkeit durch die Veröffentlichung des Merkwürdigsten, was diese Bibliothek an handschriftlichen Schätzen auf griechischem, lateinischem und altdeutschem Gebiete besitzt, indem er mit Fr. A. Ukert von 1835—1838 die „Beiträge zur alten Litteratur“ herausgab.
Diese so außerordentlich vielseitige und rastlose Lebensthätigkeit des seltenen Mannes verlief vorwiegend in großer äußerer Stille und Einförmigkeit, — am Schreibtisch unter den geliebten Büchern, — nur selten unterbrochen durch anregende Reisen, wie nach München im Sommer 1818, nach Italien Juli bis September 1825, auf welcher er seinen Sohn Emil bis nach Florenz geleitete und von Menschen, Natur, Kunst und Wissenschaft die wohlthuendsten Eindrücke mitbrachte (Person. 186—251), an den Rhein Sommer 1828, nach Hamburg und Göttingen 1832, und nach Dresden und Prag, um der Feier des 50jährigen Jahrestags seines Eintritts ins Schulamt (29. Aug. 1835) auszuweichen, der aber doch von Böttiger und andern Dresdner Freunden finnig begangen wurde. Wie er selbst nie unterlassen hatte seine Theilnahme an bedeutsamen Gedenktagen und Wendepunkten im Leben seiner Freunde durch litterarische Festgrüße zu bezeichnen, und wie er namentlich 10 Jahre früher seine innige Theilnahme an der dritten Säcularfeier des Goth. Gymnasiums durch die liebenswürdige „Epistola ad Fr. Guil. Doeringium senem felicissimum“, 1824, sinnig bezeugt hatte, so erfreute auch ihn jetzt die schöne lateinische Festode des nun 80jährigen Döring an diesem Ehrentage, welchen in Gotha das Gymnasium durch eine Schulfeierlichkeit mit Chr. Ferd. Schulze's Festrede öffentlich verherrlichte. Die schönste Anerkennung seiner Verdienste um die deutsche Wissenschaft fand aber J. auf der zweiten Versammlung der deutschen Philologen und Schulmänner zu Mannheim 1839, zu deren Besuch er sich nur mit Widerstreben entschlossen hatte, indem er durch eine von K. Fr. Hermann verfaßte Votivtafel als der würdige Nestor der deutschen Philologie glänzend gefeiert wurde.
Seine Schriftstellerlaufbahn schloß er mit den unserer Skizze hauptsächlich zu Grunde liegenden Personalien (Verm. Schr. Bd. 7) 1840 auf die würdigste Weise ab, mit jener musterhaften Selbstbiographie, in welcher er mit bewundernswürdiger Unbefangenheit und Klarheit den ganzen Inhalt seines reichen reinen Lebens vor der Mit- und Nachwelt ausgebreitet hat. Er konnte hier für diese letzte Periode seiner Thätigkeit von sich rühmen, daß er, von aller Geselligkeit zurückgezogen und keines Spaziergangs bedürftig, noch täglich 13 Stunden bei der Arbeit sitze; aber er hatte schon am 4. März 1836 wehmüthig an Thiersch geschrieben: „Was ich noch thun kann, ist eben nur ein Zusammenlesen in den Stoppeln oder ein Ausputzen des alten bestaubten Krams“ (Fr. Th. Leben II, 435). Seine Personalien schloß er am 2. März 1840 mit den Worten: „Der mir beschiedenen Tage können nicht mehr viele sein. Möge Gott mir verleihen, daß sie ruhig und ohne schmerzlichen Anstoß verlaufen, und wenn ich von hinnen gerufen werde, ich mit einem guten und unbefleckten Rufe bei den Zurückbleibenden und mit heitern Hoffnungen für die Zukunft scheide.“ Von diesen beiden Wünschen ist ihm der zweite im vollsten Maße, der erste nur zum Theil erfüllt worden: noch einige gute Jahre hindurch bewahrte er die alte Frische und Klarheit, dann suchten die traurigen Begleiter des höchsten Alters, körperlicher Verfall und geistige Umnachtung, auch ihn heim, bis ihn am 30. März 1847 ein sanfter Tod aus den irdischen Banden befreite.
-
Literatur
Autobiographie in S. F. W. Hoffmann's Lebensbildern berühmter Humanisten I, p. 1—27. Leipz. 1837. Personalien in Bd. 7 der Verm. Schriften 1840, einzelnes auch in den übrigen Bänden, besonders im achten, p. 335—350. Die schon oben S. 605 ff. erwähnten Streitschriften mit Bar. v. Aretin. Briefwechsel mit Heinr. Stieglitz, herausg. von L. Curtze 1863 und mit Fr. Göller, herausg. von H. Düntzer 1862. Fr. Thiersch's Leben von Heinrich Thiersch 1866. Grabrede gehalten von Oberconsistorialr. Ed. Ad. Jacobi, Gotha 1847. Heinrich Kämmel in der Pädagog. Encyklopädie III, p. 779—785. B. Hain im N. Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 1847, I, p. 244 ff. Fr. Jacobsii laudatio. Scr. E. Fr. Wuestemann. Gothae 1848.
-
Autor/in
Karl Regel. -
Zitierweise
Regel, Karl, "Jacobs, Friedrich" in: Allgemeine Deutsche Biographie 13 (1881), S. 600-612 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd117039144.html#adbcontent