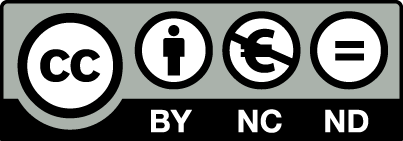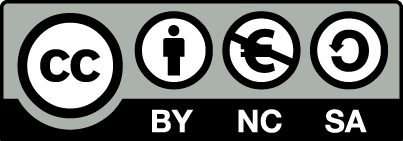Lichtenberg, Georg Christoph
- Dates of Life
- 1742 – 1799
- Place of birth
- Ober-Ramstadt bei Darmstadt
- Place of death
- Göttingen
- Occupation
- Naturforscher ; Schriftsteller ; Astronom ; Hochschullehrer ; Mathematiker ; Physiker
- Religious Denomination
- evangelisch
- Authority Data
- GND: 118572628 | OGND | VIAF: 27067718
- Alternate Names
-
- Photorin, Konrad
- Lichtenberg, Georg Christoph
- Photorin, Konrad
- Candidus, Emanuel
- Eckard, Friedrich
- Eckhardt, Friedrich
- Ehrenpreis, Paul
- Lichtenberg
- Lichtenberg, G. C.
- Lichtenberg, G. Chr.
- Lichtenberg, G. E.
- Lichtenberg, Georg C.
- Lichtenberg, Georg Chr.
- Lichtenberg, Georg Christ.
- Lichtenberg, Georg Christian
- Lichtenberg, Georg Christoph Eckardt
- Lichtenberg, Georg Kristof
- Lichtenberg, Georgius C.
- Lichtenberg, Georgius Christophorus
- Lichtenbergius
- Lichtenbergius, Georgius Christophorus
- Lihtenbergs, Georgs Kristofs
- Likhtenberg, Georg Kristof
- Lixtenberg, Georg K'ristof
- Rihitenberuku, Georuku Kurisutofu
- Lichtenberg, Georg Christof
- Photorin, Conrad
- Kandidus, Emanuel
- Lichtenberg, Georg Kristoph
- Likhtenberg, Georg Kristoph
- Lixtenberg, Georg K'ristoph
- Rihitenberuku, Georuku Curisutofu
Linked Services
- Oxford Biography Index (eingestellt) [1995-]
- * Hessische Biografie [2004-]
- Bio-bibliographisches Register zum Archiv der Franckeschen Stiftungen [1995-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1985] Autor/in: Proß, Wolfgang; Priesner, Claus (1985)
- Catalogus Professorum Gottingensium [1962]
- R. Eisler: Philosophen-Lexikon. 1912 (zeno.org) [1912]
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Heß, Wilhelm (1883)
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Manuscripta Mediaevalia
- Members of the Russian Academy of Sciences since 1724 [2017]
- correspSearch - Verzeichnisse von Briefeditionen durchsuchen [2014-]
- Behring-Nachlass digital
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Fröbel-Briefe. Personenindex der Gesamtausgabe
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Briefe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800
- Personen in den Nachschriften zu Alexander von Humboldts »Kosmos-Vorträgen«
- EGO European History Online
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- * F.W.J. Schelling: Münchener und Berliner Nachlass (1811–1854)
- Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte)
- Darstellungen aus der Medizingeschichte (Images from the History of Medicine)
- Universitätssammlungen
- * Protokolle des Bayerischen Staatsrats 1799-1817
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Manuscripta Mediaevalia
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Niedersächsische Personen
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- Biodiversity Heritage Library (BHL)
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
Relations
Genealogical Section (NDB)
- ADB 45 (1900), S. 275 (Zimmermann, Johann Georg)
- NDB 1 (1953), S. 476 (Baader, Joseph von)
- NDB 1 (1953), S. 598 (Bartels, Johann Martin Christian)
- NDB 4 (1959), S. 399 (Einsiedel, Johann August von)
- NDB 7 (1966), S. 11* (Graupner, Johann Christoph)
- NDB 9 (1972), S. 639 (Horner, Johann Kaspar)
- NDB 10 (1974), S. 661* (Juncker, Johann)
- NDB 10 (1974), S. 1 (Hufeland, Christoph Wilhelm)
- NDB 10 (1974), S. 34 (Humboldt, Alexander von)
- NDB 13 (1982), S. 456 (Lampadius, Wilhelm August)
- NDB 16 (1990), S. 328 (Marx, Karl)
- NDB 18 (1997), S. 313 (Müller, Johann Helfrich von Müller)
- NDB 18 (1997), S. 524 (Münchhausen, Gerlach Adolf Freiherr von)
- NDB 20 (2001), S. 291 in Familienartikel Pfaff (Pfaff, Johann Friedrich)
- NDB 23 (2007), S. 189 in Artikel Schmidt, Georg Gottlieb (Schmidt, Georg Gottlieb)
- NDB 24 (2010), S. 532 in Artikel Soemmerring, Samuel Thomas von (Soemmerring, Samuel Thomas von)
- NDB 27 (2020), S. 123 in Artikel Voß, Johann ( Voß, Johann Heinrich)
Places
Map Icons
 Place of birth
Place of birth
 Place of activity
Place of activity
 Place of death
Place of death
 Place of interment
Place of interment
Localized places could be overlay each other depending on the zoo m level. In this case the shadow of the symbol is darker and the individual place symbols will fold up by clicking upon. A click on an individual place symbol opens a popup providing a link to search for other references to this place in the database.
-
Lichtenberg, Georg Christoph
Naturforscher, Schriftsteller, * 1.7.1742 Ober-Ramstadt bei Darmstadt, † 24.2.1799 Göttingen (evangelisch)
-
Genealogy
V Joh. Conrad (1689–1751), Pfarrer in O., Stadtpfarrer in Darmstadt, 1750 Sup., Kirchenlieddichter (s. Strieder), S d. Joh. Philipp (1660–1739), Amtsverweser in Jägersburg b. Bensheim, u. d. Sophie Eleonore Rittberger;
M Catharina Henriette (1696–1764), T d. Pfarrers Joh. Peter Eckhard in Bischofsheim/Main u. d. Anna Margarethe Mettenius;
B →Ludwig Christian (1738–1812), Geh. Legationsrat, Physiker;
- ⚭ Göttingen 1789 Margarethe Elisabeth (1759–1848), T d. Weißbinders Kellner in G.;
4 S, 3 T (2 der K vorehelich), u. a. →Georg Christoph (1786–1845), hannov. Geh. Legationsrat, seit 1841 Gen.dir. d. Obersteuerkollegs in Hannover, →Christian Wilhelm (1799–1860), Bundesbevollmächtigter b. d. Oberzollbehörde in Stettin, Steuerdir. b. d. Gen.dir. d. Steuern in Oldenburg;
N Friedrich August Frhr. v. L. (Adel 1809, 1755-1819), Staatsmin. in Darmstadt;
E →Karl (1816–83), hannov. Kultusmin. 1862–65, dann Präs. d. Landeskonsistoriums, →Georg (1842–1906), preuß. Gen.-Major, Auguste (⚭ →Karl Thibaut, 1808–82, Prof., Bibliothekar in Heidelberg);
Groß-N Ludwig Frhr. v. L. (1784-1845), Reg.präs. in Mainz;
Ur-E →Georg Justus (1852–1908), Landeshauptm. d. Prov. Hannover. -
Biography
I
L. war das 17. und letzte Kind einer Pfarrersfamilie. Der Vater, nicht nur vielseitiger und tüchtiger Theologe, sondern auch achtbarer Verfasser geistlicher Dichtungen, praktisch befähigt als Architekt, vermittelte seinen Kindern eine „Prädilektion für Physik“, eine Anregung, die, „ob ich gleich die Einwürkung davon größtenteils aus der 2. Hand [d.h. durch die älteren Geschwister] verspürte, doch dieses Gute hatte, daß ich als Primaner gewiß mehr von Astronomie wußte, als jetzt leider! von vielen Universitäten zurückgebracht wird“ (1.1.1787 an F. W. Strieder). 1745 übersiedelte die Familie – nur fünf der Kinder hatten überlebt – von Ober-Ramstadt nach Darmstadt. Die Bestallung zum Superintendenten des Sprengels Darmstadt erreichte den Vater im März 1750, aber sein bald darauf erfolgter Tod hinterließ die Familie in beengten Verhältnissen. L. selbst litt seit frühester Kindheit unter einer rachitischen Rückgratverkrümmung, die ihn körperlich mißgebildet aufwachsen ließ (Zwergwuchs, Höcker). Diese Mißbildung wurde von Zeitgenossen und Interpreten L.s als entscheidender Faktor für dessen satirische Haltung und als Stimulans der Entwicklung seiner scharfen Intelligenz betrachtet. Zweifellos lag in der schwächlichen Konstitution des Organismus die Ursache zu einer Hypochondrie, die sich in L.s Verhältnis zur Umwelt geltend machte. Die beständige Gefährdung bedingte auch eine Neigung zur rücksichtslosen, sogar die Sphäre der Sexualität einbeziehenden Selbstbeobachtung. Solche Offenheit sich selbst gegenüber war auch der Grund dafür, daß L. in einer bekenntnissüchtigen Zeit seine Aufzeichnungen für sich behielt. So war er für die Öffentlichkeit als Schriftsteller zunächst nur Satiriker und Journalist, während er als Naturforscher bereits internationale Geltung hatte. Heute hat sich diese Bewertung von L.s Werk geradezu umgekehrt: Das Andenken an den Naturforscher ist in der Öffentlichkeit fast erloschen, und seine satirischen Veröffentlichungen, etwa im Streit mit Lavater oder auch die Hogarth-Erklärungen, teilen nicht die Einschätzung, die dem heute bedeutsamsten, damals rein „privaten“ Teil seines Werkes zukommt. Daß jedoch L.s öffentliche Tätigkeit als Naturwissenschaftler mit seinen privaten Notizen in den sogenannten „Sudelbüchern“ aufs engste verknüpft ist, ist in jüngster Zeit von der Forschung nachdrücklich hervorgehoben worden.
Bis zum zehnten Lebensjahr im Elternhaus ausgebildet, trat L. 1752 in die Tertia des Darmstädter Pädagogiums ein, einer dem Zeitideal entsprechende Gelehrtenschule. Bedeutsam wurde für den Schüler, daß er – nach Abschluß der Prima (1758) in einer Zusatzklasse, der „Selecta“, die vor den Beginn des Universitätsstudiums eingeschoben wurde – in rudimentärer Form sich mit reiner und angewandter Mathematik beschäftigen konnte, einer Disziplin, die bis ins 18. Jh. in Schule und Universität eher als peripheres Arbeitsgebiet gegolten hatte. Neben dem offiziellen Lehrbuch des Pädagogiums, Friedrich Baumeisters „Elementa Philosophiae“ (1747), studierte L. auch Abraham Gotthelf Kästners „Anfangsgründe der Mathematik“ (1758). In sie führte er auch seine Mitschüler ein. Was jedoch vollkommen außerhalb der Schulsphäre blieb, war die Vermittlung experimentell-praktischen Wissens, sei es in der Physik oder anderen Formen der „angewandten Naturlehre“. Mit Astronomie zumindest hatte sich L. während der Schulzeit als Autodidakt beschäftigt, auf der Grundlage der vom Elternhaus vermittelten Anregungen. Hervorzuheben ist, daß er sich, solange er die „Selecta“ besuchte – und diese Zeit mußte wegen der Knappheit der finanziellen Mittel der Familie über drei Jahre ausgedehnt werden –, bereits im Rahmen der öffentlichen Schulübungen in Rhetorik mit seinen künftigen Fragestellungen beschäftigte: Das freigewählte Thema einer Rede beim Schulaktus von 1760 behandelte den grundlegenden Beitrag des Studiums der Mathematik „zur wahren Förderung der menschlichen Erkenntnis“. Auch eine der ersten Publikationen L.s – „Von dem Nutzen, den die Mathematik einem Bei Esprit bringen kann“ (Hannöv. Magazin, 62. Stück, 1766) – greift gerade in ihrer satirischen Intention auf das Thema dieser Schulrede zurück. Aufschlußreich ist auch das Thema von L.s Rede zu seiner Schulentlassung (16.9.1761), die „Vom wahren Wert der Wissenschaften und der Dichtkunst“ handelte; diese und der Ruf, den er sich während der Schulzeit zu erwerben gewußt hatte, gewannen ihm wichtige Gönner für die Förderung seines Universitätsstudiums, bis zu dessen Antritt noch einige Zeit verstreichen sollte. Solange der Bruder Ludwig Christian noch in Halle studierte, konnte die Mutter für die Studienkosten eines weiteren Sohnes nicht aufkommen, und für ein Gesuch an Landgf. Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt mußte der rechte Zeitpunkt abgewartet werden. So wurde die entsprechende Petition erst im August 1762 eingereicht und im April 1763 vom Hof positiv beschieden.
Am 6.5.1763 traf L. in Göttingen ein und wurde am 21.5. als „Mathematum et Physices Studiosus“ immatrikuliert. Damit war L. an eine Universität gelangt, die in den folgenden Jahrzehnten – nicht zuletzt dank L.s eigener Tätigkeit – zu einem Zentrum deutscher Gelehrsamkeit von europäischer Bedeutung werden sollte: L.s hauptsächlicher Lehrer war der Mathematiker, Physiker und Astronom Abraham Gotthelt Kästner. Während L. zu vielen Gelehrten der Göttinger Universität im Laufe der Zeil in ein ausgesprochen geselliges und freundschaftliches Verhältnis trat, war seine Beziehung zu Kästner zeitlebens von Spannungen belastet, da dieser den Ruhm des Jüngeren mit Eifersucht und Argwohn betrachtete. Besonderes Interesse hatte L. daneben für den Unterricht der Historiker Joh. Chr. Gatterer und Aug. Ludw. Schlözer und die Vorlesungen des Juristen Gottfr. Achenwall. In freundschaftliche Verbindung trat er zu dem Philologen Adolf Klotz, dem späteren Gegner Lessings und Herders, der 1762-65 in Göttingen unterrichtete, bevor er sich von Chr. Gottl. Heyne verdrängt fühlte. Die für L. bedeutsamste Institution der Universität war die von →Tobias Mayer aufgebaute Sternwarte. Mayer hatte internationale Beziehungen angeknüpft – unter anderem zu Nevil Maskelyne, dem Leiter des Observatoriums in Greenwich –, die L. später zugute kommen sollten.
Im Jahr 1764, dem Todesjahr der Mutter, begann L. mit den Eintragungen in die „Sudelbücher“, die heute seinen literarischen Ruhm ausmachen. Sie sind kleine, später gebundene Hefte, die L. bis zu seinem Tode geführt hat und die mit Buchstaben des Alphabets bezeichnet wurden. Eine der ersten Eintragungen lautet: „Die Yoricks sind die Observatores bei der Philosophischen Fakultät dieser Welt, die man eben so nötig hat als bei Sternwarten, sie brauchen die großen Kunstgriffe allgemeine Lehrsätze zu ziehen nicht zu verstehen, nur gnau observieren müssen sie können. Was würde man von einem Observatoren sagen, der ein solches Diarium drucken ließ, den zwölften habe ich den Mond gesehen, den 13ten darauf die Sonne sehr schön, die Nacht darauf konnte man erschrecklich viele Sterne sehen pp oder der die Phases einer Sonnenfinsternis nach Vaterunsers-Längen bestimmte. Aber die meisten Schriftsteller sind weiter nichts als solche moralischen Observatoren, die einem Kenner eben so abscheulich zu lesen sind, als einem gründlichen Astronomen solche sein müßten“ (A 268). Diese Bemerkung charakterisiert den Autor sowohl in seiner Einstellung zu sich selbst wie zur zeitgenössischen Literatur, und auch das pointierte Verfahren des Gedankenexperiments, auf dem sehr viele der „Sudelbuch“-Notizen beruhen. Stilistisch gesehen sind diese Einträge nicht eindeutig einer Tradition des Aphorismus zuzuweisen, zumal dessen Definition als Gattung sowie die historische Nachzeichnung seiner Entwicklung heftig umstritten sind. Schon vom Erscheinungsbild, durch die Einbeziehung des Graphischen und die Zeichnungen, die Parallelität von Prosa und Vers, die Annäherung an die Grenzen des Sprechens in manchen Einträgen, die nur aus einem Wort bestehen können, bieten diese Notizhefte ein ungewöhnliches Bild. Formale Kennzeichnungen – Isoliertheit der Einzelaussage, Lakonismus, Ellipse, Pointierung – genügen ebenso wenig zur Charakteristik wie die Annahme eines Prinzips antisystematischer Denkformen, das allen unterschiedlichen historischen Erscheinungen aphoristischer Schreibart zugrunde liegen soll. Für die „Väter“, die man L. verordnet hat, die jüdisch-christlichen wie heidnisch-antiken Apophthegmatiker, den Erasmus der „Adagia“, Francis Bacon, den L. seit 1773 immer wieder studiert hatte, die Tacitisten sowie die französischen Moralisten, gelten so heterogene historische Bedingungen, daß von einem Bezug L.s auf sie schwerlich die Rede sein kann. Auch die Beziehung von L.s. Darstellungsweise auf die aphoristischen Formen jüngerer Zeitgenossen wie Goethe, die Brüder Schlegel, Novalis und Jochmann, ja sogar zu →Jean Paul, der häufig in die Nähe L.s gerückt wird, ist eher zufällig.
L.s Denken ist an eine bestimmte „Befindlichkeit“, körperlich, geistig, räumlich, an die Veränderungen, denen diese Befindlichkeit unterworfen ist, gebunden. Immer wieder weist L. auf die Bedeutung der Situation hin, in der er sich als „observierender Yorick“, sei es als Beobachter seiner selbst, sei es als Chronist der Umwelt, befindet: in einem Kaffeehaus in London, auf einer Schiffahrt nach Helgoland oder auf seinem Fensterplatz in seiner Göttinger Behausung (vgl. vor allem B 77: „Charakter einer mir bekannten Person“), nach einer Krankheit oder bei Abwesenheit eines geliebten Menschen. Eine solche Einstellung – und die Bedeutsamkeit dieser Einsicht zeigt sich etwa darin, daß der junge Herder in seinem „Reisejournal“ von 1769 ebenfalls einen Begriff der „Bemerkungslage“ und ihres Einflusses auf die Wahrnehmungsfähigkeit einführt – ist spezifisch an die Entwicklung der Wahrnehmungspsychologie des 18. Jh. gebunden, an Lockes und Leibniz' (in den erst 1765 publizierten „Nouveaux Essais“) Erkenntnis von der Bindung des Bewußtseins an das körperlich-sinnliche Substrat des Denkens, das selbst nicht an die Oberfläche des Bewußtseins tritt. In Deutschland hatte sich vor allem Baumgarten mit den sog. „niederen Seelenkräften“ beschäftigt (Metaphysik, 1738; Ästhetik, 1750/58) und unter anderem formuliert: Alle Erkenntnis, und vor allem die Unterscheidung von klarer und undeutlicher Wahrnehmung, beruht „auf der Befindlichkeit meines Körpers in der Welt“ (Metaphysica § 512). Von hier aus geht im 18. Jh. die Tendenz zur Individualisierung und Versinnlichung der Erfahrung, die auf die Einsichten in die anthropologische Konstitution, wie sie die Psychologie entwickelt hatte, zurückgreift. Dies betrifft vor allem die Theorien von Humor, Satire, Witz und Karikatur und deren Ausformungen in den Werken von Hogarth und Sterne, Johnson, Fielding und Wieland, den Hausgöttern L.s. Ästhetik ist deshalb in dieser Zeit Psychophysiologie.
Die ständige und ununterbrochene Aktivität des Geistes auf dem Substrat des Körpers kennt vollkommen entgegengesetzte Endpunkte, zwischen denen eine ganze Skala von Bewußtseinsstufen möglich ist: totale, strenge Ordnung des Denkens oder die konträre eines totalen Spiels mit Worten, eine beliebige, witzig Heterogenstes verknüpfende Haltung der Laune, die ein Fortdenken in gerader Linie bewußt verwirft. So wie der Körper in seiner „Befindlichkeit“ ständig Änderungen unterworfen ist, ändert der Geist durch ständige Tätigkeit, indem bewußte und unbewußte Vorstellungen ineinander übergehen, seine Einstellung zu den Gegenständen. „Eine geringe Veränderung in der gemeinsten Verknüpfung der Dinge kann unsere Abstraktion leicht so sehr verwirren, daß man mit leichter Mühe Taschenspieler-Künste aus den gewöhnlichsten Dingen herauslockt, wenn man kleine Umstände dabei verändert. […] Auf eben diese Art lassen sich oft Dinge von großer Schwierigkeit entwickeln, und mit sehr bekannten in gleiche Reihe stellen. Und leichte Sachen bekommen eine geheimnisvolle Dunkelheit, wenn man gewisse Umstände nach einem gewissen Gesetze ändert, diese beiden Methoden ließen sich mit Nutzen zur Erfindung der Wahrheit gebrauchen und die erste wäre die umgekehrte der andern, und eine Art von Integration derselben“ (A 16). Dieses Verfahren führt aber zu einer Form von Heuristik, die mit der Sprache, in der die Erfahrung geronnen ist, spielt, um die undurchsichtig gewordene Realität wiederzugewinnen. Hogarth hatte in seiner „Analysis of Beauty“ (1755) geschrieben, daß der Wechsel der Bezugsschemata einer Darstellung neue überraschende Einsichten zu Tage fördere, aber auf der Voraussetzung eines ständig erneuten Betrachtens beruhe: Aus der Anstrengung des Gedankens wird dadurch Spiel, und dies bringt in Hogarths Karikaturen die Fülle von scheinbar zusammenhanglosen Details hervor, die den Betrachter zunächst verwirrt. Sowohl L. als auch Mendelssohn, Hogarth oder Shaftesbury zitieren einen Textabschnitt aus Horaz' Brief an die Pisonen „De arte poetica“, in dem es um den Gegensatz von Naturnachahmung und Invention, also die Kunst der Erfindung neuer Wörter, geht (Verse 48-72). Hogarth macht diesen Gegensatz von „Erfindung“ eines Neuen, das die Natur deformiert und in Bereiche des Phantastischen und Karikierenden vordringt, und der Norm einer klassizistischen Nachahmung eines regelhaft Schönen zu einem Grundprinzip seiner Darstellung, trotz der bedenklichen Zerreißprobe, dem diese Norm dadurch ausgesetzt wird. Zahlreiche Notizen L.s belegen, daß er sich dieses Problems sehr genau bewußt war. „Der Fehler der neueren Schriftsteller so wohl als Künstler besteht im Übertreiben“, beginnt die Eintragung B 197; „ein gut eingerichtetes|Gefühl findet in einer Mäßigkeit die nicht nach Geiz schmeckt nur wahres Vergnügen, sobald man es aus diesen Grenzen führt, so läßt sich immer fragen, warum gehen wir nicht weiter heraus. Es gibt eine Art des Übertriebenen, in welcher alles recht ist, und deswegen ist es für alle seichte Köpfe so gemächlich.“ Nur Leute, die sich durch die „holden Liedgen“ der Anakreontik verbilden ließen, „sind für all dasjenige Schöne, das sich nicht mehr durch holde Diminutivgen ausdrücken läßt, verloren“. Eine Ausgrenzung der Phänomene des Lächerlichen, Ornamentalen, Satirischen oder der Karikatur aus dem Bereich der Kunst kann nicht durch einen konstruierten Gegensatz von Vergnügen und Geschmack gerechtfertigt werden: „Dem Weisen ist nichts groß und nichts klein, zumal zu der Zeit wenn er philosophiert, wo ich allemal voraussetze, daß es ihn weder hungert noch durstet, noch daß er seine Dose vergessen hat, wenn er schnupft. Alsdann könnte er glaube ich Abhandlungen über Schlüssellöcher schreiben, die so wichtig klängen als ein Jus naturae und eben so lehrreich wären. In den kleinen alltäglichen Pfennigsbegebenheiten steckt das moralische Universale eben so gut als in den großen wie die wenigen Adepten wohl wissen. In einem Regentropfen steckt so viel Gutes und Künstliches, daß man ihn auf einer Apotheke unter einem halben Gulden nicht lassen könnte“, lautet der Beginn von B 195.
Auf dieser anthropologischen und ästhetischen Grundlage beruht die Festsetzung des „Wahlspruchs Whim “, die in „Sudelbuch“ B (343) unter dem Datum 10.12.1770 festgehalten ist: „Denn ist es nicht Whim in dieser Welt einmal sein wollen was wir sein wollen, was wir sein sollen. Wir sind immer etwas anderes das von den Gebräuchen der Vor- und Mitwelt abhängt, ein leidiges Accidens eines Dings das keine Substanz ist. Ist denn die menschliche Natur ein Ding das seinen Kopf im Paradies und seinen Schwanz am andern Ende der Ewigkeit hat und dessen Glieder Homöomerien des Ganzen sind?“ Diese Ausgangslage des Menschen als eines „vermischten Wesens“, das „zwischen den geistigsten Aussichten und den sinnlichsten Empfindungen in der Mitte [hängt]“ (B 263), fordert ihn aber dazu auf, um die Herrschaft über die disparate Kombination von Körper und Geist nicht zu verlieren, einzig sich selbst zum Richter seiner Anschauungen und Handlungen zu machen und dazu die eigenen Erfahrungen zur Richtschnur zu nehmen: „Bei unsrem frühzeitigen und gar zu häufigen Lesen […] bedarf es oft einer tiefen Philosophie unserm Gefühl den Stand der ersten Unschuld wiederzugeben, sich aus dem Schutt fremder Dinge herauszufinden, selbst anfangen zu fühlen, und selbst zu sprechen und ich mögte fast sagen auch einmal selbst zu existieren“ (B 264). Man kann in dieser Behandlung der Frage nach der Wirklichkeit und Geltung der Erfahrung, ihrer Reduktion auf individuelle Gewißheit und der dabei in Kauf genommenen Aufspaltung des individualisierten Wissens, nicht bloß eine Vorwegnahme von Kants späterer Definition der Aufklärung, ein Bekenntnis zum Wagnis des Wissens an sich sehen. Gerade die Notizen der ersten beiden „Sudelbücher“ A und B (1764–71 bzw. 1768-71) und das „Füllhorn der Amalthea“ (Kέρας Ἀμάλϑειας, geführt 1765-72) reflektieren intensiv eine bestimmte Philosophie- und wissenschaftsgeschichtliche Situation, in deutlicher Parallele zum Frühwerk Herders, besonders dem 1764 Kant gewidmeten philosophischen „Versuch über das Sein“, in dem Herder das bloße Gefühl des Daseins, das der Mensch mit den Naturdingen gemeinsam hat, als „fast theoretischen Instinkt“ einerseits, andererseits zugleich als „unzergliederbaren“ und „unbeweisbaren […] Mittelpunkt aller Gewißheit“ bezeichnet hatte, und der Abweisung aller nicht-sinnlichen Erfahrung im „Reisejournal“. 1763 hatte die Berliner Akademie der Wissenschaften eine Preisfrage nach der Rolle der Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften ausgeschrieben, an deren Beantwortung sich neben Kant, Joh. Heinr. Lambert und →Thomas Abbt auch →Moses Mendelssohn mit seiner 1764 preisgekrönten Abhandlung beteiligt hatte. In allen Beiträgen wurde die Krise der Metaphysik als Wissenschaft sichtbar, alle betonten die Notwendigkeit, Naturerscheinungen immanent zu erklären, keiner Methode ungeprüft eine Vorrangstellung zu geben, auch der mathematischen nicht; der Mensch mußte in das System der Natur integriert und gleichzeitig seine Sonderstellung in ihr als reflexives Wesen problematisiert werden. Wenn sich die Realität nicht mehr in die von der cartesianischen Methodik geforderten Erkenntnisteile zerlegen ließ, um dann in strenger Logik vom Einfachen zum Komplexen hinauf wieder zusammengesetzt zu werden, mußte das Wissen über die Natur und die menschliche Wirklichkeit fragmentarisch erscheinen. Die von Mendelssohn in dieser Situation geforderte Überprüfung der sinnlichen Erfahrung, wird, wie L. – gleichzeitig mit Herder im vierten der „Kritischen Wälder“ – hervorhob, allerdings dadurch erschwert, daß gerade die Erfahrungsbegriffe einen grundsätzlichen Mangel an sich haben: „Es ist ein ganz unvermeidlicher Fehler aller Sprachen daß sie nur genera von Begriffen ausdrücken, und selten das hinlänglich sagen was sie sagen wollen. Denn wenn wir unsere Wörter mit den Sachen vergleichen, so werden wir finden daß die letzteren in einer ganz andern Reihe fortgehen als die erstern“ (Beginn von A 118). Dieses Problem der fehlerhaften Verknüpfung theoretischer Konzeptionen mit der empirischen Welt, auf die sie angewandt werden, spielte dann in L.s Antrittsvorlesung eine bedeutsame Rolle.
1767 hatte L. sein Studium abgeschlossen, ohne formale Bestätigung, da Prüfungen noch nicht üblich waren (erst 1778 wurde ihm ehrenhalber der Titel eines Magisters verliehen). Darauf erhielt er vom Landgf. Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt die Berufung zum 2. Professor für Mathematik an die Univ. Gießen. Um weiter in Göttingen praktisch zu arbeiten (vor allem an Experimenten mit Elektrizität und an astronomischen Beobachtungen an der Sternwarte, die nach Mayers Tod 1762 Kästner übernommen hatte), ließ L. sich jedoch für zwei Jahre beurlauben, ohne seine Gießener Bestallung zu lösen; dies war die Grundlage für einen Konflikt, der bei der späteren Berufung L.s zum Professor in Göttingen ausgetragen werden sollte. Gleichzeitig betreute er drei junge engl. Adelige während ihres Göttinger Studiums als Hofmeister. Diese Tätigkeit veranlaßte seine erste Reise nach England, die unter anderem über Utrecht, Den Haag und Scheveningen führte; am 10.4.1770 traf er in London ein. Empfohlen durch ein Schreiben Kästners, der L.s Anteil bei der Observierung des Durchgangs der Venus durch die Sonne am 3.6.1769 hervorgehoben hatte, und durch die Verbindungen, die die Eltern seiner Zöglinge zum Königshof hatten, wurde L. von Kg. Georg III., einem leidenschaftlichen Amateurastronomen, auf der Sternwarte in Richmond empfangen. Damit waren die Weichen für seine Zukunft gestellt: Nach der Rückkehr nach Göttingen (Mitte Mai) wurde L. auf Antrag des Kurators der Universität, Gerlach Adolf Frhr. v. Münchhausen, der die Berufungspolitik der Georgia Augusta jahrzehntelang mit großem Geschick gehandhabt hatte, am 30.6.1770 zum ao. Professor für Philosophie ernannt. Die bestehende Bindung an Gießen wurde dabei sowohl von der Universität wie von L. ignoriert; erst im Jan. 1771 scheint man bei den hess. Stellen in Darmstadt und Gießen hellhörig geworden zu sein. Im März erhielt L. die Aufforderung, sein Gießener Amt unverzüglich anzutreten, und auch die Regierung in Hannover wurde aufgefordert, das Vertragsverhältnis, das L. widerrechtlich eingegangen sei, zu lösen. Vermutlich wurde der Konflikt durch Intervention des Königs bei dem neuen hess. Landgrafen Ludwig IX. bereinigt. Zu Beginn des Wintersemesters jedenfalls hielt L. seine Vorlesungen über das von dem Mathematiker Nicolaus Bernoulli 1713 gestellte sog. „Petersburg-Problem“ (s. Teil II). Das zur Einladung gedruckte Programm mit dem Titel „Betrachtungen über einige Methoden eine gewisse Schwierigkeit in der Berechnung der Wahrscheinlichkeit beim Spiel zu heben“ (1770) enthält in der Einleitung eine Reihe von Hinweisen, wie L. seine Beschäftigung mit den Naturwissenschaften betrachtete und wie er deren methodische Situation reflektierte: „Der Meßkünstler findet nicht selten bei der Anwendung seiner Schlüsse auf die Natur, merkliche Abweichungen von dem, was er nach seiner Rechnung hätte erwarten sollen. Es ist nicht sehr schwer den Grund hiervon im allgemeinen anzugeben, und einzusehen, daß es nicht die Schuld der Mathematik sein kann. Er abstrahiert sich gleichsam von dieser Welt eine eigne, von welcher er die Gesetzbücher gleichsam selbst in Händen hat.“ Die Skepsis bezüglich der Möglichkeit, die in der idealen Welt der Mathematik mögliche Klarheit auf die Welt der Empirie zu übertragen, die er hier äußert und die sich auf seine experimentelle Praxis auswirken sollte, greift nicht nur auf Mendelssohns Evidenz-Problematik, sondern auf ein Problem der Baconschen Naturwissenschaften zurück, das durch Newtons Behauptung, ohne hypothetische Vorgaben zu arbeiten, zu Beginn des 18. Jh. erledigt geschienen hatte. Bacon hatte im „Novum Organum“ geschrieben, daß der Mensch durch seine Konstitution immer wieder verleitet werde, seine Interpretation mit der Beschaffenheit der Naturgegenstände selbst zu verwechseln und dadurch seine Beobachtungen zu verfälschen. Der Ausweg aus diesem Dilemma ist, nach Condillac (Traité des systèmes, 1749) und Albrecht v. Haller (Einleitung zur deutschen Ausgabe von Buffons „Histoire naturelle“, 1750), der vorsichtige Gebrauch von Hypothesen. Noch mehr als diese ist sich L. der heuristischen Hindernisse bewußt, die sich bei der experimentellen Untersuchung eines Phänomens ergeben.|Dies zeigt deutlich eine Reihe von Eintragungen am Ende des „Füllhorn“-Buchs (301–42), von denen die eiste sogar die Identität des betrachteten Objekts in Frage stellt: „Ist es würklich das oder sind nicht viele andere Dinge damit verknüpft, die uns scheinbar verschwinden“ (301). Immer wieder tauchen zwischen Serien von präziseren Fragen nach Beschaffenheit und Zweck des Gegenstands Fragen auf, die seine Identität mit einem realen Objekt in Frage stellen oder die Alternative aufwerfen, ob hier nicht nur etwas verhandelt werde, was seinen Ursprung bloß „in der menschlichen Natur“, gewissermaßen in einer Sinnestäuschung, habe.
Unter solchen Voraussetzungen begann L. sein Wirken als akademischer Lehrer zunächst mit Vorlesungen über Mathematik und Astronomie; 1772/73 unterbrach er jedoch seine Tätigkeit, um im Auftrag des engl. Königs astronomische Ortsbestimmungen im Kurfürstentum Hannover durchzuführen, zunächst in Osnabrück, dann in Stade, von wo aus er Hamburg und Helgoland besuchte. Neben zahlreichen Briefen aus dieser Zeit, unter denen diejenigen an seinen Hausherrn, Freund und Verleger Dieterich und dessen Frau Christiane an unmittelbarem Ausdruck und Intensität der Empfindung hervorstechen, entstand „Sudelbuch“ C. Wichtig ist, daß L. auf seinen Reisen einige der Größen der künftigen Literatur kennenlernte, deren generelle Tendenz er später ablehnte, so Herder in Bückeburg, Möser in Osnabrück (1772), im folgenden Jahr Sturz und Klopstook. Die von ihm bevorzugten Schriftsteller sind Kästner, Wieland, Sterne und Shakespeare (B 321). Besonders über den zeitlebens umstrittenen Wieland hat L. sich voller Bewunderung geäußert. 1773 begannen die Einträge in „Sudelbuch“ D (August 1773-Mai 1775), und es erschien seine erste Schrift gegen Lavater, „Timorus“, in der L. unter dem Pseudonym „Conrad Photorin“ gegen dessen Proselytenmacherei und vor allem die Bekehrungsversuche an →Moses Mendelssohn zu Felde zieht. In der Tradition der scharfen Personalsatire Liscows denunziert er Lavaters religiöse Schwärmerei, indem er ihn übertrieben in Schutz nimmt. Noch im selben Jahr übernahm es L., die nachgelassenen Schriften Tobias Mayers zu edieren; von dieser Ausgabe erschien 1775 nur ein einziger Band (die übrigen Texte wurden erst 1972 ediert). Am 15.4.1774 wurde L. zum ao. Mitglied der Göttinger Sozietät der Wissenschaften ernannt; am 29.8. desselben Jahres brach er zu seiner zweiten Reise nach England auf.
Der Englandaufenthalt von beinahe 16 Monaten bildete einen Höhepunkt in L.s Leben: Der König empfing ihn erneut und führte ihn in seinen Familienkreis ein, wo er fortan häufiger Gast war. Er begegnete Reisegefährten James Cooks: Joseph Banks und dem Botaniker Solander, die an der ersten Expedition teilgenommen hatten, und vor allem den deutschen Begleitern auf der zweiten Reise Cooks, Joh. R. und →Georg Forster; mit letzterem sollte ihn eine lebenslange Beziehung verbinden. Er machte die Bekanntschaft des Chemikers und Physikers Joseph Priestley, Verfasser einer „History of Electricity“ (1770), und die des Erfinders der Dampfmaschine, James Watt. Im Dezember wurde einer seiner „vorzüglichsten Wünsche“ erfüllt: David Garrick in der Rolle Hamlets sehen zu können. Seine Eindrücke, zunächst in seinem privaten Reisetagebuch festgehalten, veröffentlichte er später in den „Briefen aus England“ in Christian Heinrich Boies Monatsschrift „Deutsches Museum“ (1776). Die Erfahrung des Lebens in London schlug sich in einem Brief an Baidinger nieder, in dem L. die belebte Kreuzung Cheapside/Fleetstreet an einem Januarabend beschreibt – die „erste Großstadtschilderung der deutschen Literatur“ (Promies). Außerhalb Londons besuchte L. die Fabriken Birminghams, die ihm einen Eindruck vom Stand der industriellen Revolution des 18. Jh. und dem Anteil der Naturforschung an dieser Entwicklung vermittelten, und die Seebäder Margate, Brighton und Bath. Dieser Besuch wirkte noch in dem 1793 im Göttinger Taschenkalender veröffentlichten Aufsatz nach, der den Titel trägt: „Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad?“ L.s Vorschläge führten 1816 zur Errichtung des ersten bedeutenden Seebades in Cuxhaven. Zu den weiteren wichtigen Bekanntschaften, die L. in England machte, gehörte der Geologe Jean-André de Luc. Neben dem Reisetagebuch von 1774/75 und den Reise-Anmerkungen von 1775 (hrsg. v. H. L. Gumbert 1979) führte L. seit Juli 1775 „Sudelbuch“ E (bis April 1776). Bereits im Jan. 1775 hatte der König Anweisung gegeben, L. zum ordentlichen Professor zu ernennen (zusammen mit dem Studienfreund J. Ch. P. Erxleben und dem Philosophen Ch. Meiners). In dieser Funktion kehrte L. am 31.12.1775 nach Göttingen zurück, wo er seßhaft bleiben sollte, abgesehen von einer Reise nach Hamburg und Helgoland, die er im Juni 1778 mit|seinem Verleger und Freund Dieterich unternahm.
Von nun an verlief L.s Leben in den engen Bahnen des Universitätsbetriebes. Seit dem Sommersemester 1778 las L. – nach dem Tod Erxlebens 1777 – Experimentalphysik und erregte durch seine Versuchsreihen Aufsehen; seine Kollegien verzichteten in einer für die Zeit bemerkenswerten Weise auf jede Buchgelehrsamkeit. L.s Leistungen wurden, nachdem ihn die Göttinger Sozietät bereits im Dez. 1776 zum o. Mitglied ernannt hatte, durch eine Reihe von Auszeichnungen gewürdigt; 1782 wurde er Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 1793 ehrte ihn die Royal Society und 1795 die Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg durch die Aufnahme unter ihre Mitglieder.
Neben den zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf den Gebieten der Astronomie, der Elektrizitätslehre, der Theorie der Gase entfaltete L. eine rege journalistische Aktivität. Seit 1777 gab er, als Nachfolger Erxlebens, für Dieterich den „Göttinger Taschen Calender“ heraus (bis zu seinem Tod), in dem von 1784 an Erklärungen zu Köpfen Hogarths erschienen. 1794-99 erschienen in fünf Lieferungen seine „Ausführlichen Erklärungen der Hogarthischen Kupferstiche“, in denen er fünf Zyklen des Malers und Graphikers ins sprachliche Medium der Satire umsetzte. 1780-85 gab er zusammen mit Gg. Forster das „Göttingische Magazin für Wissenschaften und Literatur“ heraus. Zu seinen größeren einzelnen Arbeiten zählen biographische Darstellungen von Copernicus (1800), James Cook (Einige Lebensumstände von Capt. James Cook, größtenteils aus schriftlichen Nachrichten einiger seiner Bekannten gezogen, 1780) und möglicherweise eine Biographie Lamberts, deren Echtheit von der L.-Forschung entschieden bestritten wird (Leben der berühmtesten vier Gelehrten unseres Philosophischen Jahrhunderts, Rousseau's, Lambert's, Haller's und Voltaire's, 1779, S. 27-53), das schöne Bekenntnis zum Deismus in „Amintors Morgen-Andacht“ (1791) und schließlich die „Fortsetzung der Betrachtungen über das Weltgebäude“ (1781). Im Zentrum der ersten Jahre seiner Tätigkeit als Satiriker steht jedoch die Polemik gegen Lavaters Physiognomik. In England hatte L. den ersten, 1775 erschienenen Band der „Physiognomischen Fragmente zu Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe“ (4 Bde., 1775–78) zu Gesicht bekommen, und wenn ihm, dem physisch Entstellten, etwas Pein bereiten konnte, dann war es diese Doktrin von dem Ausdruck der Schönheit der Seele in den schönen Proportionen des Kopfes und der Vollkommenheit der Gesichtszüge, die Lavater noch mit dem Hinweis auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen zu untermauern suchte. Trotzdem beherrschte L. in seinem Aufsatz „Über Physiognomik“ (1778) noch seine Neigung zum Sarkasmus, indem er einige ernsthafte Vorschläge zu dem von Lavater in der Tradition Giovanni della Portas aufgeworfenem Problem machte: Während er die Grundthese Lavaters als das eigentliche und sinnlose physiognomische Vorgehen bezeichnete, weil es, nur an Oberflächen haftend, dem Zufall der äußeren Erscheinung eine innere und zugleich moralische Notwendigkeit zusprach, akzeptierte er eine Lehre von einer „Pathognomik“, einer „Semiotik der Affekte“ oder „Kenntnis der natürlichen Zeichen der Gemütsbewegungen“. Die Konzeption dieser „Pathognomik“ basiert auf der anthropologischen Konzeption von David Hartleys „Observations on Man“ (1749), die den moralischen Schluß verwehrte, ohne die Beziehung des Inneren und des Äußeren zu leugnen: „Wenn das Innere auf dem Äußeren abgedruckt ist, steht es deswegen für unsere Augen da? und können nicht Spuren von Wirkungen, die wir nicht suchen, die bedecken und verwirren die wir suchen? So wird nichtverstandene Ordnung endlich Unordnung, Wirkung nicht zu erkennender Ursachen Zufall, und wo viel zu sehen ist, sehen wir nichts“ (Ausg. Promies, III, S. 265). Die törichte Antwort, die Lavater im 1778 erscheinenden 4. Band auf L.s Einwände gab und in der er sich die Attribute des methodisch vorgehenden Erfahrungswissenschaftlers zuschrieb, also Kriterien, mit denen L. seine Kritik begründet hatte, während er im selben Band zugestehen mußte, daß ihm die Anatomie keinerlei Anhaltspunkte für seine Theoreme hatte liefern können, provozierte L. zur wirkungsvollsten seiner Satiren, dem „Fragment von Schwänzen“ (1783), in der er das Verfahren seines Gegners, mit Illustrationen, an einer Reihe von Sauschwänzen und Burschenzöpfen vorexerzierte, mit schlagendem Erfolg. Auch frühere Freunde Lavaters, vor allem Herder und Goethe, die daran mitgearbeitet hatten, rückten nun von Konzeption und Ausführung des Werkes ab und gesellten sich zu den Kritikern, wie Nicolai, Musäus oder Klinger.
Die Debatte mit Lavater war für L. jedoch mehr als bloß das Austragen einer Fehde|bis zum Sieg über den Gegner oder die Selbstbestätigung, die er brauchte, um die Verletzung zu überwinden, die dieser ihm zugefügt hatte. Ihre Bedeutung steht im Zusammenhang mit der Entwicklung der deutschen Literatur, der Tendenz der Genie-Ästhetik, an deren Ausbildung Lavater so großen Anteil hatte; ihre Werke waren für L. Schwärmerei und ein besorgniserregendes Indiz für die Zukunft: „Ich begreife gar zu wohl, daß es Leute gibt, denen ihre Einbildungskraft und ihre Schwärmerei nicht einen Augenblick Zeit läßt etwas vorsätzliches Böses zu tun, allein sie tun ihre Portion desto reichlicher ohne Vorsatz aus guter Absicht, von – ich sage es nicht gerne – von einem schwachen Kopf gelenkt“ (F 809, Anfang). Sarkastisch bemerkt L. (in E 501): „Jedermann kennt die Würkung der Trommel, sie erhebt unser ganzes Wesen, und neben dem Zapfenstreich herlaufen ist kein geringer Genuß“, um die Leere, den Mangel an Neuheit, an Invention bei den Stürmern und Drängern zu brandmarken. Die Metapher vom Genie als Strom möchte er „bei Strafe des Stranges“ verbieten (E 501), der junge Goethe ist ihm nur jemand, der als Nachfolger Shakespeares posiert (F 1), statt Homer und Ossian zu studieren, rät er dieser Autorengeneration: „Studiert euch selbst erst, mögt ich sagen, das ist, lernt euer Gefühl entwickeln […] Die Natur steht euch allen offen mehr als irgend ein Buch […]. Ihr seids selbst. Dieses hat man so oft gesagt, daß es jetzt fast so gut ist, als wäre es niemals gesagt worden. Es ist ein Unglück, wenn Regeln von solcher Wichtigkeit unter einem Volk zu der traurigen Würde eines locus communis oder einer Gebets-Formel gedeihen“ (F 734). Die einzige interessante Erscheinung auf dem Schauplatz der Literatur ist für L. →Jean Paul, trotz der Zügellosigkeit, die er an dessen Werk moniert (L 589).
Über die innere Geschichte der zweiten Lebenshälfte L.s in Göttingen gibt eine Reihe von Sudelbuch-Eintragungen und Privataufzeichnungen Auskunft, über die starken Stimmungs- und Gesundheitsschwankungen, unter denen er litt, über den Kontakt mit dem Freundeskreis und seine privaten Affären; denn an Liebschaften fehlte es keineswegs. Die schönste und tragischste widerfährt L. mit dem Blumenmädchen Maria Dorothea Stechardt, dem er als zwölfjährigem Kind 1777 begegnet; er nimmt es im folgenden Jahr in sein Haus auf, und sie leben zusammen „wie Mann und Frau“. Der Brief an G. H. Amelung von Anfang 1783, in dem er sich den Tod des Mädchens (am 4.8.1782) ins Gedächtnis zurückruft, gehört zu den erschütterndsten Briefen der deutschen Literatur. Walter Benjamin hat ihn 1936 an den Beginn seiner Briefsammlung „Deutsche Menschen“ gestellt. Seit 1783 war Margarethe Elisabeth Kellner im Dienst L.s, die er 1789 – zwei Kinder hatte sie ihm bereits geboren – heiratete. Zu den Besuchern L.s zählten viele berühmte Persönlichkeiten, Naturforscher und Dichter: Lessing, Wieland, selbst Goethe und Lavater, Garve, Pieter Camper, Sömmering, Volta und Herschel waren Gäste im Kreis der Göttinger Kollegen und Freunde L.s.
Die letzten Lebensjahre brachten nochmals erstaunliche Veränderungen in den Ansichten und in der literarischen Produktion des Autors L.: Geistig wandte er sich von der deistisch temperierten Annahme der Philosophie Spinozas ab und der Kantischen Philosophie zu, wobei fraglich bleibt, wieweit sich die Grundposition L.s, nach ihrer frühen Ausprägung einzig durch die Begegnung mit Hartley modifiziert, tatsächlich geändert hat, ob die Annahme der Kantschen Resultate tatsächlich einer Anerkennung der Kantschen Systematik gleichzusetzen ist. Sehr viele der Eintragungen der letzten Jahre in den „Sudelbüchern“ J (1789–93), K (1793–96) und L (1796–99) evozieren die Evidenzproblematik, welche schon B gekennzeichnet hatte. Seit Ende der achtziger Jahre führte L. neben „Sudelbuch“ G (1779–83), H (1784–88) und dem „Goldpapierheft“ (Winter 1789) ein (nur teilweise publiziertes) Tagebuch, seinen „Staatskalender“, in dem er die äußeren Ereignisse verzeichnete. In diesen letzten Lebensjahren der Melancholie und Depression erstaunt jedoch, daß L. den Plan faßte, nochmals die Bühne der Literatur mit einem Roman zu betreten: „Der doppelte Prinz“ sollte der Titel lauten und der Roman die Entwicklungsgeschichte siamesischer Zwillinge enthalten; wenn sich von dem Fragment her urteilen läßt, kommen als Anregungen Grundkonzepte der Hartleyschen Anthropologie, als Modell eventuell Samuel Johnsons „History of Rasselas“ in Frage, und Ziel dürfte es gewesen sein, seine Ideale darzustellen, die er bereits 1770 in den „Dienbaren Betrachtungen für junge Gelehrte in Deutschland, hauptsächlich auf Universitäten“ dargelegt hatte und deren Bestand er durch die Entwicklung der Literatur bedroht sah. Aber statt dessen lieferte L. mit seinen Hogarth-Erklärungen, unter anderem der Zyklen „The Rake's Progress“, „The Harlot's Progress“ und „Industry and Idleness“, Kabinettstücke satirisch-poetischer Beschreibung. Bedeutsam ist daran vor allem, daß L. hier – in seinem ganzen Sprachduktus christliches Material verarbeitend – eine säkularisierte, das Modell von John Bunyans „Pilgrim's Progress“ ins Gegenteil verkehrende Version bürgerlich-christlichen Denkens gab, bei dessen Moral er sich keineswegs beruhigte, wie seine „Konversion“ zum Kantianismus vielleicht suggerieren könnte.
Auf eine fingierte Bemerkung eines Lesers, der ihm vorwirft, seine Gedanken seien „sonderbar“ gekleidet, anwortet L.: „[…] du sollst alle die meinigen [Gedanken] nakkend sehen ehe sie noch meine Sinne mit ihrer Livree bedecken. Es ist eine Schande, die meisten unsrer Wörter sind mißbrauchte Werkzeuge, die oft noch nach dem Schmutz riechen, in dem sie die vorigen Besitzer entweihten. Ich will mit neuen arbeiten, oder ohne so viel Luft dazu zu brauchen, als ein Sommervogel aussumst, nur mit mir selbst in Ewigkeit zu sprechen“ (B 346). L.s „Sudelbücher“, von denen bei seinem Tod keine Zeile bekannt war und die erst durch die Ausgaben des 19. Jh. einer staunenden Nachwelt zugänglich gemacht wurden, sind gekennzeichnet von einer Dialektik des Aussprechens und Verstummens. Die „Sonderbarkeit“, d. h. die Individualisierung der Erfahrung, die sich nicht der abgenutzten Wortwelt aussetzen will, zwingt zum Schweigen. In diesem Schweigen tritt L. vor ein imaginäres Forum, um seine Gedanken über die Situation von Wissenschaften und Literatur in seiner Epoche vorzutragen; unabhängig von der Pflicht aber, die Wahrheit über andere zu sagen und anzuhören, will er zuvor mitteilen, „wer ich bin, wie meine Hauptgesinnungen beschaffen sind, um diejenigen, die wichtigere Dinge zu tun haben, als die Kagen eines Mitbürgers anzuhören, so bald als möglich aus der Unentschlossenheit zu ziehen, in welcher sie sich vielleicht befinden werden, ob sie diese Rede anhören sollen oder nicht“ (B 366).
Die Nachwelt hat L.s Rede zumindest gehört; Goethe im Alter, Schopenhauer, Schleiermacher, →Jean Paul, Mörike, →Friedrich Theodor Vischer, Nietzsche, Tolstoi, Hofmannsthal, →Thomas Mann, →Karl Kraus, Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Elias Canetti gehören zu seinen Bewunderern. Die Prägnanz und der Einfallsreichtum seiner Sprache, die Vielschichtigkeit des Denkens, das sich nie in Spekulation verflüchtigt, der außerordentliche Witz, der Heterogenstes zusammenbringt oder durch geringfügige Umstellung in ein vollkommen neues Licht rückt, haben ihm nicht nur einen breiten Leserkreis, sondern auch das Interesse der Wissenschaftler gesichert: Er wird von den Psychoanalytikern, den formalen Logikern des Wiener Kreises genau so in Anspruch genommen wie von den Schriftstellern; den „ersten Schriftsteller des 20. Jh.“ hat ihn Helmut Heissenbüttel genannt. L. selbst hat die Zukunft seines Werkes aus einem Gesichtspunkt von „Aufklärung“ gesehen, der nicht an die eine historisch gewordene Epoche, sondern an deren nie realisierte Idee anknüpft, und es bleibt dahingestellt, ob er in den Lesern der Gegenwart schon das von ihm erhoffte Publikum gesehen hätte: „Philosophie, Beobachtung seiner selbst und zwar gnauere, Naturlehre des Herzens und der Seele überhaupt, allein, und in all ihren Verbindungen, diese muß derjenige studieren, der für alle Zeiten schreiben will. Dies ist der feste Punkt, wo sich gewiß die Menschen wieder einmal begegnen, es geschehe auch wenn es wolle, ist ein solcher Geschmack der herrschende, so ist der Wert des Menschlichen Geschlechts, mit den Mathematikverständigen zu reden, ein größtes, und kein Gott kann es höher bringen“ (B 270).
II
Zu seinen Lebzeiten galt L. als einer der führenden deutschen Naturforscher. Er ist insbesondere durch die Art, wie er Naturforschung betrieb und verstand, über seine Epoche hinaus wegweisend geworden. Nicht so sehr Einzelentdeckungen als vielmehr eine fachübergreifende Betrachtungsweise charakterisieren sein wissenschaftliches Werk.
In seiner Antrittsvorlesung in Göttingen als ao. Professor für reine und angewandte Mathematik befaßte sich L. 1770 mit „Betrachtungen über einige Methoden, eine gewisse Schwierigkeit in der Betrachtung der Wahrscheinlichkeit beim Spiel zu heben“ (1770). Er behandelte hier das von →Nikolaus Bernoulli 1713 vorgestellte sog. „Petersburg-Problem“. Dabei wird beispielsweise eine Münze geworfen und vorher Kopf oder Zahl als Gewinnseite vereinbart. Fällt die Gewinnseite beim ersten Wurf, erhält der Werfer einen bestimmten Betrag; fällt sie erst beim zweiten Wurf, erhält er die doppelte Summe, beim dritten Wurf die vierfache Summe usw. Allgemein gilt, daß der Spieler nach dem n-ten Wurf die 2n-1fache Summe des Anfangsgewinns ausgezahlt erhält. Die Frage lautet nun, wie hoch der Einsatz des Werfers sein muß, um ein Spiel zu ermöglichen, das beiden Teilnehmern eine Chance gibt. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung führt zu dem Ergebnis, daß der Einsatz unendlich hoch sein müsse. Dies widerspricht unmittelbar der Logik und brachte die eben im Entstehen begriffene Wahrscheinlichkeitsrechnung bei vielen zeitgenössischen Mathematikern in Mißkredit. Das Problem bestand darin, die Frage nach der Einsatzhöhe ohne paradoxes Resultat zu beantworten. →Daniel Bernoulli konzipierte 1736 einen Lösungsweg, der über eine Definition der zur Verfügung stehenden Kapitalien führte, wogegen die ursprüngliche Lösung von unbegrenzten Vermögen der Spieler ausgegangen war. 1762 entwickelte D'Alembert eine Unterscheidung zwischen physischer und metaphysischer Wahrscheinlichkeit, die das Problem zwar ohne paradoxe Aussage löste, aber selbst nicht mehr mathematisch faßbar war. L. stellte sich in seiner Abhandlung auf die Seite Bernoullis und verwarf D'Alemberts Ansatz. Bemerkenswert ist der Umstand, daß er seine Position untermauerte, indem er statistische Wurfexperimente ausführte – zu einer Zeit, als die Statistik noch in den Anfängen steckte. Das Petersburg-Problem wurde erst 1928 in der von D. Bernoulli und L. bereits anvisierten Richtung durch T. C. Fry befriedigend gelöst.
L.s Interesse an der reinen Mathematik war nicht sonderlich ausgeprägt. Als Hilfsmittel zur Erzielung naturwissenschaftlicher Erkenntnis schätzte er die Mathematik hoch ein. Eigene Beiträge L.s auf mathematischem Gebiet gibt es nicht. Er bestritt auch die Möglichkeit, allein durch die Mathematik zu Entdeckungen in der Naturkunde zu gelangen: „Ich glaube nicht, daß durch Calcül je eine große Entdeckung in der Naturlehre gemacht worden ist; das ist auch sein Gegenstand nicht. Sondern sobald der Zufall oder der praktische Blick etwas entdeckt haben, so gibt die Mathematik die besten Umstände an; sie zeigt, wenn sich die Sache im ganzen so verhält, welches die beste Form und Einrichtung sei – weiter nichts.“ An anderer Stelle: „Alle mathematischen Gesetze die wir in der Natur finden, sind mir trotz ihrer Schönheit immer verdächtig. Sie freuen mich nicht. Sie sind bloß Hilfsmittel. In der Nähe ist alles nicht wahr.“
Ungeachtet dieser kritischen Haltung gegenüber Zweck und Nutzen mathematischer Verfahren zur Naturerkenntnis legte er dort, wo er sie selbst anwandte, Wert auf größtmögliche Exaktheit. Dies zeigt sich u. a. in seinen geodätischen Lagebestimmungen von Hannover, Stade und Osnabrück. Die Vermessungen sollten einerseits der Überprüfung der von Newton und Huygens aufgestellten These dienen, wonach die Erde an den Polen abgeplattet sei; daneben verfolgte man den Zweck einer kartographischen Erfassung des Kurfürstentums Hannover und des Hzgt. Osnabrück. L. wurde von A. G. Kästner, dem Leiter der Göttinger Sternwarte, für die Durchführung der Bestimmungen empfohlen und von Kg. Georg III. von England, der auch Landesherr von Hannover und Osnabrück war, damit beauftragt. Ihm standen ein neu angeschaffter Azimutalquadrant von Sisson, eine Präzisionsuhr des Göttinger Instrumentenbauers Kampen, außerdem ein Fernrohr und ein Kompaß zur Verfügung. Den eigentlichen Messungen 1772/73 gingen umfangreiche Arbeiten zur Eichung des Quadranten und zur Bestimmung des Instrumentenfehlers voraus. Die Polhöhe (Breite) bestimmte L. nach dem Verfahren von Hell, die Längenmessungen wurden mit Hilfe von Beobachtungen der Jupitermonde, einer Sternbedeckung durch den Mond und einer Mondfinsternis vorgenommen. Die dazu nötigen Korrespondenzbeobachtungen lieferten Kästner in Göttingen, Lalande in Paris, →Johann Bernoulli in Berlin u. a. Die Bestimmungen, über die L. im Dez. 1776 der Göttinger Gelehrten Gesellschaft vortrug, zählten zu den präzisesten ihrer Zeit.
Neben kleineren astronomischen Arbeiten, zu denen seine Teilnahme an der Beobachtung des Venusdurchgangs durch die Sonne vom 3.6.1769 und seine Beobachtungen eines Kometen im darauffolgenden Jahr gehören, befaßte sich L. mit der Herausgabe des wissenschaftlichen Nachlasses von →Tobias Mayer, dem Gründer der Göttinger Sternwarte. L. veröffentlichte 1775 einen Band mit den von Mayer vor der Göttinger Societät gehaltenen Vorträgen; der geplante zweite Band mit Fragmenten, Notizen und Ergänzungen kam nicht mehr zustande. Eine der publizierten Arbeiten behandelte die Temperaturverteilung in der Erdatmosphäre. Mayer hatte einen mathematischen Ansatz formuliert, der die Abnahme der mittleren Jahrestemperatur vom Äquator in Richtung der Pole beschrieb. L. überprüfte diesen Satz anhand der meteorologischen Daten von 15 Orten und fand für Orte auf Meereshöhe eine befriedigende Übereinstimmung mit den theoretischen Werten.
Bedeutender war Mayers Arbeit zur Farbentheorie. Die Entstehung der einzelnen Farben aus den Grundfarben und ihre Beziehung zueinander war ein vielbeachtetes Thema der Zeit. Wenn auch eine tatsächlich befriedigende Lösung des Problems erst durch das Verständnis des Lichtspektrums im Laufe des 19. Jh. möglich wurde, so bemühte man sich doch schon vorher, die Vielzahl der Farben in geeigneter Weise zu ordnen. Mayer hatte ein „Farbdreieck“ entwickelt, worin er 91 Farbtöne durch sukzessive Mischung der Grundfarben rot, gelb und blau erzeugte. Durch Hinzufügen von Weiß und Schwarz entstand aus dem Dreieck eine Doppelpyramide, in der die einzelnen Farbtöne noch im Sinne einer Grauwertskala variiert waren. L. formte die Doppelpyramide in ein Doppelprisma um und versah die einzelnen Positionen mit Raumkoordinaten, was eine gewissermaßen mathematische Behandlung des Farbmischvorgangs ermöglichte. Zudem gab er ein Verfahren zur Herstellung eines Dreiecks mit standardisierten Farbtönen an
Diese Ergänzungen der Arbeiten Tobias Mayers gehören zur Physik, dem Hauptarbeitsgebiet L.s. Hier ist sein Name vor allem mit den nach ihm benannten Figuren verknüpft. Da L. die Physik in erster Linie als eine Experimentalwissenschaft verstand und deduktiv-spekulativen Ansätzen mit Mißtrauen begegnete, hatte er eine beachtliche Sammlung physikalischer Apparate aufgebaut, die teilweise heute noch existiert. 1777 wurde diese Sammlung durch einen sog. Elektrophor ergänzt. Dabei handelt es sich um ein von A. Volta 1771 entwickeltes Gerät zur Speicherung statischer Elektrizität, das eine schrittweise Entladung ermöglichte. Der Elektrophor bestand aus einem Harzkuchen, der mittels Katzenfell aufgeladen wurde, und einer genau aufliegenden Metallplatte, durch deren Heben und Senken eine bestimmte Ladungsmenge abgenommen werden konnte. Der ungewöhnlich große Elektrophor L.s besaß einen Kuchen von 6 Fuß (ca. 1,80 m) Durchmesser und 51 Pfund Gewicht. L. war der Ansicht, daß die Vergrößerung der Experimentiergeräte eine Verfeinerung der Beobachtung ermögliche. Seine Annahme hatte die Entdeckung der später nach ihm benannten elektrostatischen Figuren zur Folge. Um dem großen Harzkuchen eine plane Oberfläche zu geben, war dieser abgehobelt worden; dabei hatte sich eine Menge feinen Harzstaubes gebildet, der im Experimentierraum bei jedem Luftzug aufgewirbelt wurde. L. beobachtete nun, daß sich dieser feine Staub auf dem geladenen Harzkuchen in Form stern- oder büschelartiger Muster ablagerte. Hätte L. einen der üblichen, wesentlich kleineren Elektrophore benutzt, deren Oberfläche nicht gehobelt zu werden brauchte, wäre ihm die Entdeckung der Figuren nicht geglückt. Er untersuchte das unerwartete Phänomen nach allen Regeln der ihm zu Gebote stehenden Experimentierkunst und erstattete der Göttinger Societät einen ersten – durch Kästner am 3.5.1777 verlesenen – Bericht, dem schriftliche Erläuterungen im Februar und Dez. 1778 folgten. Die „Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen“ berichteten erstmals am 16.6.1777 über L.s Entdeckung (72. Stück). Er entwickelte Methoden zur zuverlässigen Erzeugung der Figuren, untersuchte diverse Bestäubungsmittel (wobei er den Unterschied zwischen „positiven“ und „negativen“ Figuren erkannte) und die Entstehung der Figuren im Vakuum. Die Gründe für das Zustandekommen der Figuren vermochte L. nicht zu klären; Vergleiche des Verhaltens des Elektrophors mit dem eines Magneten ließ er wieder fallen. Die Entdeckung L.s bildet die Grundlage der modernen Xerographie. Erwähnt sei, daß bereits 1801 die Erzeugung und Fixierung beliebiger Zeichen auf Papier mittels der L.schen Entdeckung beschrieben wird. Das Verfahren entspricht in allen prinzipiellen Schritten dem heute angewandten: „Man nimmt z. B. ein Stück gewöhnliches Schreibpapier, läßt es ganz heiß und trocken werden, legt es auf einen recht trockenen Tisch, zeichnet darauf allerhand Züge mit dem Knopfe einer geladenen Flasche [gemeint ist eine „Leydener Flasche“, ein Kondensator hoher Kapazität], hebt es hierauf in die Höhe und bestäubt es unter einer sehr schiefen Richtung mit dem Pulver von Drachenblut [d. i. ein Harz]. Hierauf hält man das Papier einige Sekunden ans Feuer, so schmelzt das Drachenblut als ein harziges Wesen, und die schönen roten elektrischen Figuren bleiben jetzt am Papier hängen.“ (Hube)
Zu L.s elektrophysikalischen Leistungen zählt auch die Installation des ersten funktionsfähigen Blitzableiters in Deutschland, den er am 25.5.1780 an seinem Gartenhäuschen anbringen ließ. Der ein Jahr zuvor von J. A. H. Reimarus in Hamburg gebaute Blitzableiter besaß keine Erdung und war somit von gerade gegenteiligem Effekt. Zur Untersuchung luftelektrischer Erscheinungen hatte L. zuvor schon Experimente mit Drachen ausgeführt, und er richtete den Blitzableiter so ein, daß er die Erdung unterbrechen und den Ableiter statt dessen mit einem Versuchstisch im Inneren des Hauses verbinden konnte – eine Experimentieranordnung, die alles andere als ungefährlich war. L. war sich über die Funktionsweise des Blitzableiters im klaren; seine diesbezüglichen Erläuterungen stimmen mit den modernen Erkenntnissen überein.
Hinsichtlich der wahren Beschaffenheit dessen, was als Elektrizität bezeichnet wurde, gab es im 18. Jh. keine einheitliche Auffassung. Weithin unbestritten war die Annahme, daß es sich dabei um eine Form der Materie handeln müsse, jedoch diskutierte man sowohl die Vorstellung einer einzigen Substanz, wie auch die zweier unterschiedlicher Elektrizitätsmaterien. Von einem tatsächlichen Verstehen der Elektrizität war man in jedem Fall weit entfernt. L. neigte der „unitarischen“ Theorie Franklins zu, wonach es nur eine elektrische Materie („Fluidum“) gab, und schlug vor, Franklins Bezeichnungen „ † “ und „ –“ zu übernehmen; dabei könne dann jeder selbst entscheiden, ob er darunter ein Zuviel oder Zuwenig einer Substanz, oder, wie z. B. R. Symmer, zwei unterschiedliche Fluida verstehen wolle. 1782 entwickelte L., angeregt durch Arbeiten Voltas, den sog. Luftkondensator, der den Nachweis relativ kleiner Ladungsmengen ermöglichte.
Bereits während seiner Arbeiten über den Kondensator wandte sich L.s Augenmerk einem neuen Gebiet zu, der Untersuchung der Gase, oder, wie er sagte, der Luftarten. Neben Versuchen mit Stickstoff- und Schwefeloxiden, Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff und Ammoniak befaßte er sich vorwiegend mit Sauerstoff und Wasserstoff. Dabei fand er das Prinzip des Elektroschweißens, unternahm Experimente mit Knallgas und ließ mit Wasserstoff gefüllte Seifenblasen steigen, wodurch er die kurze Zeit später von J. A. C. Charles geleistete Erfindung des Gasballons beinahe vorwegnahm. L. beklagte seine „Indolenz“, die ihn an der Erfindung der Charlière gehindert hatte, und stellte viele Versuche mit selbstgebauten kleinen Ballonen mit Wasserstoffüllung an. Die Auseinandersetzung mit der Gaschemie und -physik führte fast zwangsläufig zu dem großen Thema der Chemie seiner Zeit, dem Streit zwischen den „Phlogistikern“ und den Anhängern Lavoisiers. Die auf J. J. Becher und insbesondere G. E. Stahl zurückgehende Phlogistontheorie besagt, daß allen brennbaren Körpern ein bestimmtes „Wesen“ innewohnt, vergleichbar den elektrischen Fluida, dem Wärme- und dem Lichtstoff (oder auch dem im 19. Jh. vorgeschlagenen Weltäther). Wenn ein Körper verbrennt, so verschwindet diese als Phlogiston bezeichnete Materie unter mehr oder weniger ausgeprägter Leuchterscheinung (Flamme). Teilweise erfolgte auch eine Gleichsetzung des Wärme- bzw. Lichtstoffs und des Phlogiston. Diese über Jahrzehnte weitgehend anerkannte Auffassung wurde von Lavoisier bestritten, der im Sauerstoff den Träger des Verbrennungsvorgangs ausgemacht hatte. L. sah sich auch in dieser Auseinandersetzung nicht in der Lage, eindeutig für eine der beiden Theorien einzutreten. Ihm mißfielen die Art und Weise, wie die Vertreter der „neuen Chemie“ mit der Phlogistontheorie umgingen („Mad[ame] Lavoisier verbrannte feierlich das Phlogiston“), und er kritisierte, daß durch die Sauerstoffkonzeption zwar der Chemie gedient sein möge, aber daß damit der viel weiter gesteckte Anwendungsbereich der Phlogistontheorie erheblich eingeschränkt werde. Außerdem habe der von Lavoisier geforderte „säureerzeugende Stoff“ (Sauerstoff) mit dem Phlogiston „auch dieses gemeinsam, daß er bloß angenommen ist und für sich allein nicht dargestellt werden kann“. Also werde eine fiktive Größe durch eine andere ersetzt.
In seinen letzten Lebensjahren beteiligte sich L. noch an einer wissenschaftlichen Kontroverse über die Entstehung des Regens, in der er seinen Freund Jean André de Luc unterstützte. Letzterer hatte festgestellt, daß die Luft in höheren Atmosphärenschichten einen geringeren Wassergehalt aufweist, als sie zur Hervorbringung von Niederschlägen hätte haben sollen. Diese frappierende Trockenheit der Luft wurde auch von anderen Forschern bestätigt. Zur Erklärung des Tatbestandes wurden zwei Theorien aufgestellt: de Luc (und mit ihm die meisten derjenigen, die der Phlogistontheorie nahestanden) behauptete, das Wasser verbinde sich mit einer noch unbekannten Substanz, wieder einer Art von Fluidum, zu einem luftähnlichen Stoff. Die Antiphlogistiker vertraten demgegenüber den Standpunkt, das Wasser zerfalle in der höheren Atmosphäre in seine Bestandteile. L. verteidigte in einer 1792 verfaßten und 1799 erschienenen Arbeit die Position de Lucs; eine weitere, fragmentarische Veröffentlichung dazu erschien ein Jahr nach seinem Tod. Beide Ansichten waren falsch. Tatsächlich entstehen Niederschläge, wenn ein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt der Luft überschritten wird (Taupunkt). Die Abhängigkeit des Taupunkts von Temperatur und Druck wurde von keiner Seite richtig verstanden.
L. war ein herausragender akademischer Lehrer. 1775 erfolgte seine Ernennung zum o. Professor für Physik. Die physikalische Hauptvorlesung hielt zu dieser Zeit noch|J. P. Erxleben. Nach dessen Tod 1777 übernahm zunächst A. G. Kästner, Ordinarius für Mathematik, die große Physikvorlesung; L. las seit 1778 zunächst über ausgewählte Themen, ließ 1780 ein Kolleg in experimenteller Physik folgen und hielt seit dem Wintersemester 1781/82 auch die Hauptvorlesung. Sie galt bald als die beste in Deutschland. Die Ursachen lagen im Witz seines Vortrages und in den gezeigten Experimenten. Bei den Versuchen kam ihm seine umfangreiche Sammlung physikalischer Geräte sehr zustatten, die er später der Universität gegen Zahlung einer Leibrente vermachte. Die Freude am Experiment bestimmte seine Forschungen ebenso wie seine Lehrtätigkeit. Während der Hauptvorlesung wurden über 600 Experimente vorgeführt; um das große Interesse an den Versuchen zu befriedigen, wurden die wichtigsten der Woche jeweils am Sonntag von L.s Vorlesungsassistent wiederholt.
Von Erxleben übernahm L. die Herausgabe des Göttinger Taschenkalenders. 1780-85 redigierte er das Magazin der Göttinger Gelehrten Gesellschaft. Das höchst erfolgreiche Werk Erxlebens, die „Anfangsgründe der Naturlehre“, nach dem L. anfänglich seine physikalische Vorlesung gestaltet hatte, wurde von ihm 1784 (5. Aufl.), 1787, 1791 und 1794 neu aufgelegt und jeweils überarbeitet. Er trug sich mit dem Gedanken, ein eigenes Kompendium zu verfassen, setzte diesen Plan aber nicht in die Tat um. Über seine Vorlesung sind wir durch die 1808-12 im Druck erschienene dreibändige Mitschrift von G. Gamauf unterrichtet.
Eine Auftragsarbeit war die um 1795 begonnene und kurz nach seinem Tod veröffentlichte Copernicus-Biographie, die er für den Chemnitzer Verleger K. G. Hoffmann schrieb. Die Schrift muß als nicht abgeschlossen betrachtet werden, da wesentliche Teile der Beschreibung der späteren Lebensjahre fehlen.
L.s Denken stellt eine ungewöhnliche Verbindung zwischen den heute weit auseinanderliegenden Feldern der Geistes- und der Naturwissenschaften her. Es waren nicht so sehr herausragende Beiträge zur Kenntniserweiterung, die L. einen weit über Deutschland hinausreichenden Ruf als Gelehrter verschafften, sondern seine Art des Denkens. Vielleicht der wichtigste Begriff in diesem Denken war der der Ganzheit. Diese Ganzheitsvorstellung wurzelte in der Überzeugung, daß eine allgegenwärtige Kausalität alles mit allem verknüpft: „Es gibt vor Gott nur eine Naturwissenschaft; der Mensch teilt sie in einzelne Kapitel und muß es tun in Anbetracht seiner Begrenztheit.“ Mit dieser Ganzheitsvorstellung verband sich die Einsicht in die Vorläufigkeit aller Wissenschaft. L. war der, heute weit verbreiteten, Auffassung, daß wir nur Vorstellungen einer Wirklichkeit hervorbringen können, diese insgesamt aber unserem Verstehen entzogen bleibt. Die einzelnen Fachgebiete, in die der Mensch diese eine, ganze Naturwissenschaft zergliederte, zergliedern mußte, sollten Schritt für Schritt aufeinander zugehen, sich annähern und schließlich vielleicht ineinander münden. Diese integrative Betrachtungsweise, die im 19. und frühen 20. Jh. sehr in den Hintergrund gedrängt wurde, findet neuerdings steigende Beachtung. Dieses Bestreben nach einer Wissenschaft war auch die Triebfeder der Romantischen Naturphilosophie, zu der L. in enger Beziehung stand, wie seine Kontakte zu J. W. Richter, L. Galvani oder A. v. Humboldt belegen. In seiner Jugend war L. stark von der Aufklärung beeinflußt, Albrecht v. Haller ist hier zu nennen; die Hinwendung zum Idealismus und zur Romantik erfolgte erst später und war nicht total: Strenge Logik und die absolute Anerkennung gesicherter Fakten waren stets die Grundlage seines wissenschaftlichen Selbstverständnisses – dahinter hatte die Schönheit eines Gedankengebäudes zurückzustehen. Allerdings war er kein Positivist, maß den gefundenen Fakten nicht um ihrer selbst willen so hohe Bedeutung bei, sondern weil er glaubte, nur auf empirischem Weg jene Ordnung aller Dinge – die Ganzheit des Seins – wenigstens über die Kenntnis einzelner ihrer Teile annähernd begreiflich machen zu können. Er besaß im Unterschied zu den Positivisten ein metaphysisches Konzept, auf dem er aufbaute und vor dem er sich mit dem Bereich des Faktischen auseinandersetzte. Interessant ist sein Verhältnis zu Kant. Dieser hatte in seiner Abhandlung „Über die Anfangsgründe der Naturwissenschaften“ (1786) einen kontinuierlichen, nicht atomaren Materieaufbau postuliert (Dynamismus). Wiewohl von Kant generell stark beeinflußt und im Rahmen der rein logischen Betrachtung diesem eher zuneigend, nahm L. auch in der Frage der Materiestruktur eine Zwischenposition ein; er bemühte sich um eine Synthese: „Dieses System [das der Atomisten] wird immer ein vortreffliches Bild bleiben, der Rekurs an jenes [das der Dynamisten] metaphysische wird ja dadurch nicht gehemmt. Man sollte also vielleicht die beiden|Systeme nicht einander entgegensetzen, als ihre Dependenz voneinander zeigen.“ Weiter heißt es: „In so ferne wir uns die Körper als ausgedehnt denken, müssen wir sie uns notwendig als unendlich teilbar denken. Allein wenn wir sie uns als zusammengesetzt denken, so müssen wir auch endliche Teilbarkeit annehmen.“
L. hörte nicht auf zu denken, wenn die Grenze des durch Fakten gesicherten Bodens erreicht war. Er weigerte sich allerdings, darüber hinausreichende Überlegungen als Theorien anzusehen – sie waren für ihn nützliche Gedankenspiele, „vernünftige Mutmaßungen“. Im Rahmen dieser Einschränkungen versuchte er, Zusammenhänge zwischen Einzelerscheinungen unterschiedlicher Art herzustellen, Magnetismus und Elektrizität, Magnetismus und Licht, Licht und Wärme, Wärme und Schall miteinander zu verknüpfen. Eine Verbindung wollte er auch herstellen zwischen den Vertretern der Korpuskular- und der Wellentheorie des Lichts: „Wie wäre es, wenn man am besten damit auskäme, beyde Theorien des Lichts, die Newtonische und die Eulerische zu vereinigen?“ L. fehlte die empirische Basis für eine solche Vereinigung, aber ihre Antizipation entsprach seinem Naturverständnis. Er kam mit dieser „vernünftigen Mutmaßung“ den heutigen Ansichten über das Licht näher als alle seine Zeitgenossen.
Für „Amintor“, jene Figur, in der L. sich selbst abbildete, bedeuteten Erkenntnis und Anerkennung der Naturordnung einen Teil dieser Ordnung. Die Einsicht in die notwendige kausale Verknüpfung aller Dinge untereinander zur Ganzheit, ermöglicht durch das zunehmende Verstehen der Natur mittels der Wissenschaft, und die darauf aufbauende Überzeugung von der Existenz einer alles umfassenden Naturordnung war die Quelle seiner schöpferischen Kraft: „[Der Philosoph] weiß ohnehin, wie sehr sehr wichtig diese Vergleichungen unsers Selbst und unsers Wirkungskreises mit den Begebenheiten der Natur, die sich ohne unser Zutun ereignen, selbst für unsere Ruhe sind. Wer noch nicht weiß und fühlt, daß hier hinaus ein nie versiegender Quell selbst von Muth im Leiden und von Trost im Tode liegt, den ihm kein Religionsstifter gegeben hat und also auch kein Stifter von Irreligion rauben kann, muß es noch nicht sehr weit in Philosophie und Kenntniß der Natur gebracht haben …“
-
Works
Auserlesene Schrr., hrsg. v. Ch. S. Krause, 1800;
Vermischte Schrr., hrsg. v. Ludw. Christian Lichtenberg (S) u. F. Kries, 9 Bde. (Bd. 6-9: Math. u. physikal. Schr.), 1800-06 (Nachdr. 1967);
Vermischte Schrr., Neue vermehrte, v. dessen Söhnen veranstaltete Originalausg., 14 Bde., 1844-53;
Vermischte Schrr., Neue Originalausg., 8 Bde., 1867;
Gedanken u. Maximen, Lichtstrahlen aus s. Werken, Mit e. biogr. Einl. v. E. Grisebach, 1871;
Aus L.s Nachlaß, Aufsätze, Gedichte, Tagebuchbll., Briefe, hrsg. v. A. Leitzmann, 1899;
Briefe, hrsg. v. dems. u. C. Schüddekopf, 3 Bde., 1901-04;
G. C. L.s Aphorismen, Nach d. Hss. hrsg. v. A. Leitzmann, 5 Hh., 1902-08 (Nachdr. 1968);
Ges. Werke, hrsg. u. eingel. v. W. Grenzmann, 2 Bde., 1 Erg.bd. (Hogarth-Kupferstiche), 1949;
Schrr. u. Briefe, hrsg. v. W. Promies, I: Sudelbücher, 1968, II: Sudelbücher II, Materialhh., Tagebücher, 1971, III: Aufsätze, Entwürfe, Gedichte, Erklärung d. Hogarthischen Kupferstiche, 1972, IV: Briefe, 1967, Kommentarbd. zu III, 1974;
London-Tagebuch, Sept. 1774 bis April 1775, hrsg. v. H. L. Gumbert, 1979;
Briefwechsel, hrsg. v. U. Joost u. A. Schöne, I: 1765-79, 1983. | -
Archival Ressources
Nachlaß: Göttingen, Univ.bibl.
-
Literature
Gesamtdarstellungen: W. Grenzmann, G. C. L., 1939;
O. Deneke, L.s Leben I (1742–75), 1944 (einziger Bd.);
P. Requadt, L., Zum Problem d. dt. Aphoristik, 1948, ²1963;
A. Schneider. L., Précurseur du romantisme, 1954;
ders., L., penseur, 1954;
C. Brinitzer, L., Die Gesch. e. gescheiten Mannes, 1956 (engl.: A reasonable rebel: G. C. L., 1960);
J. P. Sterne, A doctrine of scattered occasions, reconstructed from his aphorisms and reflections, 1959;
W. Promies, L. in Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten, ²1973 (Bibliogr. 1972–78, P);
F. H. Mautner, L., Gesch. s. Geistes, 1968;
ders., in: Dt. Dichter d. 18. Jh., 1977, S. 482-506. - Zur Naturwiss.: M. Hube, Vollst. u. faßlicher Unterricht in d. Naturlehre I, 1801, S. 493 f. (Beschreibung d. Xerographie-Prinzips);
E. Ebstein, L. u. Goethe z. Theorie d. Farben, in: Archiv f. Gesch. d. Naturwiss. 3, 1912, S. 71-78;
ders., Aus G. C. L.s Frühzeit, ebd. 7, 1916, S. 129-40;
P. Hahn, G. C. L. u. d. exakten Wiss., Materialien z. s. Biogr., 1927;
H. Pupke, G. C. L. als Naturforscher, in: Die Naturwiss. 30, 1942, S. 745-50;
F. Mautner u. F. Miller Jr., Remarks on G. C. L., Humanist-Scientist, in: Isis 43, 1952, S. 222-31;
D. Herrmann, G. C. L.s Beziehungen z. Astronomie, in: Die Sterne 38, 1962, S. 113-18;
ders., Die Copernicus-Biogr. v. G. C. L., in: Zs. f. Gesch. d. Naturwiss., Technik u. Medizin 11, 1974, S. 40-45;
A. Hermann, L. als ak. Lehrer, in: Physikal. Bll. 30, 1974, S. 324-27;
J. Teichmann, G. C. L.: Physik, Technik u. Ästhetik, in: Humanismus u. Technik 19, 1975, S. 23-40. - Weiteres:
L. Marino, I meastri della Germanià, Göttingen 1770-1820, 1975, passim;
M. Ammermann, Gemeines Leben, Gewandelter Aufklärungsbegriff u. literar. Spätaufklärung, L., Wezel, Garve, 1978;
R. Wehrli, G. C. L.s ausführl. Erklärung d. Hogarthischen Kupferstiche, 1980;
A. Schöne, Aufklärung aus d. Geist d. Experimentalphysik, L.sche Konjunktive, 1982;
G. Cantarutte, Aphoristikforschung im dt. Sprachraum, 1984, passim;
H. Fricke. Aphorismus, 1984, passim. - W-Verz. u.
| Bibliogrr.: F. G. Lauchert, G. C. L.s schriftsteller. Thätigkeit in chronolog. Übersicht dargest., Mit Nachträgen zu L.s „Vermischten Schrr.“ u. textkrit. Berichtigungen, 1983;
R. Jung, Lichtenberg-Bibliogr., 1972;
B. W. Vrana, G. C. L., Ein Forschungsber., Ph. D. Thesis, University of Nebraska, 1979 (University Microfilms International, Ann Arbor). - Periodikum:
Photorin, Mitt. d. Lichtenberg-Ges., hrsg. v. W. Promies, 1,1979 ff. -
Pogg. VII a Suppl.;
Dict. of Scientific Biogr. VIII, 1973;
Dt.GB 96. -
Portraits
Kreidezeichnung v. J. L. Strecker (Göttingen, Städt. Mus.), Abb. in: Bildnisse Göttinger Professoren aus 2 Jhh., hrsg. v. M. Voit, 1937, u. b. Rave;
Zeichnung v. D. Chodowiecki (?), Abb. in: G. Biermann, Dt. Barock u. Rokoko, 1914. -
Author
I Wolfgang Proß, II Claus Priesner -
Citation
Proß, Wolfgang; Priesner, Claus, "Lichtenberg, Georg Christoph" in: Neue Deutsche Biographie 14 (1985), S. 449-464 [online version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118572628.html#ndbcontent
-
Lichtenberg, Georg Christoph
-
Biography
Lichtenberg: Georg Christoph L., wurde am 1. Juli 1742 zu Oberamstädt bei Darmstadt geboren. Sein Vater starb als Generalsuperintendent zu Darmstadt und hinterließ 18 Kinder, von denen L. das jüngste war. In Folge eines durch die Unvorsichtigkeit der Wärterin verursachten Falles wurde er im achten Jahre bucklig. Wol nicht mit Unrecht hat man hierin den Anstoß für die Entwicklung seiner satyrischen Anlage gesucht und mehrfache Eigenthümlichkeiten darauf zurückführen zu müssen geglaubt. L. besuchte die Schule zu Darmstadt und zeigte namentlich für Mathematik große Vorliebe und hervorragendes Talent. Im Alter von 19 Jahren bezog er 1763 die Universität Göttingen, um Mathematik zu studiren. 1769 wurde er zum außerordentlichen Professor in Göttingen ernannt. In den Jahren 1772 und 1773 führte er im Auftrage des Königs von Hannover astronomische Berechnungen der Längen- und Breitengrade im Königreiche Hannover aus. 1774 unternahm er eine Reise nach England, woselbst er bis December 1775 blieb. Er lernte hier eine Reihe der wissenschaftlich bedeutendsten Persönlichkeiten: Herschel, Banks, Solander, die beiden Forster und andere kennen und verschaffte sich eine gründliche Kenntniß der englischen Verhältnisse. Nach Göttingen zurückgekehrt wurde er bald ordentlicher Professor und 1788 königlich großbritannischer Hofrath. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Folge seines Körperleidens in hypochondrischer Zurückgezogenheit im Schoße seiner Familie und im Verkehr mit seinem intimsten Freunde, dem Buchhändler Johann Christian Dieterich. L. starb am 24. Febr. 1799. Von seinen beiden ältesten Söhnen starb der eine 1845 als königlich hannoverscher Generaldirector der directen Steuern, der andere 1860 als Steuerdirector. Ein Sohn des ersteren war hannoverscher Cultusminister und starb 1883 als Präsident des Consistoriums zu Hannover. In seiner speciellen Wissenschaft zeichnete sich L. aus durch seine von ausgezeichneten Apparaten unterstützten Vorlesungen über Experimentalphysik, welche einen bedeutenden Ruf genossen und vielfach besucht wurden. Sein Name lebt in der Physik fort durch die nach ihm genannten Lichtenberg’schen Figuren. Aber obwol er das Gebiet der Physik völlig beherrschte, hat er es doch zu keiner bedeutenden Bereicherung desselben gebracht. Dagegen ist er als schönwissenschaftlicher Schriftsteller von großer Bedeutung und hat als solcher der Nachwelt ein unschätzbares Material hinterlassen, wenn er auch keine einzige größere Schrift verfaßt hat. Seine erste derartige Arbeit, welche im „Deutschen Museum" von 1776 erschien, behandelt die Charakteristik des großen Shakespeare-Darstellers Garrick und zeugt von einer außerordentlichen Beobachtungsgabe. Bald darauf erschien „Timorus, d. h. Vertheidigung zweier Israeliten, die durch die Kräftigkeit der Lavater’schen Beweisgründe und die Göttinger Mettwürste bewogen den wahren Glauben angenommen haben“, in welcher Schrift er die supranaturalistischen Anschauungen Lavater's verspottet. Vom Jahre 1778 an redigirte er die im Dieterich’schen Verlage erscheinenden „Göttinger Taschenkalender“, welche zahlreiche wissenschaftliche und populäre Aufsätze über Naturwissenschaften, Geschichte, Staatenkunde, Kritiken, Streitschriften etc. von vollendeter Form, großer Klarheit und unübertrefflichem Witz aus seiner Feder brachten. 1780 gründete er mit Georg Forster das „Göttingensche Magazin“, in dem er die deutschen Roman- und Zeitungs-Schreiber, dann auch die damaligen Dichter, vor allem Voß und die Mitglieder des Hainbundes geißelte. Berühmt sind seine Erklärungen der Hogarth’schen Kupferstiche, bei|welcher ihm die genaue Kenntniß der englischen Verhältnisse sehr zu statten kam, und die sich durch glänzende Schreibweise und feinen Witz auszeichnen. Die 5 ersten Lieferungen der ausführlichen Ausgabe erschienen in Göttingen 1794 bis 1799. Lieferung 6—11 wurde nach seinem Tode mit Benutzung des vorliegenden Materials herausgegeben. Von bleibendem Werthe sind ferner die Aufzeichnungen, Sentenzen oder längeren Aufsätze, welche sich unter seinem Nachlasse in den sogenannten Gedenkbüchern finden, dieselben zeichnen sich sowohl durch philosophische Tiefe als durch schlagenden Witz und Humor aus und bilden ein vollständiges Gedankensystem. Sie wurden zuerst veröffentlicht in den „Vermischten Schriften“, 9 Bde., 1801—1806; neue Ausgabe 8 Bde., 1844.
-
Literature
Ed. Grisebach, Georg Christ. Lichtenberg's Gedanken und Maximen, Leipzig 1871.
-
Author
W. Heß. -
Citation
Heß, Wilhelm, "Lichtenberg, Georg Christoph" in: Allgemeine Deutsche Biographie 18 (1883), S. 537-538 [online version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118572628.html#adbcontent