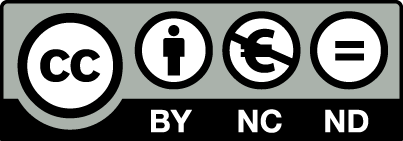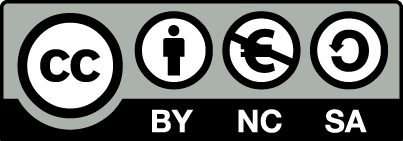Kleist, Heinrich von
- Lebensdaten
- 1777 – 1811
- Geburtsort
- Frankfurt/Oder
- Sterbeort
- am Wannsee bei Berlin
- Beruf/Funktion
- Dichter ; Schriftsteller ; Librettist
- Konfession
- evangelisch
- Normdaten
- GND: 118563076 | OGND | VIAF: 7392307
- Namensvarianten
-
- Kleist, Heinrich Wilhelm von
- Kleist, Bernd Heinrich Wilhelm von
- Kleist, Heinrich von
- Kleist, Heinrich Wilhelm von
- Kleist, Bernd Heinrich Wilhelm von
- Klai͏̈st, Errikos phon
- Klai͏̈st, Herrikos phon
- Klajst, Chajnric fon
- Klajst, Genrich
- Klajst, Hajnrih fon
- Klajst, Hajnrik fon
- Klayst, Hāynriš fūn
- Kleist
- Kleist, B. Wilhelm Heinrich von
- Kleist, Bernd H. von
- Kleist, Bernd Heinrich von
- Kleist, Bernd W. von
- Kleist, Bernd Wilhelm Heinrich von
- Kleist, Bernhard Heinrich Wilhelm von
- Kleist, Enric de
- Kleist, Enrico von
- Kleist, Genrikh
- Kleist, H. V.
- Kleist, Henri de
- Kleist, Henrich von
- Kleist, Henricus de
- Kleist, Henryk
- Kleist, Henryk von
- Klejst, Genrich fon
- Kljajst, Genrich
- Kuraisuto
- Ḳlaisṭ, Hainrikh fon
- Qleist, Heinrik fon
- Клейст, Генрих фон
- קלייסט, היינריך פון
- クライスト, ハインリヒ/フォン
- ハインリヒ・フォン・クライスト
- 克來斯特
- 克莱斯特, 冯/海因里希
- 海因里希‧冯‧克莱斯特
- Curaisuto
Vernetzte Angebote
- Bach - digital [2017-]
- * Filmportal [2010-]
- * Historisches Lexikon der Schweiz (HLS) [2001-2014] Autor/in: Hans-Jürgen Schrader (2007)
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- * Sächsische Biografie [1999-]
- Bio-bibliographisches Register zum Archiv der Franckeschen Stiftungen [1995-]
- * Neue Deutsche Biographie (NDB) [1980] Autor/in: Müller-Seidel, Walter (1980)
- * Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) [1875-1912] Autor/in: Bamberg, Felix (1882)
- * Kalliope-Verbund
- Archivportal-D
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- * Manuscripta Mediaevalia
- * Personen im Personenverzeichnis der Fraktionsprotokolle KGParl [1949-]
- Bach - digital [2017-]
- Carl Maria von Weber - Gesamtausgabe [2006-]
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Briefwechsel zwischen Eduard Spranger und Käthe Hadlich
- Jean Paul – Sämtliche Briefe 🔄 digital
- Edition der Tagebücher Erich Mühsam's
- Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte
- Kritische Online-Edition der Tagebücher Michael Kardinal von Faulhabers (1911–1952)
- EGO European History Online
- Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13)
- Forschungsplattform zu den "Großen Deutschen Kunstausstellungen" 1937-1944
- Universitätssammlungen
- * Historisches Lexikon Bayerns
- * Forschungsdatenbank so:fie Personen
- * Briefe an Goethe - biografische Informationen
- Personenliste "Simplicissimus" 1896 bis 1944 (Online-Edition)
- * Katalog des Deutschen Kunstarchivs (DKA) im Germanischen Nationalmuseum
- Katalog des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB)
- * Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek München (BSB)
- Deutsche Digitale Bibliothek
- Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL)
- Normdateneintrag des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB)
- * Deutsches Literaturarchiv Marbach - Kallías
- Österreichischer Bibliothekenverbund (OBV)
- Gemeinsamer Verbundkatalog (GBV)
- Isis Bibliography of the History of Science [1975-]
- * Manuscripta Mediaevalia
- * Literaturnachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- * Werknachweis in der Neuen Deutschen Biographie (NDB)
- Nordrhein-Westfälische Bibliographie (NWBib)
- * Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte München - Berlin
- * musiconn - Für vernetzte Musikwissenschaft
- Personen im Fachinformationsdienst Darstellende Kunst
- Sächsische Bibliographie
- Niedersächsische Personen
- Deutsches Textarchiv (Autoren)
- Index Theologicus (IxTheo)
- * Jahresberichte für deutsche Geschichte - Online
- * Internationales Quellenlexikon der Musik (RISM)
- * Bildarchiv des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung
- Archivportal-D
- Pressemappe 20. Jahrhundert
- Forschungsplattform zu den "Großen Deutschen Kunstausstellungen" 1937-1944
- Interaktiver Katalog des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz
- * Bildindex der Kunst und Architektur - GND-referenzierte Personen [2018]
Verknüpfungen
Personen in der NDB Genealogie
Personen im NDB Artikel
- ADB 42 (1897), S. 404 (Wieland, Christoph Martin)
- NDB 1 (1953), S. 411 (Ascher, Saul)
- NDB 3 (1957), S. 191 (Chamisso, de Boncourt, Louis Charles Adélaïde, genannt Adelbert von Chamisso)
- NDB 12 (1980), S. 27 (Kleist von Nollendorf, Friedrich Heinrich Graf (preußischer Graf als Kleist von Nollendorf 3.6.1814))
- NDB 13 (1982), S. 114* (Krug, Wilhelm Traugott)
- NDB 18 (1997), S. 586 (Muncker, Franz)
- NDB 23 (2007), S. 612 in Artikel Schubert, Gotthilf Heinrich von
- NDB 23 (2007), S. 182 (Schmidt, Franz Erich)
- NDB 24 (2010), S. 235 in Artikel Sembdner, Helmut
- NDB 26 (2016), S. 253 in Artikel Tieck, Ludwig
- NDB 26 (2016), S. 627 in Artikel Ungar, Frederick
- NDB 27 (2020), S. 20-21 in Artikel Vogel, Henriette (Vogel, Henriette)
- NDB 27 (2020), S. 131 (Voss, Peter Gert)
- NDB 27 (2020), S. 720 (Wekwerth, Manfred)
- NDB 27 (2020), S. 838 (Werner, Oskar)
- NDB 27 (2020), S. 840 (Werner, Friedrich Ludwig Zacharias)
Orte
Symbole auf der Karte
 Geburtsort
Geburtsort
 Wirkungsort
Wirkungsort
 Sterbeort
Sterbeort
 Begräbnisort
Begräbnisort
Auf der Karte werden im Anfangszustand bereits alle zu der Person lokalisierten Orte eingetragen und bei Überlagerung je nach Zoomstufe zusammengefaßt. Der Schatten des Symbols ist etwas stärker und es kann durch Klick aufgefaltet werden. Jeder Ort bietet bei Klick oder Mouseover einen Infokasten. Über den Ortsnamen kann eine Suche im Datenbestand ausgelöst werden.
-
Kleist, Heinrich
Dichter, * 18.10.1777 Frankfurt/Oder, † (Freitod) 21.11.1811 am Wannsee bei Berlin. (evangelisch)
-
Genealogie
V Friedrich (1728–88), preuß. Major, S d. Bernd (1680–1749), auf Schmenzin, Stabskapitän, u. d. Hedwig Magdalena v. Kleist;
M Juliane Ulrike (1746–93), T d. Otto Heinrich v. Pannwitz, auf Babow, u. d. Juliane Charlotte v. Schönfeldt;| B Leopold (1780–1837), preuß. Major, später Postmeister in Stolp;
Schw Friederike (1775–1811, ⚭ 1794 Philipp v. Stojentin, auf Schowin b. Stolp), Auguste (1776–1818, ⚭ 1802 Wilhelm v. Pannwitz);
Halb-Schw Ulrike (1774–1849); Vt 2. Grades →Friedrich Heinrich (s. 4); Cousine Marie geb. v. Gualtieri (1761–1831); - ledig; Braut →Wilhelmine v. Zenge (1780–1852, ⚭ 1803 →Wilh. Traugott Krug, 1770–1842, Prof. d. Philos. in Leipzig, s. ADB 17). -
Biographie
Wie Hölderlin gehört K. aufgrund seiner ungewöhnlichen Wirkung im 20. Jahrhundert zu den Dichtern der klassisch-romantischen Literaturepoche, denen vielfach zeitlose Modernität zuerkannt wird. Sein Leben ist von Rätseln umgeben, und als rätselhaft hat er selbst menschliches Dasein wiederholt bezeichnet. Um so wichtiger sind historischer Kontext und biographischer Zusammenhang. Die aus Pommern stammende, ursprünglich slawische Familie fühlte sich dem preußischen Staat eng verbunden. Sie hatte ihm zahlreiche Generale geschenkt, und Offizier zu werden, entsprach einer als selbstverständlich angesehenen Tradition. K. hat ohne Frage an der Last dessen getragen, was Familie heißen kann. Diese Last bekam er zumal seit der Zeit zu spüren, in der er sich zu den Traditionen seiner Familie in Widerspruch setzte. Denn anders als der angesehene Vorfahre Ewald von Kleist, der Offizier blieb und nebenher dichtete, verließ K. die Armee, um sich bald ganz seinem Dichterberuf zu widmen. Die so gewählte Lebensform galt es zu beweisen, und Ehrgeiz blieb auch aus diesem Grund bis an das Lebensende eine Triebfeder seines schriftstellerischen Tuns. Das Ringen mit dem Stoff des „Robert Guiskard“ ist eindrucksvoller Beweis: „Ich habe nun ein Halbtausend hinter einander folgender Tage, die Nächte der meisten mit eingerechnet, an den Versuch gesetzt, zu so vielen Kränzen noch einen auf unsere Familie herabzuringen: jetzt ruft mir unsere heilige Schutzgöttin zu, daß es genug sei“ (5.10.1803). Daß die Familie diesem Dichter zum „Schicksal“ werden mußte und geworden ist, ist bis in seine letzten Lebenstage hinein zu verfolgen. Zehn Tage vor dem Freitod kommt er im Brief an Marie von Kleist, eine angeheiratete Cousine, darauf zu sprechen. Er teilt ihr mit, daß es ihm ganz unmöglich sei, länger zu leben, und bezieht sich dabei auf Erfahrungen mit den nächsten Verwandten: „Ich habe meine Geschwister immer … von Herzen lieb gehabt; so wenig ich davon gesprochen habe, so gewiß ist es, daß es einer meiner herzlichsten und innigsten Wünsche war, ihnen einmal, durch meine Arbeiten und Werke, recht viel Freude und Ehre zu machen …, aber der Gedanke, das Verdienst, das ich doch zuletzt, es sei nun groß oder klein, habe, gar nicht anerkannt zu sehn, und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehn, ist mir überaus schmerzhaft …“ (10.11.1811).
Familie, wie sie erfahren wurde – von Schuld kann nicht die Rede sein –, wird zum dichterischen Motiv. Das erste Drama mit dem definitiven Titel „Die Familie Schroffenstein“ wurde von Anfang an als eine Familientragödie konzipiert. Zwischen beiden Häusern desselben Geschlechts wird ein Erbvertrag abgeschlossen, der die Beziehungen vergiftet. Aus Mißtrauen entsteht Mord. Das Ende ist schrecklich: Eine Katastrophe, die gerade die Unschuldigen, Agnes und Ottokar, ins Verderben reißt. Eine der unerbittlichsten Novellen, die K. geschrieben hat, handelt von einem „Findling“, den ein Ehepaar adoptiert. Aber eine Familie kommt nicht eigentlich zustande, weil man sich voreinander verschließt. Das Ende ist auch hier eine Katastrophe: Dem Findling wird zuletzt von seinem Adoptiwater, einem ehrbaren Kaufmann, das Gehirn an der Wand eingedrückt. Dieser seinerseits wird mit dem Strange vom Leben zum Tod gebracht, wie es abschließend heißt. Im „Zweikampf“ wird die wehrlose Littegarde von ihren am Erbe interessierten Brüdern unbarmherzig aus dem Hause gejagt. Ungeheuerliches geschieht im „Erdbeben in Chili“. Ein wie durch ein Wunder vom Tode errettetes Liebespaar wird im blinden Fanatismus der aufgebrachten Menge erschlagen, und nur sein Kind bleibt am Leben. Einer der Bürger Santiagos, der das eigene Kind während des Aufruhrs verloren hat, nimmt „den kleinen Findling zum Pflegesohn an“ – als müsse Familie nicht unbedingt in blutsverwandtschaftlichen Beziehungen bestehen.
Mit den Traditionen seiner Familie brach der junge K., als er sich entschloß, aus dem Militärdienst auszuscheiden. Der zum Offizier bestimmte Adelssproß, der im Juni 1792 in das Potsdamer Garderegiment eingetreten und zum Leutnant avanciert war, unterschrieb am 17.4.1799 einen Revers, in dem ausgesprochen ist, daß er nach Absolvierung seiner Studien dem König und dem Vaterland im Zivilstande dienen wolle. Gänzlich unvorbereitet kam dieser Entschluß nicht. Schon als Teilnehmer am Rheinfeldzug hatte K. 1795 im Brief an seine Schwester geäußert: „Gebe uns der Himmel nur Frieden, um die Zeit, die wir hier so unmoralisch|töten, mit menschenfreundlicheren Taten bezahlen zu können!“ Auch das frühe Gedicht „Der höhere Frieden“ verrät, daß ihn der Soldatenberuf offensichtlich wenig befriedigt. Rückblickend bekannte er, daß es ihm mehr und mehr zweifelhaft geworden sei, ob er als Mensch oder Offizier habe handeln müssen: „denn die Pflichten beider zu vereinen, halte ich bei dem jetzigen Zustande der Armeen für unmöglich“ (19.3.1799). An der Universität Frankfurt an der Oder wurde das Studium aufgenommen, vornehmlich in den Fächern Mathematik, Physik und Philosophie. Sie werden als die „Grundfesten alles Wissens“ bezeichnet, und daß zumal die Mathematik als die strengste aller Wissenschaften zu gelten habe, hätte er in Kants „Kritik der reinen Vernunft“ bestätigt gefunden. Obgleich die mit so viel Begeisterung ergriffene Wissenschaft bald wieder aufgegeben wurde, blieb die Mathematik weiterhin ein vertrauter Gegenstand; auch in die dichterische Vorstellung wirkte sie noch gelegentlich hinein. „Ich kann ein Differentiale finden, und einen Vers machen; sind das nicht die beiden Enden der menschlichen Fähigkeit?“, heißt es in einem Brief vom 7.1.1805 an Ernst von Pfuel; und noch in der spätesten Zeit, im Aufsatz über das Marionettentheater, werden Logarithmen, Asymptoten und Hyperbeln zum Vergleich herangezogen. Der Abschied vom Militärdienst und die Entscheidung für das Studium werden in einem umfangreichen Bekenntnisbrief vom 18./19. März 1799 an den früheren Hauslehrer Christian Ernst Martini gerechtfertigt: Das Denken wird bestimmt vom Entwurf eines Lebensplans, an den sich der aus nahezu allen Bindungen Gelöste zu halten gedenkt. Die rationalen Elemente einer noch stark von der späten Aufklärung bestimmten Kultur sind unverkennbar. Die Bewußtseinslage des angehenden Studenten, wie sie sich in diesem Brief spiegelt, ist gleichwohl komplex. Zeitgemäße Ideen – wie die Idee der Bildung – werden von älteren Denkmustern überlagert. Aber die eigene Denkart verleugnet sich deswegen keineswegs. Sie äußert sich in der Entschiedenheit seiner Auffassungen wie in einer Sprache, die paradoxe Wendungen liebt: „Wenn man also nur seiner eigenen Überzeugung folgen darf und kann, so müßte man eigentlich niemand um Rat fragen, als sich selbst, als die Vernunft“. Damit verbindet sich für den jungen K. die Auffassung, daß kein denkender Mensch sich der Autorität eines anderen unterwerfen solle. Zum Zweifel an der überlieferten Autorität gesellt sich ein geschichtliches Bewußtsein besonderer Art, ein Bewußtsein des Umbruchs, das ihm rät, „in dieser wandelbaren Zeit so wenig wie möglich an die Ordnung der Dinge zu knüpfen.“ Der Wissenschaft wird bedingungslos vertraut, und daß von ihr zugleich die Lösung eigener Probleme erhofft wird, ist nicht zu übersehen. Im fast bedingungslosen Vertrauen auf das, was Wissenschaft für die eigene Lebensführung bedeuten kann, sind die zahlreichen Krisen angelegt, die den Lebensweg fortan begleiten.
Die Reihe dieser Krisen begann mit Symptomen einer Sprachkrise. Schon im Bekenntnisbrief vom März 1799 machten sie sich bemerkbar. Die Tugend, fester Bestandteil im Wertsystem der Aufklärung, wird auf sehr unaufklärerische Art als etwas erfahren, für das K. vergebens ein Wort sucht. Deutlicher spricht er sich in einem Brief an die Schwester (vom 5.2.1801) über die Sprachnot aus, um die es sich handelt: „… gern möchte ich Dir alles mitteilen, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich, und wenn es auch kein weiteres Hindernis gäbe, als dieses, daß es uns an einem Mittel zur Mitteilung fehlt. Selbst das einzige, das wir besitzen, die Sprache taugt nicht dazu, sie kann die Seele nicht malen, und was sie uns gibt, sind nur zerrissene Bruchstücke.“ Daß K. über dem Ungenügen an der Sprache zur Sprache seiner Dichtung fand, gehört zu den Merkwürdigkeiten seiner Entwicklung.
Die Entfernung von Studium und Wissenschaft ließ unter solchen Umständen nicht lange auf sich warten, denn mit krisenhaften Lebenssituationen suchte K. vor allem dadurch fertig zu werden, daß er sich auf Reisen begab. Mit der Würzburger Reise begann es. Sie wurde mit dem neun Jahre älteren Freund Ludwig von Brockes, einem Enkel des Dichters →Barthold Hinrich Brockes, ausgeführt. Im August 1800 brach man auf; Ende Oktober kehrte man nach Berlin zurück. Diese Reise gibt zahlreiche Rätsel auf, und K. selbst hat von sich aus alles getan, das ohnehin rätselvolle Unternehmen zusätzlich in ein mysteriöses Dunkel zu hüllen. Politische Motive einer geheimen Mission mögen hineinspielen. Der eigentliche Anlaß sind sie nicht; er liegt in der Person des jungen K., im Psychischen wie im Somatischen seines damaligen Zustandes. Schwierigkeiten im Sexuellen sind in Rechnung zu stellen, und daß man in Würzburg den dortigen Stadtchirurgen Joseph Wirth aufgesucht hat, ist bezeugt. Diese Reise versteht man vermutlich am besten, wenn man sie nicht als eine Flucht auffaßt, vielmehr als eine „Suche nach der Identität des Menschen“ (H. Politzer).|Auch handelt es sich nicht nur um eine Zeit der Krankheit und der Krisen. Die Briefe und Berichte dieser Monate sind in einem vielfach euphorischen Ton verfaßt. Der Gedanke, den Bedrängnissen gegenüber nicht nachzugeben, sondern standzuhalten, wird erstmals hier, soweit man sieht, erwogen. Ein Vertrauen in die eigenen schöpferischen Kräfte beginnt sich zu regen. Es findet seinen Ausdruck im Bild des Gewölbes, mit dem rückblickend die eigene Lebenssituation zu umschreiben gesucht wird. „Warum, dachte ich, sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch keine Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine auf einmal einstürzen wollen – und ich zog aus diesem Gedanken einen unbeschreiblich erquickenden Trost, der mir bis zu dem entscheidenden Augenblicke immer mit der Hoffnung zur Seite stand, daß auch ich mich halten würde, wenn alles mich sinken läßt“ (16.11.1800). Die Erfahrung wird später in die „Penthesilea“ eingehen, in die Verse: „Steh, stehe fest, wie das Gewölbe steht/Weil seiner Blöcke jeder stürzen will.“ Eine Entscheidung für das „Geschäft des Dichters“ und gegen die Wissenschaft ist damit noch nicht gefallen. Das Verhältnis der Wissenschaft (als Philosophie) zur Dichtung bleibt vorerst noch ungeklärt, und von der Zeitlage her kann man sich, seit etwa 1795, dieses Verhältnis nicht spannungsvoll genug vorstellen. Auch für die Zeitsymptomatik ist die Person von K.s Freund Brockes aufschlußreich. Die Skepsis gegenüber Vielwisserei und einseitiger Wissenschaft war bei ihm ausgeprägt, wie wir aus den Briefen erfahren; aber ausgeprägt nicht minder waren die wiederholt bezeugten Berufungen auf das Gefühl: „Immer seiner ersten Regung gab er sich hin, das nannte er seinen Gefühlsblick.“ Ein tiefes Gefühl für Recht sei in Brockes herrschend gewesen. An ihm muß K. aufgegangen sein, wie die Welt beschaffen sein könnte, wenn jeder – wie dieser Freund – „seinen eigenen Vorteil gegen den Vorteil des andern vergäße“. Damit sind auch die gesellschaftskritischen Gesichtspunkte genannt, die K. durch Brockes offensichtlich vermittelt wurden. Die Einwirkungen Rousseaus stehen damit im engsten Zusammenhang. Zugleich sieht man sich auf die angesehene Göttinger Universität verwiesen. Hier hatte Brockes seine Studienjahre verbracht. An diese Universität war er 1796 als Hofmeister eines Herrn von Dewitz zurückgekehrt. In diesen Jahren lehrte hier neben anderen der Philosoph und Schriftsteller Friedrich Bouterwek, dessen Briefroman „Graf Donamar“ nicht ohne Einfluß auf Hölderlins „Hyperion“ gewesen ist. Als junger Gelehrter hatte sich Bouterwek für die Kantische Philosophie begeistert, aber als er 1796 eine Professur erhielt, erfolgte die Wende. Aus dem Jünger der Kantischen Philosophie wurde ihr unerbittlicher Kritiker. Diese Kritik fand ihren Niederschlag in einem Werk mit dem Titel „Idee einer Apodiktik. Ein Beitrag zur menschlichen Selbstverständigung und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik, kritische Philosophie und Skeptizismus“ (2 Bände, 1799). Sein Verfasser wendet ein, daß im Hinblick auf Kant und Fichte ein Kategoriensystem nicht ausreiche, „das nur die logische Form des Erkennens in der Erfahrung bestimmt“. Die Logik wird als arme Logik bedauert. Bouterwek übt Kritik an der Art des Begründens. Er fragt nach dem Grund aller Beweise und fragt damit nach dem Grund eines absoluten Seins. Mit der Idee des Absoluten erscheint das Gefühl eng verknüpft: „Da aber Denken und Empfinden im Gemüthe unzertrennbar verbunden sind, ist das Bewußtsein auch ein Gefühl, und zwar vernünftiges Selbstgefühl. “ Von der absoluten Unmöglichkeit des Erkennens ist die Rede. Von hier führt der Weg zur Rechtfertigung der Kunst und der dichterischen Einbildungskraft. Die Anschauungen Brockes' sind ein getreues Spiegelbild solchen Denkens. Die persönlichen Beziehungen verdichten sich in der Person Julie Westfelds. K. hat sie kennengelernt, als er sich im Juni 1801 in Göttingen aufhielt; sie wurde 1806 die Gemahlin Bouterweks.
Damit ist die sich entwickelnde Kantkrise K.s nicht erklärt. Aber ihre zeitgeschichtliche Symptomatik wird deutlich, die es uns verwehrt, die Verzweiflung an der Philosophie Kants als ein Problem der Philosophiegeschichte zu isolieren. Diese Krise wird im Frühjahr 1801 akut. Davon handelt ein Brief an die Schwester vom 23.3.1801: „Es scheint, als ob ich eines von den Opfern der Torheit werden würde, deren die Kantische Philosophie so viele auf das Gewissen hat … Mein einziges und höchstes Ziel ist gesunken, ich habe keines mehr. Seitdem ekelt mich vor den Büchern, ich lege die Hände in den Schoß und suche ein neues Ziel …“ Daß das auslösende Moment die „Kritik der Urteilskraft“ mit der in ihr entwickelten Kritik der teleologischen Urteilskraft gewesen sein könnte, wurde mit überzeugenden Argumenten (von L. Muth) begründet. Dennoch sind Einschränkungen angebracht. Denn der auslösenden Schrift kommt eine gewisse Zweitrangigkeit zu gegenüber dem philosophischen System im ganzen, das solche Krisen wiederholt bewirkte. Sie sind im Falle Friedrich Schlegels, Hardenbergs oder Hölderlins ebenso nachweisbar wie im Falle Bouterweks. Einem abstrakten Denksystem wird die eigene „konkrete“ Poesie entgegengesetzt. Zum zweiten sind Einschränkungen angebracht, weil zumal bei K. die individuelle Lebenssituation samt allen psychosomatischen Faktoren zu bedenken bleibt. Was mit dem Abschied vom Militärdienst eingeleitet worden war, setzt sich in der Kantkrise fort. Sprachkrise, Lebenskrise und Kantkrise sind als eine Einheit anzusehen. Mit der Verzweiflung an einer Philosophie, die nicht gewährt, was von ihr erhofft worden war, verbindet sich eine rigorose Kritik am Wissenschaftsbetrieb der Zeit, die sich wiederholt in Äußerungen des Unmuts niederschlägt: „Diese Menschen sitzen sämtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt, seines sei das beste, und um den Baum bekümmern sie sich nicht“ (5.2.1801). Daß K. sich von Wissenschaft und Philosophie auch deshalb enttäuscht abgewandt hatte, weil sie zur Bewältigung eigener Lebensprobleme wenig oder nichts beizutragen vermochten, verrät ein 1801 in Paris geschriebener Brief: „… die Menschen sprechen mir von Alkalien und Säuren, indessen mir ein allgewaltiges Bedürfnis die Lippe trocknet …“ (21.7.1801). Der Entstehungshintergrund seiner Dichtung ist damit umrissen. Gegenüber der zeitgenössischen Philosophie und Wissenschaft wie gegenüber der Gesellschaft und ihren Institutionen wird sie zur Gegenposition in einem schöpferischen Sinn. Damit fällt vom Ende dieser drangvollen Zeit noch einmal ein Licht auf die Würzburger Reise: „Sie war die Ausgangsstation eines Passionsweges, der von Krise zu Krise in ein Schöpfertum von einzigartigem Rang führte“ (H. Politzer).
Nach der Rückkehr von Würzburg hatte K. im November 1800 eine Anstellung als Volontär im preußischen Wirtschaftsministerium erhalten. Das hinderte ihn nicht, sich erneut auf Reisen zu begeben. Diesmal begleitete ihn die Schwester. Im Sommer 1801 gelangten sie über Dresden, Leipzig, Halberstadt, Göttingen, Mainz und Straßburg nach Paris. Noch war die Wissenschaft nicht verabschiedet, und es besteht kein Grund, die Wahrheit einer brieflichen Aussage zu bezweifeln: „Von mir kann ich Ihnen nur so viel sagen, daß ich wenigstens ein Jahr hier bleiben werde, das Studium der Naturwissenschaft auf dieser Schule der Welt fortzusetzen“ (18.7.1801). Die Stadt selbst wird in düsteren Farben geschildert. Verrat, Mord und Diebstahl seien an der Tagesordnung; die Menschen seien sich fremd (16.8.1801). Hinter solcher Kritik steht unverkennbar Rousseau; auch die vielfach radikal formulierte Wissenschaftskritik weist auf ihn und seine berühmte Akademieschrift zurück, deren Gedankengehalt sich bis in die wörtlichen Anklänge hinein in den Briefen widerspiegelt. Von der Wissenschaftskritik bis zur umfassend gemeinten Kritik an der bestehenden Gesellschaft ist es nur ein Schritt, Kantkrise, Rousseauverständnis und eigene Dichtung liegen nahe beieinander. Das eigene Leben ist immer weniger ablösbar von Literatur, und Literatur wird in Leben umzusetzen gesucht. K. strebte im wörtlichsten Sinne zurück zur Natur. Er wählte die Schweiz als Aufenthalt, um in einer bäuerlichen Lebensform zu verwirklichen, was in der Literatur – von Rousseau und anderen – verheißen worden war. Noch ehe er hier eintraf, suchte er die Braut zu der neuen, in Aussicht genommenen Lebensform als „Bauersfrau“ zu überreden. In einer vorübergehend beruhigten Atmosphäre erlebte er als Dichter die erste fruchtbare Schaffenszeit. Hier zum erstenmal ist eigene Dichtung als etwas Gewordenes und Vorhandenes bezeugt. Das Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ wurde konzipiert; Teile eines „Guiskard“-Dramas wurden ausgearbeitet, und das erste abgeschlossene Drama, „Die Familie Schroffenstein“, wurde im Kreise der neuen Freunde vorgelesen. Es waren dies →Heinrich Zschokke, Heinrich Geßner (der Sohn des bekannten Idyllendichters) und Ludwig Wieland, der Sohn Christoph Martin Wielands. Der Aufenthalt endete mit Krankheit und „Zusammenbruch“, was immer man darunter verstehen will. Gemeinsam mit der Schwester und Ludwig Wieland reiste man im Spätherbst 1802 nach Weimar. Auf Wielands Landgut in Oßmannstedt fand K. freundlichste Aufnahme. Hier vor allem erfuhr er zum erstenmal den Zuspruch, nach dem er als Dichter verlangte. Wieland erhielt eines Tages Einblick in die ausgeführten Teile des „Robert Guiskard“, und vorzüglich auf diesen Eindruck bezieht sich die spätere Äußerung: „Wenn die Geister des Äschylus, Sophokles und Shakespeare sich vereinigten, eine Tragödie zu schaffen, so würde das sein, was K.s, Tod Guiscards des Normanns', sofern das Ganze demjenigen entspräche, was er mich damals hören ließ. Von diesem Augenblicke war es bei mir entschieden, K. sei dazu geboren, die große Lücke in unserer dermaligen Literatur auszufüllen, die (nach meiner Meinung wenigstens) selbst von Goethe und Schiller noch nicht ausgefüllt worden ist …“ (Lebenspuren, S. 59). Auf den|wiederholten Vortrag eigener Werke folgte die erste Publikation. Unter dem Titel „Die Familie Schroffenstein. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen“ erschien das Drama 1803 anonym im Verlag Heinrich Geßners.
Im Hause Wielands hielt es K. bis zum Frühjahr 1803: „Ich habe das Haus mit Tränen verlassen … Aber ich mußte fort! O Himmel, was ist das für eine Welt!“ heißt es in einem Brief an die Schwester vom 13./14. März. Der ersten Schweizer Reise folgte die zweite unmittelbar. Diesmal war es der treue Ernst von Pfuel, späterer Ministerpräsident in Preußen, der ihn begleitete. Bern, Mailand und Genf waren einige Stationen dieser Fußreise. Im Herbst 1803 traf K. zum zweitenmal in Paris ein. In einer Situation der Verzweiflung am eigenen Werk verbrannte er das Manuskript „Robert Guiskard“. „Wie von der Furie getrieben“, begab er sich ohne den Freund dorthin, wohin sich auch Hölderlin wenige Jahre zuvor begeben hatte: in den Westen Frankreichs; nur daß diesmal nicht Bordeaux, sondern das nördlich gelegene Boulogne das Ziel des ruhelosen Dichters war. Aber eigentlich war nicht irgendein Ort das Ziel, sondern der Tod: „… ich werde den schönen Tod der Schlachten sterben, … werde französische Kriegsdienste nehmen, das Heer wird bald nach England hinüber rudern, unser aller Verderben lauert über den Meeren, ich frohlocke bei der Aussicht auf das unendlichprächtige Grab“, schrieb er am 26. Oktober der Schwester aus St. Omer. Auch diese Reise endete mit einem „Zusammenbruch“. In Mainz nahm sich der Arzt Georg Christian Wedekind des kranken Dichters an. Im Juni 1804 kehrte K. nach Berlin zurück. Aber schon in der Schweiz, im Sommer 1802, hatte er das Verlöbnis mit Wilhelmine von Zenge gelöst. Sie wurde bald darauf die Gemahlin des Philosophen W. T. Krug, des Nachfolgers auf dem Lehrstuhl Immanuel Kants. „Liebes Mädchen, schreib mir nicht mehr. Ich habe keinen andern Wunsch als bald zu sterben“, lautet der letzte Satz seines Abschiedsbriefes. Was in den Monaten dieser undurchsichtigen Reise geschehen war, ist schwer „einzuordnen“. K. selbst war nicht imstande, es zu tun: „Ich selber habe seit meiner Krankheit die Einsicht in ihre Motive verloren, und begreife nicht mehr, wie gewisse Dinge auf andere erfolgen konnten“ (29.7.1804). Doch war nicht unbekannt geblieben, wo es ihn umhergetrieben hatte. Seine Wiederverwendung im preußischen Staatsdienst war damit erschwert. Der Adjutant des Königs, General von Köckeritz, hielt es ihm in einer Audienz vor. Vieles kam zusammen, um die Bedenken zu verstärken: der Adlige, der die Armee verlassen hatte; die wirren, womöglich revolutionären Gedanken, die ihn nach Frankreich geführt haben könnten; und die Krankheit obendrein. Dennoch wurde mit Hilfe einflußreicher Freunde die Wiedereinstellung erreicht. Marie von Kleist scheint daran nicht unbeteiligt gewesen zu sein. Im Herbst 1804 wurde dem Antrag stattgegeben; im Mai 1805 erfolgte die Versetzung an die Domänenkammer nach Königsberg. K. wurde damit in das Zentrum der preußischen Reform versetzt. Sein nächster Vorgesetzter war der spätere Finanzminister Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein, zu dem freundschaftliche Beziehungen hergestellt wurden. An der Universität lehrte der Staatswissenschaftler Christian Jakob Kraus, ein dezidierter Anhänger von Adam Smith. Politische Aktivität wurde aus nächster Nähe beobachtet, aber die eigene Dichtung kam nicht zu kurz: Die Dienststunden waren knapp bemessen, und für literarische Arbeit blieb genügend Zeit. Erzählungen wie „Michael Kohlhaas“ und „Die Marquise von O …“ wurden gefördert, ebenso „Amphitryon“ und „Penthesilea“. Aber der Widerwille gegen das Amt – gegen jedes Amt – regte sich gleichwohl. Am 30.6.1806 war es so weit, Freiherr vom Stein zum Altenstein wurde um Entpflichtung von allen Ämtern gebeten: „Ein Gram, über den ich nicht Meister zu werden vermag, zerrüttet meine Gesundheit. Ich sitze, wie an einem Abgrund … das Gemüt immer starr über die Tiefe geneigt, in welcher die Hoffnung meines Lebens untergegangen ist …“ Der Versuch, in der bürgerlichen Gesellschaft eine berufliche Existenz aufzubauen, war damit abermals mißlungen. Der Dichterberuf erhielt Vorrang vor jeder anderen Tätigkeit.
Die Wahl einer neuen Wirkungsstätte fiel auf Dresden. Schon zu Beginn seiner Wanderjahre, im Sommer 1801, hatte K. an der sächsischen Residenzstadt Gefallen gefunden. Ein bewegender Brief aus Paris an eine Freundin (Karoline von Schlieben) gibt darüber Auskunft: Hier, wenn irgendwo, hatte er so etwas wie Heimat erfahren. Aber der Entschluß, sich in Dresden als Schriftsteller niederzulassen, wurde auf unvorhersehbare Weise durchkreuzt: Auf dem Wege in die sächsische Hauptstadt wurde K. im Januar 1807 vor den Toren Berlins von napoleonischen Truppen verhaftet und als Gefangener nach Frankreich gebracht. Auf dem Fort Joux und danach in Châlons-sur-Marne hatte er mehrere Monate zuzubringen, ehe er im Juli 1807 entlassen wurde. Die unfreiwillige Muße war seiner dichterischen Arbeit zugute gekommen Die Tragödie „Penthesilea“ wurde entscheidend gefördert, so daß sie im Herbst desselben Jahres abgeschlossen werden konnte. Mit der Gattungsbezeichnung „Ein Trauerspiel“ ist sie 1808 bei Cotta als Buch erschienen. Schon im März 1807 hatte Adam Müller das in der Gefangenschaft fertiggestellte Lustspiel „Amphitryon“ herausgegeben, nachdem das Manuskript an eine Dresdner Buchhandlung vermittelt worden war. Schließlich traf K. im August 1807 in Dresden ein. Man bezeichnet diesen Aufenthalt zumeist als K.s glücklichste Zeit. Es war gleichwohl ein kurzes Glück, zu dem sicher die Anwesenheit der treuen Freunde, Ernst von Pfuels und Otto August Rühles von Lilienstern, das meiste beitrug. In der Verwirklichung seiner schriftstellerischen Pläne stand ihm am nächsten der so vielseitige wie schillernde Adam Müller, der das geistige Leben Dresdens eine Zeitlang maßgeblich bestimmte. Wie sein Einfluß auf die hier entstandenen Dichtungen einzuschätzen ist und in welcher Weise Müller seinerseits von K. beeinflußt wurde, muß offen bleiben. Mit ihm gab K. die vielbeachtete Monatsschrift „Phöbus“ heraus, deren erstes Heft im Januar 1808 erschien. Mehrere Werke K.s – darunter das Fragment „Robert Guiskard“ – wurden hier zuerst, vollständig oder in Teilabdrucken, veröffentlicht. Bedeutende Persönlichkeiten wie Gotthilf Heinrich Schubert, Carl Gustav Carus oder →Caspar David Friedrich hielten sich damals in Dresden auf. Die „Entdeckung des Unbewußten“ ist mit dem Namen dieser Stadt vor allem verknüpft. Hier hielt Schubert seine vielbeachteten Vorlesungen über die Nachtseiten der Natur: über Magnetismus, Somnambulismus und verwandte Phänomene. Er wurde für E. T. A. Hoffmann wie für K. einer der wichtigen Vermittler romantischer Psychologie. Das betrifft vor allem dasjenige Drama, das K. als ein Gegenbild zur „Penthesilea“ verstanden hat. Unter dem Titel „Das Käthchen von Heilbronn oder die Feuerprobe, ein großes historisches Ritterschauspiel …“ ist es 1810 als Buch erschienen. Das schon in der französischen Gefangenschaft abgeschlossene Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ hatte Adam Müller an Goethe übersandt. Es wurde am 2.3.1808 in Weimar aufgeführt. Diese Aufführung wurde, nicht ohne Goethes Mitwirkung, ein eklatanter Mißerfolg. K. reagierte gereizt, er rückte wütende Epigramme in seine Zeitschrift ein; ihr Niedergang ist zum Teil dieser Polemik zuzuschreiben. Persönliche Auseinandersetzungen mit dem Freund und Mitherausgeber Adam Müller kamen hinzu. Mehr und mehr wurde ihm Dresden durch eine Reihe mißlicher Umstände verleidet. Vor allem aber zog ihn die Politik in ihren Bann. Das vaterländische Drama „Die Hermannsschlacht“, zwischen Juni und Dezember 1808 niedergeschrieben, stellte sich ganz in ihren Dienst. Die Übereinstimmung mit den Zielen der preußischen Reformer ist offenkundig. Das Drama will zum Handeln aufrufen und setzt dabei in erster Linie auf Österreich. Dem Wiener Burgtheater wurde es zur Aufführung – obschon vergeblich – angeboten; und Österreich war auch das Ziel der nächsten Reise.
K. trat sie am 29.4.1809 an. Er wurde von F. Ch. Dahlmann begleitet. Vor Wien wurden die Schlachtfelder von Aspern und Eßling besichtigt. Hier waren die Österreicher am 21./22. Mai unter Erzherzog Karl gegenüber →Napoleon siegreich gewesen. Aber nach der Niederlage von Wagram, am 5./6. Juli, sah K. seine Hoffnungen zerstört. Seine Niedergeschlagenheit findet ihren Ausdruck in einem Brief an die Schwester (vom 17. Juli). Erste Zweifel am Dichterberuf kündigen sich an. Sie signalisieren den Grad der sich nun entwickelnden Depression: „Kurz, meine teuerste Ulrike, das ganze Geschäft des Dichtens ist mir angelegt …“ Über die nächsten Monate ist wenig bekannt. Der oben erwähnte Brief an die Schwester ist vom 17. Juli datiert; das nächste Schreiben in der Sammlung der Briefe – gleichfalls an die Schwester – stammt vom 23. November. Es trägt die Ortsbezeichnung Frankfurt an der Oder. Für die Zwischenzeit sind wir auf Vermutungen, Berichte und Gerüchte angewiesen. Verbürgt ist ein Aufenthalt in Prag, wo K. ein politisches Journal herauszugeben gedachte, und abermals verwendet man in der Biographie des Dichters für das, was ihm hier widerfahren ist, den Begriff des „Zusammenbruchs“. Er soll als Kranker in ein Kloster gebracht worden sein. Das Gerücht von seinem Tod breitete sich aus. →Wilhelm Grimm spricht davon in einem Brief an seinen Bruder vom 3.10.1809. Auch Brentano will gehört haben, daß K. in einem Prager Spital verstorben sei (Lebensspuren, S. 240). Am 23.11.1809 meldete er sich aus Frankfurt/Oder zurück. Sein letzter Berliner Aufenthalt folgte. Man hat ihn als K.s „Berliner Kämpfe“ bezeichnet.
K. übersiedelte am 29.1.1810 nach Berlin. Es begann – trotz vielfacher Verdüsterung – eine überaus fruchtbare Schaffenszeit. Zu keiner Zeit auch scheint der mündliche Gedankenaustausch, der Kontakt mit Freunden und die Verabredung zu gemeinsamer Aktivität, so rege gewesen zu sein wie in den|Jahren 1810/11. Adam Müller, Achim von Arnim, →Clemens Brentano, Carl Maria von Weber, Fouqué, Rahel Levin, Varnhagen von Ense waren neben anderen die Gesprächspartner. Beziehungen zur Christlich-Deutschen Tischgesellschaft wurden gepflegt, ebenso zu den preußischen Reformern. Was sie einte und was K. durch seine schriftstellerische Arbeit zu befördern suchte, war die gemeinsame Gegnerschaft zu →Napoleon und dessen Herrschaft. Seine Niederlage war das erklärte Ziel, und die eigene Dichtung erhielt von diesem gesetzten Ziel her mehr und mehr ihre Rechtfertigung. Auch das letzte Unternehmen sollte diesem Ziel dienen: die Gründung und Herausgabe der „Berliner Abendblätter“, deren Erscheinen in der Geschichte der deutschen Journalistik etwas Einzigartiges darstellt. Literarische Beiträge werden mit politischen Absichten auf eine geschickte Art vermischt. Die Neuigkeit hat Vorrang vor anderem, und der Fleiß, den K. selbst an die Sache setzte, ist beträchtlich. Daß er damit in die Rivalitäten zwischen Konservativen und Reformern verstrickt wurde, konnte nicht ausbleiben. Mit seinen eigenen Auffassungen stand er auf der Seite der letzteren. Durch die Teilhabe an einer gemeinsamen Sache wie durch das Bewußtsein einer Tätigkeit, die dem Ganzen des Volkes zugute kommt, konnte die drohende Isolierung zeitweilig vergessen werden. Aber die Stellung zwischen den Parteien gefährdete das journalistische Unternehmen. Eingriffe einer von politischer Taktik bestimmten Zensur beeinträchtigten die Arbeit erheblich. Es kam zu Zerwürfnissen mit dem Verleger, zu Auseinandersetzungen mit der Regierung und dem Kanzler Hardenberg. Um den Belastungen standzuhalten, hätte K. Nerven haben müssen, die er nicht besaß. Die Enttäuschungen über die offizielle preußische Politik und das Zaudern des Königs führten zu einer Niedergeschlagenheit, die den letzten „Zusammenbruch“ verständlich macht. Er dürfte nicht zuletzt in den Zweifeln am „Geschäft des Dichtens“ zu suchen sein, auf das K. fast bedingungslos gesetzt hatte. Die eigene Dichtung trat in diesen letzten Wochen unverkennbar zurück hinter die Musik, von der gesagt wird, daß hier, im Generalbaß, die wichtigsten Aufschlüsse über sie zu erhalten seien. Selbst die Wissenschaft, die er auf dem Weg zur Dichtung mit bitteren Worten verabschiedet hatte, wurde als Tätigkeitsfeld erneut in Betracht gezogen. Diese Zweifel am dichterischen Tun waren möglicherweise das auslösende Moment dessen, was am 21.11.1811 am Wannsee geschah, als K., zusammen mit einer schwerkranken Frau (Henriette Vogel), aus dem Leben schied. Der wohl „verstehendsten“ Frau seines Lebens, Marie von Kleist, wird in einem bewegenden Brief mitgeteilt, was die „eigentlichen“ Motive gewesen sind. Noch einmal kommen der Konflikt mit der Familie und die versagte Anerkennung zur Sprache, auf die so viel angekommen wäre. Die Stimmung dieser letzten Lebenstage umschreibt K. wie folgt: „Aber ich schwöre Dir, es ist mir ganz unmöglich länger zu leben; meine Seele ist so wund, daß mir, ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehe tut, das mir darauf schimmert. Das wird mancher für Krankheit und überspannt halten; nicht aber Du, die fähig ist, die Welt auch aus andern Standpunkten zu betrachten als aus dem Deinigen.“ Die Verklärung des Todes, wie sie sich in den letzten Lebenszeugnissen äußert, ist von Krankheit gezeichnet. Aber der Gedanke, freiwillig aus dem Leben zu gehen, begleitet das Leben K.s von der Zeit an, seit der wir aus Briefen und anderen Lebenszeugnissen genauere Kenntnis haben. Diese das Leben begleitende „Krankheit zum Tode“ kann auf keinen Fall als ein die Dichtung belastendes Moment in dem Sinn aufgefaßt werden, als ginge sie uns als Ausdruck eines kranken Menschen nichts an. K.s dichterische Ausdruckskraft und intellektuelle Wahrnehmung wurden zu keiner Zeit, soweit aus den Zeugnissen erkennbar, beeinträchtigt, und nichts deutet darauf hin, daß wir es mit einem prozeßhaften Verlauf – wie im Falle Hölderlins – zu tun hätten. Eher scheint es sich um phasische Verläufe zu handeln, die jeweils mit dem enden, was man in der Medizin als Remission zu bezeichnen pflegt. Diese Phasen – die „Zusammenbrüche“, wie in den Biographien gesagt wird – sind zahlreich. Es hat sie nachweisbar in Bern, in Mainz, in Prag und zuletzt in Berlin gegeben. Daß die dabei gemachten Erfahrungen auch der dichterischen Ausdruckskraft zugute gekommen sind, ist nicht nachzuweisen, aber zu erwägen.
K.s Dichtung gibt trotz ausgebreiteter Forschung auch heute noch zahlreiche Rätsel auf. Rätselhaft erscheint weiterhin ihre Entstehung. Junge Dichter haben ihre Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Für K. kommen allenfalls Wieland und Schiller in Frage. Aber eine prägende Wirkung haben sie nicht ausgeübt. Schon die ersten Dichtungen wirken selbständig und auf eigentümliche Weise „fertig“. Wie es zu solcher Fertigkeit kommen konnte, ist unserer Einsicht weithin entzogen. Doch steht zu vermuten, daß sich|ihr Hervortreten während der Würzburger Reise vorbereitet. In dieser Zeit hat sich ihm ein unbeschreiblicher Trost mitgeteilt, der als Erfahrung in die spätere Dichtung eingeht: „und ich zog aus diesem Gedanken [daß das Gewölbe nicht stürzt, obwohl es keinerlei Stützen hat] einen unbeschreiblich erquickenden Trost, der mir bis zu dem entscheidenden Augenblick immer mit der Hoffnung zur Seite stand, daß auch ich mich halten würde, wenn alles mich sinken läßt.“ Seit der Würzburger Reise begleitet dieses Bilderlebnis sein Denken. Damit zeichnen sich Beziehungen zwischen dem existierenden Ich des Dichters und der Funktion von Literatur ab. Die Dichtung erhält einen eigentümlich existentiellen Sinn, der keineswegs ungeschichtlich verstanden werden muß. Ein solches Dichtungsverhältnis ist durchaus zeittypisch. In Goethes „Torquato Tasso“ erscheint der Dichter als einer, der mit seinen Leiden bezahlt, was er ist. Dichtung hört auf oder hat aufgehört, nur Schmuck und Zier der Gesellschaft zu sein. Sie ist in der Fähigkeit, das erfahrene Leid sagen zu können, das Gegenteil von dem, was als unverbindliches Spiel aufgefaßt werden könnte. Gegen solche Auffassungen wendet sich Hölderlin: „Man hielt sich bloß an ihre anspruchslose Außenseite. … man nahm sie für Spiel, und so konnte sich auch vernünftiger weise keine andere Wirkung von ihr ergeben, als die des Spiels, nämlich Zerstreuung, beinahe das gerade Gegentheil von dem, was sie wirket, wo sie in ihrer wahren Natur vorhanden ist“ (1.1.1799). Von K. werden Auffassungen wie diese mit der ihm eigenen Entschiedenheit aufgenommen. Dichtung wird zur Lebensform. Dem entspricht, was am 31.8.1806 gegenüber Rühle von Lilienstern ausgesprochen wird: „Wär ich zu etwas anderem brauchbar, so würde ich es von Herzen gern ergreifen: ich dichte bloß, weil ich es nicht lassen kann.“ Und ähnlich gegenüber dem Verleger Cotta Ende Juli 1808: „Wenn ich dichten kann … so sind alle Ansprüche an dieses Leben erfüllt.“ Das Leben wird aufgegeben in dem Augenblick, in dem das Vertrauen in die eigene Dichtung aufgegeben wird – mit der Erwägung, „die Kunst vielleicht auf ein Jahr oder länger ganz ruhen [zu] lassen.“
Die Denkfigur, die sich im Entstehungsgebiet der Dichtung ausbildet und später in sie eingeht, ist das Paradox: zu stehen, obgleich alles zu stürzen scheint. Sie äußert sich als Verkehrung des Gewohnten: Die seelenlose Marionette wird zum beseeltesten Wesen schlechthin; als Struktur des Widerspruchs wie in der „Marquise von O. . …“: „er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht, bei seiner ersten Erscheinung, wie ein Engel vorgekommen wäre.“ Bis in die Sprachfügung hinein ist diese Grundfigur zu verfolgen. Das Prosastück „Von der Überlegung“ wird im Untertitel eine Paradoxe genannt, und paradox an ihr ist der Rat, den der Sprecher als Vater seinem Sohn gibt: daß nämlich die Überlegung schicklicherweise ihren Zeitpunkt nach der Tat und nicht vor der Tat finden möge. Mit solchen Denkformen geht die Vorliebe für das einher, was im „Marionettentheater“ als das Antigrave verherrlicht wird. Damit wird e contrario auf Schwerkraft und physikalische Gesetzlichkeit verwiesen. Diese Denkfigur scheint sich gleichfalls im Entstehungsgebiet der späteren Dichtung zu entwickeln. In einem Brief vom 30.12.1800 wird von Newton gesagt, er sei im Nachdenken über einen vor die Füße gefallenen Apfel zu dem Gesetz gelangt, „nach welchem die Weltkörper sich schwebend in dem unendlichen Raume erhalten.“ Das Antigrave als eine Daseinsform der Schwerelosigkeit wird nicht als ein völlig gesetzloser Zustand erfaßt, sondern als eine Gesetzlichkeit, die nur von unseren gewohnten Denkformen her nicht unmittelbar eingesehen werden kann. Dennoch erhält das Antigrave in der poetischen Verfahrensweise vielfach Züge einer märchenhaft-utopischen Welt (wie im „Käthchen von Heilbronn“), wenn die „wirkliche“ Welt ganz von den typischen Denkweisen (im Zeichen der Schwerkraft) beherrscht wird.
Der Maxime, nicht zu sinken, wenn alles stürzen will, liegt eine Vorstellung von Welt zugrunde, die das Ich in seinen Ansprüchen bedroht. Diese Welt ist in der dichterischen Einbildungskraft K.s eine gespaltene Welt. In zahlreichen Wendungen seiner Werke kommt dies zum Ausdruck. Von Penthesilea heißt es: „Schlug sie mit Donnerkrachen eben ein,/Als wollte sie den ganzen Griechenstamm/Bis auf den Grund, die Wütende, zerspalten“; der Dorfrichter Adam im Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ wünscht sich vielsagend, „von ungespaltenem Leibe“ zu sein. Der Krug selbst wird in lustspielhafter Darbietung zum Sinnbild einer Welt, die zerbrochen ist. Ihre Scherben wieder zusammenzubringen, ist die Komödienfigur der Frau Marthe rührend bemüht. Im „Michael Kohlhaas“ wird von der gebrechlichen Einrichtung der Welt gesprochen, die der Hauptfigur eine bereits vertraute Vorstellung ist. Die zahlreichen Rechtsfälle und Rechtsdinge,|die K. in seinen Dramen wie in seinen Erzählungen behandelt, hängen mit der Erfahrung einer gespaltenen, zerbrochenen oder gebrechlichen Welt aufs engste zusammen. Die Rechtswelt ist ihrerseits gespalten. Zwischen der Idee einer schon ins Märchenhafte entrückten Gerechtigkeit und der gebrechlichen Einrichtung, wie sie sich in den juristischen Institutionen und Instanzen bezeugt, besteht eine unüberbrückbar scheinende Kluft. Sie wird im „Michael Kohlhaas“ auf widerspruchsvolle Weise versöhnt – dadurch, daß dieser das Todesurteil fast verklärend annimmt. Zum Rechtsdenken einer grundsätzlich gespaltenen Welt gehört das Denken an Besitz, Eigentum und an alles, was Mißtrauen erzeugt. Dieses die menschlichen Verhältnisse bedrohende Denken findet im ersten Drama, in der „Familie Schroffenstein“, seinen sinnbildhaften Ausdruck im Faktum des Erbvertrags, der auf den Sündenfall des Bewußtseins verweist. Die hier in Frage stehende Bewußtseinswelt – und auch sie ist ein durchaus zeittypisches Phänomen – ist in drei Phasen gegliedert. Dem Sündenfall geht ein Zustand der Unschuld voraus, den es eines Tages wieder zu erreichen gilt. Diese Wiedervereinigung wird im Aufsatz über das Marionettentheater auf humorvoll anmutende Art umschrieben: „Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?“ Diese auch im Juristischen sich bezeugende Gespaltenheit findet in einer unerwarteten Wortverbindung den ihr gemäßen Ausdruck: im Begriff des Rechtgefühls. Davon handelt das erste Drama, wenn eine der Personen zum Ausdruck bringt, was ihr vor allem wichtig ist: „Das Gefühl/Des Rechts! O du Falschmünzer der Gefühle/… Das Rechtgefühl! – Als ob's ein andres noch/In einer andern Brust, als dieses, gäbe!“ Im „Michael Kohlhaas“ wird dasselbe „Rechtgefühl“ mit dem Roßhändler in Verbindung gebracht, von dem es paradoxerweise heißt, daß es ihn zum Räuber und Mörder gemacht habe. Daß sich auch diese Denkfigur – als Vereinigung von Recht und Gefühl – schon in der Vorphase der Dichtung entwickelt, ist der auf den Freund Brockes bezogenen Aussage zu entnehmen (31.1.1801): „Ein tiefes Gefühl für Recht war immer in ihm herrschend …“
Damit ist zugleich derjenige Begriff genannt, der im Verständnis der neueren K.-Forschung die Bedeutung eines Schlüsselbegriffs erlangt hat: das Gefühl. Daß diesem Wort trotz partieller Einschränkungen, eine zentrale Bedeutung in der Poetik K.s zukommt, kann als unbestritten angesehen werden. „Denn etwas gibt's, das über alles Wähnen/Und Wissen hoch erhaben – das Gefühl/Ist es der Seelengüte andrer …“ (Die Familie Schroffenstein); „Die höchste Achtung … trag ich im Innersten für sein Gefühl“ (Prinz Friedrich von Homburg); „Türme das Gefühl … wie einen Felsen empor: halte dich daran und wanke nicht“ (Der Zweikampf). Von der Untrüglichkeit dieses Gefühls – für eine Figur wie das Käthchen von Heilbronn trifft sie zu – war man lange Zeit überzeugt. Diese generell vorausgesetzte (und von K. vermeintlich intendierte) Untrüglichkeit kann heute nicht mehr als communis opinio bezeichnet werden. Die Verwirrbarkeit des Gefühls ist im Gegenteil in Gestalten wie Penthesilea, dem Prinzen von Homburg, Michael Kohlhaas, auch wohl in Alkmene und der Eve des „Zerbrochnen Krugs“ erkannt. Das verwirrte und vom Widerspruch gezeichnete Gefühl findet in der Tragödie der „Penthesilea“ seinen gesteigerten Ausdruck in Bildern, die Unvereinbares auf schockierende Weise zusammenbringen. „Nicht ehr zu meinen Freunden will ich lenken/… Als bis ich sie zu meiner Braut gemacht,/Und sie, die Stirn bekränzt mit Todeswunden,/Kann durch die Straßen häuptlings mit mir schleifen.“ Verwirrbar kann sich Gefühl in den Personen K.s äußern, weil die Institutionen des Rechts und der Gesellschaft die ungespaltene Welt verhindern. Ehrgeiz, Ruhmsucht oder Eigennutz können solche Verwirrungen motivieren. Sie wirken sich so gut im gesellschaftlichen wie im individuellen Bereich aus. Das im Individuum verwirrte Gefühl wird im Fall der Penthesilea von den unmenschlichen Gesetzen des Amazonenstaates verfälscht. Gefühl und Gesellschaft werden in K.s Dramen und Erzählungen zumeist antagonistisch aufgefaßt. Aber die Dichtung selbst nimmt nicht einseitig für diese oder jene Seite Partei. Sie richtet sich auf eine Vereinigung beider Bereiche. Es geht daher in diesem Werk nicht einseitig um Gefühl und Emotion, sondern um ihre Vereinigung in Formen des Bewußtseins und Erkennens, wie es in der eigentlich widerspruchsvollen Wortverbindung vom „Rechtgefühl“ zum Ausdruck kommt.
Die Erkennbarkeit des Gefühls wird daher wichtiger als dieses selbst. Die von ihrem Gefühl bestimmte Alkmene sieht sich am Ende des Dramas eines anderen belehrt, und ihr vielsagendes „Ach“ kann nicht unbesehen als Verklärung und Verherrlichung solchen Gefühls verstanden werden. Wenn der Prinz|von Homburg am Ende seines Erkenntnisweges zu seinem Vorteil ein anderer ist, als er es zuvor war, so kann der Gefühlszustand der Eingangsszene nicht schon als der ideale Zustand aufgefaßt werden, auf den es ankommt. In der Art, wie er sich selbst träumt, indem er sich selbst den Kranz des Ruhmes flicht, liegt das Bedenkliche seines Verhaltens. Es besteht kein Grund, am Gewicht seiner späteren Einsicht zu zweifeln: „Schuld ruht, bedeutende, mir auf der Brust,/Wie ich es wohl erkenne.“ Diese Schuld ist keine moralische oder gerichtliche Schuld. Sie liegt im Zustand des Menschen beschlossen. Aber sie wird erkannt, und ihre Erkennbarkeit wird durch eine von der Gesellschaft vermittelte Denkweise erschwert. So vor allem in der Tragödie der „Penthesilea“. Hier sind es die unnatürlichen Gesetze des Amazonenstaates, die dem Erkennen so lange und so verhängnisvoll im Wege stehen. Nirgends im Raum dieses Dramas gibt es den Staat oder die Gesellschaft, die eine Harmonie beider Bereiche verbürgen. Die Kritik an der bestehenden Gesellschaft ist in den Werken der frühen und mittleren Zeit radikal. Erst die Dichtung der letzten Lebensjahre sieht Versöhnungen von Gefühl und Gesellschaft vor.
Hinsichtlich der Erkennbarkeit des Gefühls (oder des rechten Herrschers wie in „Robert Guiskard") gibt es keine höchste Person und keine göttergleiche Gestalt, der eine solche Erkenntnisfähigkeit kraft ihres Amtes zukäme. Selbst der Kurfürst (im „Prinzen von Homburg") oder der Gott der Götter (in „Amphitryon“) oder der Gerichtsrat (im „Zerbrochnen Krug“) sind vorübergehend verwirrbare Gestalten. Es gibt keine über der Welt waltende Autorität. Kein Gesetz, keine ein für allemal zu befolgende Regel und keine theologische Lehre können als sakrosankt angesehen werden. Die Eindeutigkeit des Meinens, Denkens und Glaubens ist das, was K. Werk für Werk widerlegt; mit bemerkenswertem Scharfsinn geschieht dies in der Erzählung „Der Zweikampf“. Das Gottesurteil wird als völlig widersprüchlich erkannt. Es enthält denen die Eindeutigkeit vor, die ihm so gern vertrauen möchten. Ob der Ausgang des Zweikampfs zugunsten des einen oder des anderen auszulegen ist, wird zu einer Frage der Interpretation. Der Gott dieser Erzählung gibt sich nicht in klar befolgbaren Anweisungen zu erkennen. Er bleibt als deus absconditus in seinen Entscheidungen rätselhaft und unerkannt. Auch im „Erdbeben in Chili“ bleibt völlig offen, wie das auslösende Faktum des Geschehens gedeutet werden soll. Der im Urteil sich verbergende Erzähler wird zum Sinnbild einer in ihrem Sinn sich verbergenden Welt.
Die Vorbehalte gegenüber tradierter Autorität äußern sich auch als Vorbehalte gegenüber dem Regelsystem der Rhetorik. Sie wird im dichterischen Werk wiederholt ironisch behandelt. „Ihr seid ein Freund von wohlgesetzter Rede,/Und Euren Cicero habt Ihr studiert …“, läßt K. den Dorfrichter Adam im „Zerbrochnen Krug“ sagen. Als Dichter spricht K. eine durchaus eigene Sprache. Sie ist weder an den vorgegebenen Normen der Grammatik noch an der Dichtersprache seiner Zeit zu messen. In ihrer eigenwilligen Diktion, in ihren Wortverschränkungen, Hyperbeln und Hypotaxen ist sie am ehesten mit der Sprache des späten Hölderlin vergleichbar. Doch übertrifft sie diese an gesteigerter und vielfach rücksichtsloser Expressivität, der sich alle Stilmittel unterordnen. K.s Sprache ist mehr als nur ein Mittel zur Wiedergabe von Handlung. Sie ist ihrerseits Handlung und Aktion, allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Darin beruht ihre spannungsvolle Unmittelbarkeit, die sich jedem Redeschmuck versagt. Auch die Bildersprache vermittelt Ausdruck und Unmittelbarkeit. Zugleich ist sie Ausdruck einer entzweiten Welt. Der Begriff des Symbols verliert damit seinen ursprünglichen Sinn. Dennoch ist die Dichtersprache K.s nicht auf einige wenige Begriffe zu reduzieren; sie ist ihrerseits komplex. Es gibt die Dramensprache, und es gibt die Sprache des Erzählers; und die eine, hat man gemeint, sei auf den ersten Blick in der anderen nicht zu erkennen. Selbst innerhalb der Komödien, zwischen „Amphitryon“ und dem „Zerbrochnen Krug“, sind die Unterschiede in den Sprachformen und Redeweisen beträchtlich. Die Spannweite des sprachlichen Ausdrucks reicht vom krassen „Naturalismus“ der „Penthesilea“ bis zur „Romantik“ der „lieblichen Gefühle“, auf die man sich im „Prinzen von Homburg“ beruft. Der sprachlichen Vielfalt entspricht die Vielfalt der literarischen Gattungen, deren sich K. bedient.
Innerhalb seines literarischen Werkes kommt den Dramen zweifellos eine Vorrangstellung zu. Sie bestehen aus Tragödien, Komödien und Schauspielen. Die Übergänge sind fließend. Tragisches wird mit Komischem vermischt, ohne daß diejenige Zwischenform entstünde, die in der Literatur der Moderne als Tragikomödie bevorzugt wird. Aber die Nähe beider Dichtungsarten, der mühelose Übergang von der einen zur anderen, ist im|dichterischen „Weltbild“ K.s angelegt, wonach man dasselbe Vorkommen bald tragisch und bald komisch verstehen kann. Damit sind bereits Unterschiede zum Drama der klassischen Ästhetik bezeichnet. Sie treten deutlicher in der Struktur seines Dramas hervor. Die zahlreichen Traumszenen sind hierfür aufschlußreich. Im Drama Schillers sind sie eher die Ausnahme als die Regel. Dagegen sind K.s Dramen wiederholt um Träume gruppiert. Das betrifft die „Penthesilea“ ebenso wie das „Käthchen von Heilbronn“ oder den „Prinzen von Homburg“, der mit einem Traum beginnt und mit einem solchen auch endet: „Nein, sagt! Ist es ein Traum? … Ein Traum, was sonst?“ Mit der Verwendung von Träumen geht es stets um Bewußtseinsgrade der handelnden Personen. Es kommt nicht so sehr auf das bewußte Kalkül mit Intrige und berechenbarem Handeln an, sondern auf die Formen der Unwissenheit, des Unbewußten und des Unwillkürlichen, auf Reduzierungen des Bewußtseins, wie sie für die Struktur seines Dramas kennzeichnend sind. Demgemäß bestimmen auch nicht spannungsvolle Konflikte den Aufbau der Dramen, weil Konflikte eine Bewußtseinshöhe voraussetzen, die man hier zumeist vermißt. Auch damit sind Entfernungen von der strengen Tektonik des klassischen Dramas verbunden. Sowohl „Penthesilea“ wie „Der Zerbrochne Krug“ kommen ohne die bis dahin selbstverständliche Einteilung in Akte aus. Mit dem durch Traum und Unwissenheit reduzierten Bewußtseinsstand verlagert sich das Gewicht des Geschehens in die Dramenschlüsse, in den letzten Akt, in dem die Erkennung des bis dahin Unerkannten geschieht. Tragödie wie Komödie haben eine Dramenform gemeinsam, die Schiller an der Tragödie des Sophokles wahrgenommen und als tragische Analysis bezeichnet hat. In der Vorrede zum „Zerbrochnen Krug“ wird auf die für den König Ödipus bezeichnende Verkennungssituation angespielt: „der Gerichtsschreiber sah jetzt den Richter mißtrauisch an, wie Kreon bei einer ähnlichen Gelegenheit den Ödip, als die Frage war, wer den Laius erschlagen?“
Im Blick auf die Tragödie der Griechen wie auf die zeitgenössische Schicksalstragödie der Romantik stellt sich die Frage nach der Bedeutung, die dem Schicksal zukommt. Das Wort hat durch die neuere Forschung eine erschließende Bedeutung erhalten. Aber die Dramen selbst entziehen sich weithin dieser Frage: Das Wort „Schicksal“ kommt bei K. nur selten vor. Statt dessen ist an entscheidenden Stellen beider Tragödien von „Versehen“ die Rede. „Wenn ihr euch totschlagt, ist es ein Versehen“, heißt es am Ende der „Familie Schroffenstein“; und Penthesilea läßt sich nach allem, was geschehen ist, mit Versen vernehmen, die dasselbe Wort ge brauchen: „So war es ein Versehen. Küsse, Bisse/Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt,/Kann schon das eine für das andre greifen.“ Damit scheint Entscheidendes im Verhalten der Menschen untereinander dem Zufall überlassen zu sein. Aber Zufall kann als Versehen nur wirksam werden, weil die Menschen in Denkweisen befangen sind, die solche Versehen fast beliebig herbeiführen. Nicht auf schicksalhaftes Geschehen kommt es daher an, sondern auf das Erkennen der zumeist gesellschaftlich bedingten Denkweisen. Über den tragischen oder untragischen Ausgang entscheidet der Zeitpunkt der Erkennung. Beide Schlüsse erhalten im dramatischen „Weltbild“ K.s ihr Recht. Auch insofern verhalten sich nach einem Wort des Dichters „Penthesilea“ und „Käthchen von Heilbronn“ wie das Plus und Minus der Algebra zueinander. Nicht zufällig stehen in beiden Dramen Frauengestalten im Mittelpunkt des Geschehens. Die Tragödie in ihrer klassischen Gestalt setzt den Helden voraus. Aber K.s Achill in der „Penthesilea“ ist nur bedingt als ein solcher anzusehen, und die sicher unbedingteste Tragödie in diesem dramatischen Werk ist die Tragödie einer Frau. Auch in den Komödien wird Tragisches nicht zufällig an einer Frauengestalt vernehmbar. Die auf tragische Schuld zielende Frage wird von Alkmene gestellt: „Kann man auch Unwillkürliches verschulden?“ Gegenüber dem ernsten Lustspiel nach Molière vermittelt die Komödie „Der zerbrochne Krug“ den Eindruck eines unbeschwerten Theaterstücks, eines selbstgenügsamen Realismus in dörflicher Umgebung. Aber mit der Grundthematik K.s ist auch diese Komödie auf vielfache Weise verknüpft. Die Vorliebe für Rechtsfälle und Verhöre bestätigt sich erneut. Damit hängt der prozeßhafte Ablauf zusammen, den man nahezu aus allen Dramen kennt. Zugleich wird das Lustspiel durch Anspielungen und Wortspiele auf eine Welt hin durchsichtig, die es als gebrechlich und gespalten hinzunehmen gilt. In ihr muß es darum gehen, Schlimmes, wie Todesstrafe und Rechtsbeugung, zu verhüten oder zu mildern. Daher ist Nachsicht geboten, die zuletzt noch dem „Übeltäter“ der Komödie zugute kommt. Man holt ihn zurück, kaum daß er von sich aus das Weite gesucht hatte: „Geschwind, Herr Schreiber, fort! Holt ihn zurück! … Tut mir den Gefallen, holt ihn wieder!“ Mit|dieser Geste der Nachsicht wird K. zum Schöpfer eines der humansten Lustspiele unserer Literatur. Satire oder Groteske sind hierfür gänzlich unpassende Begriffe.
Die beiden vaterländischen Dramen der letzten Lebensjahre, „Die Hermannsschlacht“ und der „Prinz Friedrich von Homburg“, entfernen sich am weitesten von den Tragödien der frühen und der mittleren Zeit. An ihnen vor allem wird ein Wandel erkennbar, der nicht so sehr ein Wandel des Stils, sondern ein solcher der Auffassung ist. Im vorausliegenden Werk – in Drama wie Erzählung – standen sich Individuum und Gesellschaft weithin unvermittelt gegenüber. Dagegen setzen die beiden politischen Dramen der letzten Lebensjahre eine Versöhnung als Möglichkeit voraus; vor allem im „Prinz Friedrich von Homburg“ ist das der Fall. Die Wiederherstellung des Getrennten – von Gesetz und Gefühl, von Individuum und Staat oder wie man die Gegensätze bezeichnen will – ist das eigentliche Thema, und der Staat, in dem eine solche Versöhnung als möglich angesehen wird, ist der brandenburgische Staat des Großen Kurfürsten – also Preußen. Aber die letzte Szene des Schauspiels steht im Zeichen des Traums; die versöhnte Welt, die gefeiert wird, ist ein Traum – „was sonst!“ Sie ist Idee – nicht Wirklichkeit. Es geht mithin um einen preußischen Staat, wie er sein soll. Das kann durchaus in Übereinstimmung mit der preußischen Reformpartei gesehen werden. An diesem Schauspiel ist die Stellung K.s zwischen Klassik und Moderne am besten zu erläutern. Sein Drama bleibt in Aufbau, Verssprache oder Dialog dem klassischen Drama benachbart. Die Figuren sind hochgestellte Personen der Gesellschaft – wie in anderen Dramen auch. Eingangs- und Schlußszene sind miteinander verklammert; dadurch entsteht der Eindruck von Geschlossenheit und Komposition. Mit den Traumszenen des Dramas nähert sich K. aber auch der zeitgenössischen Romantik. Damit sind Reduzierungen des Bewußtseins verbunden, die nach vorwärts weisen. Schon bei Büchner, und erst recht im Naturalismus, sind sie sozial motiviert. So weit geht K. noch nicht. Dennoch ist der träumende General partiell eine Vorwegnahme des halben Helden, wie es zumal die Todesfurchtszene beweist. Man hat sie noch lange als eine Zumutung aufgefaßt und entsprechend getadelt.
Solche Herausforderungen des Publikums sind vor allem in den Erzählungen zahlreich vorhanden. Es gibt insgesamt acht; sie wurden noch zu Lebzeiten des Dichters in zwei Bänden 1810/11 veröffentlicht. Unter diesen läßt die bekannteste und umfangreichste, der „Michael Kohlhaas“, am deutlichsten den Wandel in der Auffassung erkennen, wie er für die gleichzeitig entstandenen Preußendramen kennzeichnend ist. Die Erzählung endet tragisch, aber die Hauptfigur des Roßhändlers stirbt mit sich und der Welt versöhnt. Erzählungen wie „Der Findling“, „Die Verlobung in St. Domingo“ oder „Das Erdbeben in Chili“ versagen sich auch diese Geste der Versöhnung. Die radikal geübte Gesellschaftskritik scheint hier auch noch die „Erhebung“ ins Tragische zu verhindern. Es fällt auf, daß in ihnen die Familienthematik im Mittelpunkt steht: Die entzweite Welt wird im Kreis der Menschen offenkundig, die sich einander die Nächsten sind; so vor allem im „Findling“. In der „Verlobung in St. Domingo“ werden Familienmotive mit der Kritik an der Kolonialherrschaft verknüpft. Dennoch vermeidet es K. als Erzähler, für eine der streitenden Parteien eindeutig Partei zu ergreifen. Das hat dazu beigetragen, ihm erzählerische Objektivität zu attestieren. Aber objektiv ist er als Erzähler in Fragen des menschlichen Verhaltens keineswegs. Der Bericht über die Bürger Santiagos, die ihre Dächer an jene vermieten, die dem „Schauspiel“ einer Hinrichtung zusehen wollen, ist alles andere als wertneutral. Gegenüber Unmenschlichkeiten, wo immer es sie gibt, verhält sich K. als Erzähler nicht objektiv. Dem Neger Hoango (in „Die Verlobung in St. Domingo“) wird „unmenschliche Rachsucht“ nachgesagt, und das ist durchaus kritisch gemeint. Aber vor solcher Kritik werden die vielfach unmenschlichen Verhaltensweisen der Europäer nicht verschont. Der Erzähler spricht bald aus der Sicht der einen und bald aus der Sicht der anderen. Er wechselt den Standort; seine Erzählart ist polyperspektivisch. Bisweilen scheint er – wie der allwissende Erzähler – über das Innere seiner Figuren Bescheid zu wissen; aber meistens weiß er es nicht. Was geschehen ist, wird nicht so erzählt, daß man weiß, woran man ist. Es wird in seiner Vieldeutigkeit transparent. Auf diese vor allem kommt es K. an. Daß er in einigen Erzählungen ein glückliches Ende riskiert, ohne sie deswegen in Trivialliteratur zu überführen, bleibt bemerkenswert. Aber die Frage der literarhistorischen Einordnung erweist sich hier um vieles schwieriger als hinsichtlich der Dramen. Gegenüber der Geselligkeit des Erzählens, wie ihr Goethe in den „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ das Wort redet, und gegenüber der liebenswürdigen|Erzählart in romantischen Novellen mutet K.s Erzählkunst spröde und wenig gefällig an. Episches Behagen ist ihr fremd. Seine Novellen sind Gesellschaftsnovellen, die in ihrer Zeit kaum Vergleichbares kennen.
Den Erzählungen am nächsten verwandt sind die Anekdoten, teilweise Meisterwerke ihrer Art. Um eigene „Erfindungen“ handelt es sich nicht. Als Herausgeber eines Neuigkeitenblattes greift K. auf, was sich ihm bietet. Sein Anteil beruht vornehmlich in Auswahl und Bearbeitung, und die letztere ist so beschaffen, daß aus den Vorlagen nicht selten ein Produkt des eigenen Geistes und der eigenen Denkart entsteht. Diese Prosastücke sind unterhaltsam, weil sie es um des Publikums willen sein sollen. Aber sie sind in dem gleichen Maße hintergründig, indem es nur um vordergründige Unterhaltungsliteratur zu gehen scheint. Eine Stileigentümlichkeit der Anekdoten ist das Lakonische ihrer Darbietung; Witz und Hintersinn werden miteinander verschmolzen, wie in der Anekdote vom Kapuziner, der einen Verurteilten zurechtweist, weil dieser sich über das schlechte Wetter beklagt. Der Kapuziner wendet ein. daß er eben diesen Weg bei solchem Wetter zurückzugehen habe, und der lakonische Kommentar des Anekdotenerzählers lautet: „Wer es empfunden hat, wie öde einem, auch selbst an einem schönen Tage, der Rückweg vom Richtplatz wird, der wird den Ausspruch des Kapuziners nicht so dumm finden.“
Die Abteilung der „Kleinen Schriften“ enthält Verschiedenartiges, und auch diese Prosa verdankt vielfach der publizistischen Tätigkeit ihre Entstehung. Die politischen Schriften des Jahres 1809 mit dem „Katechismus der Deutschen“, dem Aufruf „Was gilt es in diesem Kriege?“ oder dem Beitrag über die Rettung Österreichs stellen sich noch unmittelbarer als die vaterländischen Dramen in den Dienst der Erneuerung Preußens und des Kampfes gegen →Napoleon. Die wichtigsten Beiträge sind jene, die K.s Denkformen am deutlichsten verraten. Sie finden ihren prägnanten Ausdruck in Stücken wie „Betrachtungen über den Weltlauf“, „Von der Überlegung“ oder „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“. Als der zweifellos berühmteste Beitrag dieser Prosastücke ist der Aufsatz „Über das Marionettentheater“ anzusehen. Seine Wirkung auf die spätere Literatur und Literaturwissenschaft ist unabsehbar. An Versuchen, ihn zum Schlüssel des Verständnisses schlechthin zu machen, hat es nicht gefehlt: Sie bleiben problematisch, und daß K. zumal mit diesem Beitrag eine Denkform seiner Zeit aufnimmt und variiert, ist offenkundig.
Der Lyrik wurde im allgemeinen wenig Beachtung geschenkt. Sie ist in hohem Maß politische Lyrik. Die Verbindung von politischer Motivik und Selbstaussprache ist im großen Gedicht „Das letzte Lied“ eindrucksvoll. Aber auch die unpolitische Lyrik enthält mit einigen kurzen Gelegenheitsgedichten oder dem Gedicht „Der Engel am Grabe des Herrn“ Kostbarkeiten, die man in Anthologien im allgemeinen vergeblich sucht.
Neben den Werken stehen als ein eigener Bereich die Briefe, von denen circa 230 gedruckt vorliegen. Aber eigentlich sind sie aufgrund ihrer Literarität ein vom Werk nicht ablösbarer Teil. Während die frühen Briefe noch teilweise den Briefstellern des 18. Jahrhunderts verpflichtet bleiben, gewinnt K. mit dem Durchbruch zur Dichtung auch in dieser Mitteilungsart seine eigene Form. Die durch seine Situation bedingte Isolierung verstärkt das Verlangen nach Kommunikation, das sich in den Briefen befreit. Dabei gewinnt die Mitteilung eine Aufrichtigkeit, Unmittelbarkeit und sprachliche Prägnanz, die alles Persönliche und Private vergessen macht.
Es wird verständlich, daß von dem unaussprechlichen Menschen, als den sich K. bezeichnet hat, eine faszinierende Wirkung auf andere ausgegangen sein muß. Bedeutende Frauen, zuletzt noch Rahel Levin, hat er anzusprechen vermocht. Nicht weniger ist er bedeutenden Männern seiner Zeit, Schriftstellern, Gelehrten oder Staatsmännern, eine unvergeßliche Gestalt geblieben. Der Historiker Dahlmann hat in seinen Erinnerungen geschrieben, K.s vielseitige Bildung und seine gewinnende Liebenswürdigkeit hätten jeden Erkennenden unwiderstehlich gefesselt: „Sein Tod hat eine Lücke in mein Leben gerissen, die niemals ausgefüllt ist.“ Diese schon zu Lebzeiten ungewöhnliche Wirkung – bei vielfach schroffen Ablehnungen – erklärt wenigstens zum Teil die Wirkung seines Werks im 20. Jahrhundert. Er war zwar der Literaturkritik des 19. Jahrhunderts kein unbekannter Autor, und zumal die preußisch-patriotischen Kreise haben ihn als Dichter geschätzt. Dennoch fällt die eigentliche Wiederentdeckung in die Zeit, in welcher der Aufbruch in die Moderne erfolgt, zu Beginn unseres Jahrhunderts. Seither hat fast jede Epoche ihr Verhältnis zu K. entdeckt und bekräftigt. Der noch vor dem 1. Weltkrieg gestiftete Kleist-Preis gehörte zu den angesehensten Literaturpreisen in Kaiserreich und Republik. Die Erforschung des Werkes wie des Lebens nimmt ihren|Fortgang, und dieser vermeintlich so preußische Dichter hat inzwischen ein weltweites Interesse gefunden, wie es kaum vorauszusehen war. Neben dem Denkmal am Wannsee wurde 1861 ein Gedenkstein gesetzt, in dem in der Sprache der Zeit die Verse eingezeichnet sind: „Er lebte, sang und litt/In trüber, schwerer Zeit,/Er suchte hier den Tod/Und fand Unsterblichkeit.“ Die Familie hatte es schwer, mit diesem „Abtrünnigen“ ins Reine zu kommen. Aber zum hundertsten Todestag wurde ein Kranz am Grab niedergelegt, der die Schleife trug: „Dem Besten ihres Geschlechts.“
-
Werke
Ges. Schriften, hrsg. v. L. Tieck, 3 Bde., 1826;
Sämtl. Werke, hrsg. v. Th. Zolling, 4 Bde., 1885;
Werke, hrsg. v. E. Schmidt, 5 Bde., 1904/05;
Sämtl. Werke, hrsg. v. H. Sembdner, 2 Bde., ⁴1961;
Berliner Abendbll., hrsg. v. H. v. K., Mit Nachwort v. H. Sembdner, 1959;
Phöbus, Ein Journal f. d. Kunst, hrsg. v. H. v. K., Mit Nachwort v. H. Sembdner, 1961. -
Literatur
ADB 16;
Th. Zolling, H. v. K. in d. Schweiz, 1882;
O. Brahm, Das Leben H. v. K.s, 1884;
G. Minde-Pouet. H. v. K., Seine Sprache u. s. Stil, 1897;
R. Steig, H. v. K.s Berliner Kämpfe, 1901;
S. Rahmer, Das K.-Problem auf Grund neuer Forschung, 1903;
H. Hellmann, H. v. K., 1911;
W. Herzog. H. v. K., Sein Leben u. s. Werk, 1911;
H. Meyer-Benfey, K.s Leben u. Werke, 1911;
ders., Das Drama H. v. K.s, 2 Bde., 1911/13;
H. Schneider, Stud. zu H. v. K., 1915;
E. Cassirer, H. v. K. u. d. Kant. Philos., 1919;
K. Gassen, Die Chronol. d. Novellen K.s, 1920;
P. Witkop, H. v. K., 1922;
W. Muschg, K., 1923;
F. Gundolf, H. v. K., 1924;
F. Braig, H. v. K., 1925;
G. Fricke, Gefühl u. Schicksal b. H. v. K., 1929;
W. v. Einsiedel, Die dramat. Gestaltungsweise b. H. v. K., 1931;
R. Ayrault, H. v. K., 1934;
C. Hohoff, Komik u. Humor b. H. v. K., 1936;
C. Lugowski, Wirklichkeit u. Dichtung, Unterss. z. Wirklichkeitsauffassung H. v. K.s, 1936;
G. Lukács, H. v. K., 1937, wieder in: Dt. Realisten d. 19. Jh., 1951, S. 19-48;
M. Kommerell, Die Sprache u. d. Unaussprechliche, Eine Betrachtung üb. H. v. K., in: Das Innere Reich, 1937, wieder in: ders., Geist u. Buchstabe d. Dichtung, ⁴1956;
O. v. Xylander, H. v. K., u. J.-J. Rousseau, 1937;
H. Sembdner, Die Berliner Abendbll. H. v. K.s, ihre Qu. u. i. Redaktion, 1939;
H. Plügge, Grazie u. Anmut, Ein biolog. Exkurs üb. d. Marionettentheater v. H. v. K., 1947;
E. L. Stahl, The dramas of H. v. K., 1948;
H. Uyttersprot, H. v. K., 1948;
B. v. Wiese, Die dt. Tragödie v. Lessing bis Hebbel, ³1955, S. 285-355;
L. Muth, K. u. Kant, 1954;
W. Kayser, K. als Erzähler, in: German Life and Letters, 1954/55, wieder in: H. v. K., hrsg. v. W. Müller-Seidel, 1967, S. 230-43;
H. M. Wolff, H. v. K., Die Gesch. s. Schaffens, 1954;
W. Schadewaldt, Der „Zerbrochne Krug“ v. H. v. K. u. Sophokles' König Ödipus (1957), in: ders., Hellas u. Hesperien, 1960, S. 843-50;
J. Maaß, K., d. Fackel Preußens, 1957;
C. Hohoff, H. v. K. in Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten, 1958;
F. Koch, H. v. K., Bewußtsein u. Wirklichkeit, 1958;
G. Blöcker, H. v. K. od. d. absolute Ich, 1960;
E. Fischer, H. v. K., in: Sinn u. Form 13, 1961, S. 759-844;
H. Ide, Der junge K., 1961;
W. Müller-Seidel, Versehen u. Erkennen, Eine Studie üb. H. v. K., 1961;
R. Samuel, K.s Hermannsschlacht, in: Jb. d. Schillerges. V, 1961, S. 64-101;
H. H. Holz, Macht u. Ohnmacht d. Sprache, Unters. z. Sprachverständnis u. Stil H. v. K.s, 1962;
Hans Mayer, H. v. K., Der geschichtl. Augenblick, 1962;
S. Streller, Das dramat. Werk H. v. K.s, 1966;
H. v. K., Aufsätze u. Essays, hrsg. v. W. Müller-Seidel, 1967;
H. v. K.s Nachruhm, Eine Wirkungsgesch. in Dokumenten, hrsg. v. H. Sembdner, 1967;
H. v. K.s Lebensspuren, hrsg. v. dems., 1969;
H.-J. Kreutzer, Die dichter. Entwicklung H. v. K.s …, 1968;
K. Kanzog, Prolegomena zu e. hist.-krit. Ausg. d. Werke H. v. K.s, 1970;
B. v. Wiese, H. v. K., in: Dichter d. Romantik, 1971, S. 225-52;
K. Mommsen, K.s Kampf mit Goethe, 1974;
H. Politzer, Auf d. Suche nach Identität, Zu H. v. K.s Würzburger Reise, in: ders., Hatte Ödipus e. Ödipus-Komplex?, 1974, S. 182-202;
Jochen Schmidt, H. v. K., Stud. zu s. poet. Verfahrensweise, 1974;
Schriftsteller üb. K., Eine Dokumentation, hrsg. v. P. Goldammer, 1976;
K. Birkenhauer, K., 1977;
Text u. Kontext, Qu. u. Aufsätze z. Rezeptionsgesch. d. Werke H. v. K.s, hrsg. v. K. Kanzog, 1979;
K. Kanzog, Edition u. Arrangement, 150 J. Editionsgesch. d. Werke u. Briefe H. v. K.s, 2 Bde., 1979. -
Porträts
Kreidezeichnung v. Wilhelmine v. Zenge (Braut), 1806, Abb. in: Die Gr. Deutschen im Bild, 1937, GHdA A IV, 1960, u. b. Rave.
-
Autor/in
Walter Müller-Seidel -
Zitierweise
Müller-Seidel, Walter, "Kleist, Heinrich von" in: Neue Deutsche Biographie 12 (1980), S. 13-27 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118563076.html#ndbcontent
-
Kleist, Bernd Heinrich
-
Biographie
Kleist: Bernd Heinrich Wilhelm v. K. wurde zu Frankfurt a. O. geboren, nicht am 10. October 1776, wie man bis zu seiner irrthümlich am 10. October 1876 begangenen Säcularfeier, gestützt auf Tieck's Vorrede zu Kleist's Werken (1826) annahm, sondern nach dem von K. Siegen aus dem Frankfurter Garnisonskirchenbuch veröffentlichten Taufschein, am 18. October 1777. Sein Vater, der Kapitän im Leopold von Braunschweigischen Regimente, Joachim Friedrich v. K., war damals bereits 50 Jahre alt. Von seiner ersten Gemahlin, Karoline Louise v. Wulffen, die 19jährig starb, hatte er zwei Töchter, Wilhelmine und Ulrike. Von der zweiten Gattin Juliane Ulrike v. Pannewitz wurden ihm fünf Kinder geboren, von denen Heinrich das dritte war. Der Knabe erhielt seine Erziehung in dem in der Oderstraße gelegenen elterlichen Hause, welches von der aufopferungsvollen Halbschwester Ulrike bis zu ihrem am 1. Februar 1849 erfolgten Tode bewohnt wurde und nunmehr in den Besitz der Post übergegangen ist. In Gesellschaft eines Vetters wurde er von einem Studenten der Theologie unterrichtet, der insofern einen schwierigen Stand hatte, als K., den er einen nicht zu dämpfenden Feuergeist nannte, im Besitze einer überraschend schnellen Fassungsgabe war, wählend der Genosse, trotz aller Anstrengung, mit ihm nicht Schritt halten konnte. So fiel Letzterer denn auch frühzeitig in Schwermuth und nachdem er Zögling der Militärakademie und Offizier geworden war, nahm er sich das Leben. Erheiternd mag ein solcher Gespiele schwerlich auf K. gewirkt haben; beider Naturen begegneten sich vielmehr in frühem Trübsinn und erwachsen von einander getrennt, sollen sie einmal schriftlich übereingekommen sein, freiwillig aus diesem Leben zu scheiden. Von dem Charakter des 1788 verstorbenen Vaters wissen wir bisher nichts; eine knappe Bemerkung in einem Briefchen Kleist's an Rühle von Lilienstern vom J. 1806 scheint anzudeuten, daß die (1793 gestorbene) Mutter weichen Herzens war und daß er diese Eigenschaft von ihr geerbt hat. Mit dieser Gefühlsrichtung stimmt überein, daß K. ein bedeutendes musikalisches Talent entwickelte, so daß er, Tieck's Ueberlieferung zur Folge, ohne die Noten zu kennen, sogar mehrere Instrumente vortrefflich zu spielen verstand. In seinem zehnten Jahre kam er zu dem Prediger Catel nach Berlin und, wie Tieck erzählt, etwa 15 Jahre alt als Junker zur Garde. Dies stimmt mit Wilbrandt's Annahme, nach welcher K. im J. 1792 Soldat wurde, genau überein. Eduard v. Bülow's Angabe, daß er im J. 1795 als vierter Fähndrich in das Garderegiment zu Fuß in Potsdam eingetreten sei, ist hingegen nicht genau, denn aus dem ersten Briefe Kleist's an Ulrike, der auf dem Regimentsmarsche nach dem Rhein, von Eschborn im Nassau’schen am 25. Februar 1795 geschrieben ist, geht hervor, daß er erst von Westphalen die Nachricht von seiner Beförderung zum Offizier abschicken zu können glaubte. Daß mit dieser Beförderung doch nur die Fähndrichsstufe gemeint sein kann, erhellt daraus, daß K. in der Rangliste von 1796 als vierter Fähndrich im Regiment Garde zu Fuß in Potsdam eingeschrieben ist. Würde der Frieden dem Rheinfeldzuge nicht ein Ende gemacht haben und wäre K. zu wirklichen Kriegsdiensten gekommen, so hätte dies vielleicht seine ganze Zukunft beeinflußt; aber von Natur dem Soldatenstande wenig geneigt, wurde ihm in Potsdam der bloße Garnisondienst geradezu widerwärtig. Ein unwiderstehlicher Drang nach Wissen und innerer Bildung, nach freiem geistigen Leben, bemächtigte sich seiner; er ließ sich von dem Conrector Bauer unterrichten und studirte in Gesellschaft eines jüngeren Kameraden, außer den alten Sprachen, besonders Philosophie und mathematische Wissenschaften. In diese Zeit des Potsdamer Aufenthaltes fällt das erste uns bekannte Liebesverhältniß Kleist's mit einem Mädchen aus adligem Geschlecht. Das Scheitern desselben machte ihn schwermüthig und menschenscheu, er vertiefte sich desto mehr in seine Studien und verwendete auf seine äußere Erscheinung nicht mehr die frühere Sorgfalt. Als er zuletzt durch eigenes Denken Probleme erfaßte, welche der Lehrer ihm nicht hatte anschaulich machen können, stand sein Entschluß das Heer zu verlassen und sich ganz den Wissenschaften zu widmen, fest und er reiste nach seiner Geburtsstadt, wo sich damals eine Universität befand, um dort das Nöthige vorzubereiten. Hier hatte seit dem Tode der Mutter deren Schwester, die Ordnung und Ruhe liebende Frau v. Massow, die Wirthschaft übernommen. Die Familie, in welcher der Soldatenstand sich als eine Ueberlieferung fortgeerbt hatte und sein Vormund, ja sein Jugendlehrer, der inzwischen in Frankfurt Geistlicher geworden war, erklärten sich sämmtlich gegen sein Vorhaben, während Ulrike allein eine billigere Auffassung der geistigen Bedürfnisse des Bruders gehabt zu haben scheint. Die in Eduard v. Bülow's „H. v. Kleist's Leben und Briefe“ mitgetheilten Schreiben an den Lehrer vom 18. und 19. März 1799 sind maßgebend für die Kenntniß jener Lebenskämpfe. Zunächst verdient hervorgehoben zu werden, daß es einer edlen und tiefen Natur durchaus entspricht, wenn K. in dem ersten dieser Schreiben das ihn allgemein Bestimmende, Ideale und erst in dem zweiten das, was sich auf seine damalige besondere Lage bezieht, entwickelt; wie denn überhaupt in den meisten seiner Briefe aus jener Zeit sich das idealistische Streben wiederspiegelt, welches durch die größten Geister unserer Kunst und Wissenschaft in die Lebensluft der Nation eingedrungen war. Seiner Vernunft nach hatte der 22jährige alle Elemente zum reinsten Glücke in sich; unserer Theilnahme desto werther entwickelt sich aber sein Geschick von dem Augenblicke an, wo die ungemessensten Anstrengungen nach|Vervollkommnung und später nach Anerkennung bei ihm zu wahren Leidenschaften heranwachsen und ihn zum Erleben jenes Glückes unfähig machen. Den zweiten Brief nennt K. selbst eine getreue Darstellung seines ganzen Wesens und hofft, daß er den geliebten Lehrer nicht ungerührt lassen wird. „Der Soldatenstand, dem ich nie von Herzen zugethan gewesen bin, weil er etwas durchaus Ungleichartiges mit meinem ganzen Wesen in sich trägt, wurde mir so verhaßt, daß es mir nach und nach lästig wurde zu seinem Zwecke mitwirken zu müssen. Die größten Wunder militärischer Disciplin, die der Gegenstand des Erstaunens aller Kenner waren, wurden der Gegenstand meiner herzlichsten Verachtung; die Offiziere hielt ich für so viele Exerciermeister, die Soldaten für so viele Sclaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste machte, schien es mir als ein lebendiges Instrument der Tyrannei. Dazu kam noch, daß ich den üblen Eindruck, den meine Lage auf meinen Charakter machte, lebhaft zu fühlen anfing. Ich war oft gezwungen zu strafen, wo ich gerne verziehen hätte, oder verzieh, wo ich hätte strafen sollen und in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar. In solchen Augenblicken mußte natürlich der Wunsch in mir entstehen einen Stand zu verlassen, in welchem ich von zwei durchaus entgegengesetzten Principien unaufhörlich gemartert wurde, immer zweifelhaft war ob ich als Mensch oder als Offizier handeln mußte, denn die Pflichten beider zu vereinen halte ich bei dem jetzigen Zustande der Armeen für unmöglich. Und doch hielt ich meine moralische Ausbildung für eine meiner heiligsten Pflichten, eben weil sie, wie ich eben gezeigt habe, mein Glück gründen sollte und so knüpft sich an meine natürliche Abneigung gegen den Soldatenstand noch die Pflicht ihn zu verlassen.“ K. stellt nun dar, welche Einwürfe ihm im Kreise seiner Familie gemacht worden sind, aber alle diese Ermahnungen trafen seinen Entschluß nicht. „Nicht aus Unzufriedenheit mit meiner besseren Lage, nicht aus Mangel an Brot, nicht aus Speculation auf Brot, sondern aus Neigung zu den Wissenschaften, aus dem eifrigen Bestreben nach einer Bildung, welche nach meiner Ueberzeugung in dem Militärdienste nicht zu erlangen ist, verlasse ich denselben.“ Was sich in diesen Geständnissen abspiegelt, ist nicht blos die eigenthümliche Artung eines philosophisch und poetisch angelegten Jünglings, sondern auch der Wendepunkt der beiden Jahrhunderte, und merkwürdig genug bleibt es. daß der kurz darauf eingetretene Sieg der rohen Gewalt über den Humanismus der Revolution wesentlich zum Untergange Kleist's beigetragen hat. General Rüchel hatte in Potsdam dem wissenschaftlichen und freidenkerischen Treiben Kleist's längst mit Unwillen zugesehen; als dieser jedoch um seinen Abschied anhielt, redete er ihm ins Herz und der König soll sogar geneigt gewesen sein, dem Wissensdurstigen Urlaub auf unbestimmte Zeit zu gewähren, damit er nach seiner Studienzeit wieder beim Regimente eintreten könne.
Als Seconde-Lieutenant entlassen, studirte K. nun von Ostern 1799 ab in Frankfurt a. O. vorzugsweise Philosophie. Bei Hüllmann hörte er Geschichte, bei Wünsch Mathematik und außerdem besuchte er die Vorlesungen von Huth, Kalau und Madihn. Nach einer Julian Schmidt gegebenen Versicherung Dahlmann's hat K., wie aus seinen Collegienheften hervorging, ernste, nicht blos dilettantische Universitätsstudien gemacht. Wie ernst es ihm damals mit den Wissenschaften war, geht auch daraus hervor, daß er eine (nicht erhaltene) Abhandlung über die Kant’sche Philosophie schrieb. Die erste Zeit des Frankfurter Aufenthaltes verlief ziemlich glücklich. Sein Drang das Wahre und Schöne zu verbreiten, veranlaßte ihn seinen Schwestern und deren Freundinnen Unterricht zu ertheilen, er ließ sich sogar, da ihm der Lehrberuf vorschwebte, im elterlichen Hause ein Katheder errichten und hielt seinen jungen Zuhörerinnen culturgeschichtliche Vorlesungen. Die ästethische Erziehung, die er sich und anderen gab, hatte eine gewisse Weihe über ihn ausgebreitet, ohne daß er darum dem im ganzen Hause herrschenden heiteren Tone abhold gewesen wäre. Eine schroffe Abneigung gegen das Gemeine war überhaupt eine seiner hervorragendsten Eigenschaften. Die Idee der inneren Sittlichkeit war gerade damals so stark in ihm, daß die Nachricht von dem verfehlten Selbstmorde eines Freundes ihn mit Abscheu erfüllte und er dem Selbstmörder brieflich ernste Vorstellungen darüber machte. Ebenso rügte er den Entschluß seiner körperlich wenig begünstigten Schwester Ulrike, unverheirathet zu bleiben. Schon damals regten sich indessen in K. zu viel verschiedenartige Seelenkräfte, als daß das Studium allein ihm volle Befriedigung hätte gewähren können. Sein Herz bedurfte des Ergusses und Ulrike war es, der er mündlich, oder wenn sie abwesend war schriftlich seine Gefühle mittheilte. So entstand jene merkwürdige Reihe von 57 Briefen, deren Veröffentlichung im J. 1860 wir A. Koberstein verdanken und welche über 16 Jahre sich verbreitend, mit dem bereits angeführten Eschborner Schreiben im J. 1795 beginnt und nachdem sie zwischen dem ersten und zweiten Brief eine Lücke von mehr als vier Jahren zeigt und störenderweise nicht selten von Geldbedürfnissen handelt, mit einem erschütternden Abschiede von der Schwester im November 1811 endet. Nicht immer ist an diese Briefe der richtige Maßstab gelegt worden. Gleich in dem ersten Schreiben des Achtzehnjährigen sind die warmen Ueberströmungen des Dankes an die Schwester rührende Beweise der außerordentlichen Feinfühligkeit und Zartheit des jugendlichen Gemüthes. Auch beginnt es schon vollständig mit Ansätzen zu der späteren so eigenthümlich dichten Prosa Kleist's. „Du zwingst Dir eine Gleichgültigkeit gegen die für Dich sonst so reizbaren Freuden der Stadt ab, um Dir das einfache Vergnügen zu gewähren Deinen Bruder Dir zu verbinden.“ In dem zweiten Briefe, der aus der Frankfurter Studentenzeit vom 12. November 1799 datirt ist, nimmt er den Vorwurf der ihm eigenen Sonderbarkeiten auf und sagt, mit einem einzigen Federstriche den Riß bezeichnend, der sich für ihn nie geschlossen hat: „Tausend Bande knüpfen die Menschen aneinander, gleiche Meinungen, gleiches Interesse, gleiche Wünsche, Hoffnungen und Aussichten; — alle diese Bande knüpfen mich nicht an sie und dieses mag ein Hauptgrund sein, warum wir uns nicht verstehen. Mein Interesse besonders ist dem ihrigen so fremd und ungleichartig, daß sie — gleichsam wie aus den Wolken fallen, wenn sie etwas davon ahnden. Auch haben mich einige mißlungene Versuche, es ihnen näher vor die Augen, näher ans Herz zu rücken, für immer davon zurückgeschreckt und ich werde mich dazu bequemen müssen, es immer tief in das Innerste meines Herzens zu verschließen. Was ich mit diesem Interesse im Busen, mit diesem heiligen mir selbst von der Religion, von meiner Religion gegebenen Interesse im engen Busen, für eine Rolle unter den Menschen spiele, denen ich von dem was meine ganze Seele erfüllt, nichts merken lassen darf, — das weißt Du zwar nach dem äußeren Anschein, aber schwerlich weißt Du, was oft dabei im Innern mit mir vorgeht. Es ergreift mich zuweilen plötzlich eine Aengstlichkeit, eine Beklommenheit, die ich zwar aus allen Kräften zu unterdrücken mich bestrebe, die mich aber dennoch schon mehr als einmal in die lächerlichsten Situationen gesetzt hat. — Wenn man durch häufigen Umgang, vieles Plaudern, durch Dreistigkeit und Oberflächlichkeit zu dem einem Ziele kommt, so erreicht man dagegen durch Einsamkeit, Denken, Behutsamkeit und Gründlichkeit das andere.“ Mit solchen tiefen und stilistisch bereits meisterhaften Selbstbetrachtungen hat K. manche Kritik der älteren und neueren Ausleger seines Wesens von vornherein widerlegt.
Aus den Besuchen in dem benachbarten Hause des Generals v. Zenge entwickelte sich ein Verhältniß mit dessen ältester am 26. August 1780 geborenen|Tochter Wilhelmine. Grillenhaft, wünschte K. es anfangs selbst vor den Eltern zu verbergen, so daß nur Wilhelminens Schwester, Luise, die er „die goldene Schwester“ nannte, im Geheimniß war; aber etwa zu Anfang des Jahres 1800 schickte er der Geliebten mit einem Briefe voll des wärmsten Ergusses und, indem er sie noch in der dritten Person anredend, anflehte ihm schriftlich zu erklären, ob er wiedergeliebt werde, den Entwurf eines Schreibens an ihren Vater, in welchem er ihn um seine Einwilligung bat. Datum und Eingang dieses erst seit Kurzem bekannt gewordenen Briefes fehlen. „Ich sehe“, schreibt K., in einem Bilde das bereits das eines Dichters wiederspiegelt, „daß das neue Morgenlicht meines Herzens zu hell leuchtet und schon zu sehr bemerkt wird.“ Diesem Verhältnisse mit Wilhelmine v. Zenge verdanken wir eine zweite Reihe von werthvollen Briefen, von denen wir bisher 16 aus dem 1848 erschienenen Buche Eduard v. Bülow's kannten, während Karl Biedermann sich jetzt ein neues Verdienst erwirbt, indem er zunächst in „Nord und Süd“ deren weitere 18, worunter auch den eben angeführten herausgibt. Beide Reihen stammen aus dem Nachlasse der am 25. April 1852 gestorbenen Wilhelmine und die nunmehr von Biedermann zur Oeffentlichkeit gebrachte ist um so höher zu schätzen, als die Besitzerin sie wegen ihres die reinste Leidenschaft athmenden Inhaltes zurückbehalten und Bülow mehr die ethisch und pädagogisch gefaßten zur Benutzung gegeben hatte.
Nachdem K. mit Wilhelmine verlobt war, mochte ihn die Nothwendigkeit sich und seiner zukünftigen Frau eine Lebensstellung zu verschaffen, schon im Sommer 1800 nach Berlin getrieben haben. Der oben erwähnte Brief an Wilhelmine zeigt ihn bereits in Frankfurt unschlüssig in der Wahl einer Laufbahn. Die Rechte wollte er nicht studiren, „nicht die schwankenden, ungewissen, zweideutigen Rechte der Vernunft"; an die Rechte seines Herzens wolle er sich halten und ausüben wolle er sie, „was auch alle Systeme der Philosophie dagegen einwenden mögen“ An das diplomatische Fach denkend schrieb er: „ach Wilhelmine, ich erkenne nur ein höchstes Gesetz an, die Rechtschaffenheit und die Politik kennt nur ihren Vortheil.“ Hält man diese Bekenntnisse zu den früher seinem Lehrer gemachten und möglichst noch absprechenderen über den Militärstand, so wird man gewahr, daß der Kreis der Wirklichkeit, in dem er am Ende doch leben mußte, für ihn in dem Maße enger und unleidlicher wurde, wie der seiner sittlichen und bereits keimenden künstlerischen Ideen sich erweiterte. In Berlin war er anfangs aber doch voll guter Hoffnung. Er ging daselbst mit dem — später Bülow von Varnhagen v. Ense als ein Mann voll hohen Ernstes der Seele geschilderten — mecklenburgischen Edelmanne v. Brockes, mit Ernst v. Pfuel, Rühle v. Lilienstern und dem Grafen zur Lippe um. Auch hatte er eine vorläufige Beschäftigung im Accise- und Zolldepartement, als Vorbereitung zur cameralistischen Laufbahn übernommen. Auf einem Besuche bei den Frankfurter Verwandten zeigte er sich aber auf einmal entschlossen eine Reise anzutreten, die für seine ganze Zukunft von höchster Wichtigkeit wäre, deren eigentlichen Zweck er aber selbst Ulriken und seiner Braut sehr geheim hielt. Wien sollte das Ziel sein, aber wie wir sogleich sehen werden, hinderten ihn die Umstände es zu erreichen. Nachdem er Brockes in Pasewalk aufgesucht und ihn, wie es scheint, vollständig in sein Geheimniß eingeweiht hatte, so daß dieser ein Geldopfer von 600 Thalern brachte und sich seinen Verwandten gegenüber so stellte, als sei K. nur sein Begleiter, reisten beide gegen Ende August 1800 zunächst nach Leipzig, wo sie einen wahren Studentenstreich ausführten, indem sie sich von dem Magnificus Wenck Matrikel auf falsche Namen ausstellen ließen, um sie als Reisepässe zu benutzen. Schon Koberstein hat versucht sich Aufklärung über diese geheimnißvolle Reise zu verschaffen; aber Kleist's Nichte, die im Besitze der Briefe ihrer Tante Ulrike war, konnte ihm nur sagen, diese hätte erklärt die Reise wäre politischer Natur gewesen. Wilbrandt hingegen glaubt, „daß K. auf dieser Reise nur sich selbst, d. h. seinen Dichteiberuf und nichts anderes suchte.“ Diese Auffassung hat etwas sehr Edles und Bestechendes; aber manche Briefstellen, die sich an Thatsachen knüpfen, widersprechen ihr geradezu, namentlich der Umstand, daß K. in einem erst jetzt durch Biedermann veröffentlichten Schreiben aus Dresden vom 3. September 1800 seiner Braut anzeigt: „Soeben komme ich von dem englischen Ambassadeur Lord Elliot zurück, wo wir Dinge gehört haben, die uns bewogen nicht nach Wien zu gehen, sondern entweder nach Würzburg oder nach Straßburg.“ Die Wahrheit scheint nun darin zu bestehen, daß K. vom Berliner Zolldepartement einen auf Auskundschaften industrieller Verhältnisse gerichteten und politische Beobachtungen nicht ausschließenden Auftrag gehabt hat, daß sich aber theils durch den verlängerten Aufenthalt in Süddeutschland, dessen Naturschönheiten ihn anregten, theils durch das Zusammensein mit Brockes, die Keime des Dichterthums mächtiger in ihm zu regen ansingen. Nur so erklären sich die bald die realen, bald die idealen Ergebnisse dieser Reise betreffenden Schriftstellen.
Schon die bisher nach den sichersten Zeugnissen verfolgte eigenthümliche Entwickelung Kleist's erklärt, warum sein mehr autodidaktisches Studieren in Berlin so wenig von langer Dauer sein konnte, wie das methodischere in Frankfurt. Sein Drang nach Gründlichkeit vermochte sein frühzeitiges Anlangen auf den Höhen menschlichen Strebens nicht zu verhindern, von denen herab das Gelehrtenthum ihm, zum Theil mit Unrecht und zu seinem Schaden, klein vorkam. „Diese Menschen“, schrieb er, „sitzen sämmtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt seines sei das Beste und um den Baum kümmern sie sich nicht.“ Aber das bisher Erwähnte hatte den neuen Wendepunkt in seinem Leben nur vorbereitet; entscheidend wirkten folgende Ereignisse. Brockes, für den, wie der herrliche bereits die tiefste und zarteste psychologische Auffassung bekundende Brief an Wilhelmine aus Berlin vom 31. Januar 1801 in der Bülow’schen Sammlung beweist, K. einen wahrhaft antiken Freundescultus hatte, trennte sich von ihm, um ein Amt in Mecklenburg anzunehmen und mit ihm verlor er, wie er sich ausdrückte, den einzigen Menschen in der volkreichen Königsstadt, der jede, auch die geheimste Falte seines Herzens kannte. Andererseits und dies war ein weit unberechenbareres Unglück, hatte die Kant’sche Philosophie, die K., wie es scheint, erst seit Kurzem in Berlin kennen gelernt hatte, ihn zu einem der Verzweiflung nahen Skeptiker gemacht, so daß er in einem Briefe an Ulrike von Berlin den 5. Februar 1801 wehmüthig ausrief: „selbst die Säule, an welcher ich mich sonst in dem Strudel des Lebens hielt, wankt. — — Ich meine die Liebe zu den Wissenschaften.“ Am 22. März schreibt er der Schwester: „es scheint, als ob ich eines von den Opfern der Thorheit werden würde, deren die Kantische Philosophie so viele auf dem Gewissen hat. Mich ekelt vor dieser Gesellschaft und doch kann ich mich nicht losringen aus ihren Banden. Der Gedanke, daß wir hier von der Wahrheit nichts, gar nichts wissen, daß das was wir Wahrheit nennen, nach dem Tode ganz anders heißt und daß folglich das Bestreben sich ein Eigenthum zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ganz vergeblich und fruchtlos ist, dieser Gedanke hat mich in dem Heiligthum meiner Seele erschüttert. Mein einziges und höchstes Ziel ist gesunken, ich habe keines mehr.“ Der Braut schrieb er an demselben Tage über dieses innere Ereigniß zum Theil in denselben Ausdrücken und diese suchte ihn mit Gründen des gesunden Menschenverstandes zu widerlegen. Unter den vielen Geständnissen Kleist's ist dieses eines der merkwürdigsten und bezeichnendsten und man darf sich wundern, daß seine Biographen es nicht schärfer ins Auge gefaßt haben:|Weniger der Zweifel an der Natur des Bestehenden, als der an das in ihm Entstehende vollendete seine Verzweiflung. Von Ideen und Idealen erfüllt, deren Gestaltung bei ihm, namentlich damals, nur langsam und mühselig vor sich ging, wandte er die Zweifel an der Wirklichkeit des Geschaffenen auf die Wahrheit seiner eigenen noch erwarteten Geschöpfe an und sah diese vernichtet, noch bevor sie gestaltet waren. Rechnet man eine fast selbstmörderische Strenge gegen das eigene Kunstgebilde, bei dem glühendsten Eifer nach Unsterblichkeit, oder wie er vor diesem Zauberworte erröthend sagt, „nach Erwerbung eines Eigenthums, das uns auch in das Grab folgt“, hinzu, so kann man die Tiefe der Abgründe und das Verzehrende der Widersprüche ermessen, in denen er lebte. So entschloß er sich aufs neue zu reisen, indem er hoffte „die Bewegung würde ihm zuträglicher sein als dieses Brüten auf einem Flecke“, das in Wahrheit weit mehr ein Stürmen als ein Brüten war. Er hatte, ohne bestimmten Plan, hauptsächlich Paris in Auge gefaßt und sich dorthin Empfehlungen an Gelehrte geben lassen. Als der Augenblick der Abreise herannahte, erschrak er über sein Vorhaben, wollte es jedoch, da man schon zuviel davon gesprochen hatte, nicht mehr aufgeben. Ulrike, der er früher versprochen hatte, sie im Falle er ins Ausland ginge mitzunehmen, lud er zwar zur Mitreise ein, hegte aber die stille Hoffnung, sie würde schon des Kostenpunktes halber ablehnen. Als sie nun aber wider Erwarten zusagte, schrieb K. in einer Art fatalistischer Anwandlung am 9. April an Wilhelmine: „wir dünken uns frei und der Zufall führt uns allgewaltig an tausend feingesponnenen Fäden.“ Er fügte diesem seinem Briefe sein Miniaturporträt hinzu, das er wegen Mangels an Geld nicht einfassen lassen konnte. Es ist dies das von August Krüger gemalte, wie es scheint, einzig vorhandene Bildniß Kleist's und nach demselben hat Bülow von H. Sagert das Titeltupfer zu seiner Biographie Kleist's anfertigen lassen. Der Kopf ist mehr einnehmend als schön, das Gesicht etwas breit mit starken Backenknochen, die Stirn trotz des übergekämmten Haares hoch, das Auge mit den scharf gezeichneten Augenbrauen ausdrucksvoll, der Mund schön geschnitten und sinnlich, das bartlose Kinn wohlgeformt. Der allgemeine Ausdruck ist, worüber K. sich beschwert, da der Maler ihm empfohlen hat zu lächeln, freundlich und läßt keine Seelenunruhe ahnen, so daß der sich Verabschiedende wol mit Berechtigung schrieb: „es liegt etwas Spöttisches darin, das mir nicht gefällt, ich wollte er hätte mich ehrlicher gemalt.“ Tieck sagt uns in seinen Vorreden zu den hinterlassenen und zu den gesammelten Schriften Kleist's, daß er von mittlerer Größe und ziemlich starken Gliedern war. „Er schien ernst und schweigsam, keine Spur von vordringender Eitelkeit, aber viele Merkmale eines würdigen Stolzes in seinem Betragen.“ Er schien Tieck, der ihn übrigens, wie er selbst gesteht, nicht viel kannte, mit dem Bilde von Torquato Tasso Aehnlichkeit und mit diesem die etwas schwere Zunge gemein zu haben.
Unter den hier dargestellten Kämpfen hat K. eine „Geschichte meiner Seele“ geschrieben, von welcher Rühle eine Abschrift besessen haben und die litterarisch sehr werthvoll gewesen sein soll. Sie scheint leider gänzlich verloren zu sein, läßt aber vermuthen, daß die gleichlautenden Stellen in den Briefen an die beiden Mädchen auf den Text der Geschichte seiner Seele zurückzuführen sind. „Die Sprache“, hatte K. einmal Ulriken gebeichtet, „kann die Seele nicht malen“ und doch war er gewissenhaft und kühn genug es zu unternehmen. Mitte April 1801 abgereist, trafen die Geschwister, da sie in Deutschland zahlreiche Ausflüge gemacht und hervorragende Persönlichkeiten besucht hatten, erst am 10. Juli 1801 in Paris ein. Sie bezogen eine Wohnung in der Rue Royer Nummer 21 und gingen viel mit der Tochter des berühmten Astronomen Lefrançais de Lalande um, der 1751 von der französischen Akademie zu wissenschaftlichen Zwecken|nach Berlin geschickt worden war. Die Bekanntschaft dieser Familie hatten sie wahrscheinlich durch Alexander v. Humboldt gemacht, der sich damals gerade in Paris aufhielt. Ulrike legte Mannskleider an und glaubte sich auf diese Weise freier bewegen zu können; K., der zum Theil auch durch den preußischen Gesandten v. Lucchesini einige Gelehrte kennen lernte und Vorlesungen hörte, kam bald von diesen Versuchen wieder zurück. So sehr man einerseits auch bedauern muß, daß das ungeheure Treiben der Weltstadt außer Stande war die geistige Eingezogenheit Kleist's zu verändern, so sehr muß man andrerseits die Unbestechlichkeit bewundern, mit welcher seine tief-sittliche Lebensanschauung den Freuden des Pariser Lebens gegenüber stand. Das Jahresfest der Erstürmung der Bastille, dem er beiwohnte, konnte nach seiner Ueberzeugung nicht unwürdiger als durch diesen Aufwand frivoler Volkszerstreuungen begangen werden. Keine der gemachten Anstrengungen erinnerte, wie er am 18. Juli, vier Tage nach dem Feste, der mit dem Maler Lohse verlobten Henriette v. Schlichen, die er in Dresden kennen gelernt hatte, schreibt, an die Hauptgedanken. Rousseau würde sich schämen, wenn man ihm sagte, daß dies sein Werk sei. Wilhelminen berichtet er am 15. August, er könne ihr nicht beschreiben, welchen Eindruck dieser Anblick der höchsten Sittenlosigkeit bei der höchsten Wissenschaft auf ihn mache. Die französische Nation sei reifer zum Untergange als irgend eine andere europäische Nation und wenn er sich die Bibliotheken ansehe, wo in prächtigen Sälen und in prächtigen Bänden die Werke Rousseau's, Helvetius' und Voltaire's stehen, denke er, was haben sie genützt? Dieser Brief, einer der merkwürdigsten, die wir von K. besitzen, läuft in einer scharfsinnigen philosophischen Abhandlung aus, die an Geist und Form eine auffallende Aehnlichkeit mit einem Essay von Montaigne hat und die Alles in Allem genommen spinozistisch ist. „Dieselbe Stimme, die dem Christen zuruft seinem Feinde zu vergeben, ruft dem Seeländer zu ihn zu braten — und mit Andacht ißt er ihn auf. Wenn die Ueberzeugung solche Thaten rechtfertigen kann, darf man ihr trauen? Was heißt das auch etwas Böses thun, der Wirkung nach? Was ist böse? Absolut böse? Tausendfältig verknüpft und verschlungen sind die Dinge der Welt, jede Handlung ist die Mutter von Millionen anderen und oft die schlechteste erzeugt die beste. Sage mir: „wer auf dieser Erde hat schon etwas Böses gethan?“ Die Philosophie des Tragikers war somit bei K. schon in Paris vollständig ausgebildet und es kann kaum einen wichtigeren Beitrag zur Phänomenologie des Kunstprocesses geben als diesen, weil durch ihn bewiesen wird, daß wenn bei vielen Dichtern sich erst die Gestalten und dann die Ideen offenbaren, bei anderen das grade Gegentheil der Fall ist. Allerdings ist diese Kleist’sche Philosophie mehr dem Gefühl als dem Verstande entsprungen, aber dennoch entwickelte sich das plastische Element, das Kunstkörperliche bei ihm langsamer und später. Wie unendlich erhaben K. aber damals schon über dem Weltgetriebe überhaupt stand, wie weit sein Ideenkreis sich erstreckte, mag folgende Stelle aus demselben Briefe erweisen: „Wer wird nach Jahrtausenden von uns und unserem Ruhme reden? Was wissen Asien und Afrika und Amerika von unseren Genien? Und nun die Planeten? Und die Sonnen? Und die Milchstraße? Und die Nebelstraße?“ Ohne daß K. es ahnte, entwickelte Paris in ihm seine verschiedenen Anlagen, auch die humoristisch-satirische, denn bis dahin hatte er noch nichts geschrieben, was dem ergötzlichen Briefe an Luise „die goldene Schwester“ vom 16. August auch nur ähnlich wäre: zuerst die in Schwarz gemalte fast griesgrämige Darstellung von Paris und seiner Sittenverderbtheit, und endlich der folgende poetische Ausbruch, der bereits die Bilderhast in den früheren Briefen an Poesie unendlich übertrifft: „Große, stille, feierliche Natur, Du die Kathedrale der Gottheit; deren Gewölbe der Himmel, deren Säulen die Alpen, deren Kronleuchter die Sterne, deren Chorknaben die Jahreszeiten sind, welche Düfte schwingen in den Rauchfässern der Blumen, gegen die Altäre der Felder, an welchen Gott Messe liest und Freuden austheilt, zum Abendmahl unter Kirchenmusik, welche die Ströme und die Gewitter rauschen, indessen die Seelen entzückt ihre Genüsse an dem Rosenkranze der Erinnerung zählen. So spielt man mit Dir!“ — Doch dies könnte man immerhin noch Reflexionspoesie nennen, aber das reizende Bild des Pariser Liebespärchens, das diesen recht eigentlich zur Litteratur Kleist's gehörenden Brief schließt, ist bereits ächte, Höheres verheißende Poesie. Endlich muß als Frucht dieses scheinbar fruchtlosen Pariser Aufenthaltes noch angeführt werden, daß der Franzosenhaß, der sich damals schon bei K. zeigte, sich theils durch den bloßen Gegensatz des Deutschen und Romanischen, theils durch das hohe Rechtsgefühl des Dichters, das später in Michael Kohlhaas so schön zum Ausdrucke kam, entband.
Wer sich in diese philosophisch poetische Stimmung Kleist's vertieft und vorhandenen Andeutungen nach für wahrscheinlich hält, daß er schon in Paris an dem Drama „Robert Guiskard“ gearbeitet hat, was seine Verachtung der Außenwelt allerdings noch deutlicher erklärte, den kann sein im October 1801 gereifter Entschluß sich in der Schweiz anzukaufen und Landmann zu werden, kaum Wunder nehmen. Schon vor der Pariser Reise und namentlich in einem längeren Berliner Briefe vom 13. November 1800 hatte er Wilhelmine einen ähnlichen Plan zum Stillleben mitgetheilt und sich entschlossen gezeigt „dem ganzen prächtigen Bettel von Adel, Stand, Ehre und Reichthum zu entsagen“, wenn er nur Liebe bei ihr findet. Am 10. und am 27. October 1801 schrieb er über das neue Vorhaben an Wilhelmine und bat sie es zunächst ihrer und seiner Familie zu verschweigen. Er fühlte daß es unbescheiden war ein Opfer von ihr zu verlangen, wie das auf dem Lande seine Gefährtin zu werden; aber wenn sie es selbst bringen könnte? Ulrike, das gesteht er der Braut offen ein, hat alles Mögliche gethan ihn, wie sie es nennt, auf den rechten Weg zurückzuführen, sie glaubt nicht einmal, daß die Ausführung des Planes ihn glücklich machen wird. Aber obgleich Wilhelmine sich gegen denselben erklärt hatte, stand sein Entschluß fest und im November 1801 verließ er, Ulrike bis Frankfurt a. M. begleitend, Paris. Die Schwester, für welche eine Schweizerreise im Winter an und für sich schon mißlich gewesen wäre, kehrte nach Hause zurück, während K. mit dem Maler Lohse, dem er in Frankfurt begegnete und der nach Italien wollte, zu Fuß nach der Schweiz ging. Durch das gegen Ende des Jahres 1881 bei Spemann in Stuttgart erschienene Werk: „Heinrich v. Kleist in der Schweiz“, von Theophil Zolling, wird dieser wichtige, wenn auch nur kurze Abschnitt im Leben des Dichters zum ersten Male ausführlicher beleuchtet. Unter geistvollen, wenn auch oft zu strengen Ausführungen über K. selbst hat Zolling den Schweizer Kreis des 25jährigen Dichters bis in sein engstes, den alten Wieland und die Wittwe Salomon Geßner's nahe berührendes Familienleben und bis zur Einwirkung der damaligen politischen Wirren auf diese Verhältnisse dargestellt. Am 16. December 1801, einige Tage nach seiner Ankunft in Basel, schrieb K. in den liebevollsten Ausdrücken an Ulrike; er ließ seinem Schmerze über die Trennung freien Lauf und hoffte, daß sie ihm Alles verzeiht. Heinrich Zschokke, den er aufsuchte und der, da er in Frankfurt a. O. studirt und gelehrt hatte, ein alter Bekannter des Kleist’schen Hauses sein mochte, war augenblicklich, von Schweizer Staatsgeschäften ausruhend, nach Bern gezogen, wo er mit Heinrich Geßner, dem zweiten Sohne Salomon Geßner's, litterarisch verkehrte. So lernte K., als er nach Bern ging, durch Zschokke auch Geßner und Wieland's ältesten Sohn Ludwig kennen. Heinrich Geßner hatte nämlich Wieland's vierte, durch Schönheit ausgezeichnete Tochter Charlotte Wilhelmine geheirathet und der alte Wieland seinen etwas unfolgsamen und freigeistig gesinnten Aeltesten zu dem Schwiegersohne nach Bern geschickt, wo dieser sich, nachdem er die Orell-Geßner-Füßli’sche Buchhandlung verlassen, nach kürzerem Aufenthalte in Aarau und Luzern, als Helvetischer National-Buchdrucker und selbständiger Buchhändler angesiedelt hatte.
Geßner und Wieland hatten zwar nicht entfernt die dichterische Anlage Zschokke's und noch viel weniger Kleist's, aber durch Ursprung und Bildung waren sie mit der gesammten poetischen Bewegung in Deutschland verwachsen und Wieland, von dem später Mancherlei gedruckt wurde, ließ es schon damals an Ausarbeitungen und humoristischen Ergüssen nicht fehlen. So bewegte sich K. in einem im Ganzen anregenden Kreise und es kam besonders in Zschokke's Wohnung zu gegenseitigen Mittheilungen der geistigen Erzeugnisse, unter Anderem auch zu der des von Kleist wahrscheinlich schon früher begonnenen und in der Schweiz weitergeführten Trauerspiels: „Die Familie Schroffenstein", von welchem Zschokke in seiner „Selbstschau“ sagt, daß „im letzten Act das allseitige Gelächter der Zuhörerschaft wie auch des Dichters so stürmisch und endlos wurde, daß bis zu seiner letzten Mordscene zu gelangen Unmöglichkeit wurde.“ Trotzdem brachte K. auf seine neuen Freunde vollkommen die Wirkung eines Dichtergenies hervor, wie dies aus den Eindrücken, welche der alte Wieland in Weimar durch die Briefe seines Sohnes erhielt und aus den Geständnissen Zschokke's ersichtlich ist. In diesen heißt es unter Anderem: „Wir vereinten uns auch wie Virgil's Hirten zum poetischen Wettkampf. In meinem Zimmer hing ein französischer Kupferstich: „la cruche cassée.“ In den Figuren desselben glaubten wir ein trauriges Liebespärchen, eine keifende Mutter mit einem Majolikakruge und einen großnasigen Richter zu erkennen. Für Wieland sollte dies Aufgabe zu einer Satire, für K. zu einem Lustspiele, für mich zu einer Erzählung werden. Kleist's „Zerbrochener Krug“ hat den Preis davongetragen.“ Da dieses Lustspiel wie es jetzt vorliegt, erst viel später und nicht in der Schweiz vollendet worden ist, so muß das Berner Preisstück wol nur eine vorläufige Bearbeitung gewesen sein. Wenn ferner, wie es heißt, Wieland K. veranlaßt hat die Handlung der Familie Schroffenstein von Spanien nach der Schweiz oder Deutschland zu verlegen, so muß es auffallen, warum die Frage noch nicht gestellt worden ist, wie das Stück ursprünglich geheißen hat. Zschokke spricht von dem vorgelesenen und ausgelachten Stücke, indem er es unter dem Titel nennt, den es heute noch führt.
Wie dem auch sein mag, der Berner Dichterkreis löste sich bald wieder auf. In Folge ausgebrochener Unruhen, die K. fürchten ließen die Schweiz könnte unter französische Herrschaft fallen, gab er den Plan ein kleines Gut zu kaufen, obgleich Ulrike ihm bereits das Geld dazu vorgeschossen hatte, auf und nachdem er im März 1802, in Gesellschaft Wieland's, Zschokke zu Fuß nach dem Aargau begleitet hatte (eine Reise die Letzterer in seiner Selbstschau das Umherschwärmen von Schmetterlingen nennt), vertauschte er seine Wohnung in Thun mit einem völlig abgelegenen Häuschen auf der Aarinsel. Hier, wo eine Fischerstochter ihm die Wirthschaft führte, vollzog sich die Auflösung des Verhältnisses zu Wilhelmine, über welche die Veröffentlichung Biedermann's endlich nähere Aufschlüsse gibt. K. hatte schon von Frankfurt a. M. aus, am 2. December 1801, Wilhelminens Einwände gegen das Landleben zu widerlegen gesucht. „Alles", schrieb er, „ist vergessen, wenn Du Dich noch mit Fröhlichkeit und Heiterkeit entschließen kannst“, und bedeutungsvoll fügt er hinzu: „die Antwort auf diesen Brief soll entscheidend sein.“ Wilhelmine antwortete um die Zeit des Jahreswechsels und stürmte, wie K. selbst gesteht, mit vieler Herzlichkeit auf ihn ein zurückzukehren ins Vaterland. Nachdem er sie ein viertel Jahr ohne Rückantwort gelassen hatte, beschwerte sie sich am 10. April 1802 bitter und zeigte ihm zugleich den plötzlichen Tod ihres|Bruders an, der sie selbst dem Tode nahe gebracht hatte. Trotzdem schickte K. ihr aber am 20. Mai seinen Abschiedsbrief, in welchem man, außer einer schlecht verhüllten Härte, einen Widerspruch mit sich selbst finden könnte, wenn man nicht im Auge behalten müßte, daß K. sich überhaupt in Extremen bewegte und vom Weibe die unbedingteste Aufopferung träumte und dichtete. Er gesteht einerseits ein, daß er, nachdem er wegen des Volksaufstand es die feste Ansiedlung in der Schweiz aufgegeben, angefangen habe für ein Glück anzusehen, daß sie ihm nicht in die Schweiz habe folgen wollen und dennoch knüpft er an diesen Mangel von Ergebung an, um das Verhältniß aufzulösen. Wenn er, so heißt es in diesem letzten Schreiben an Wilhelmine, nicht mit Ruhm ins Vaterland zurückkehren könne, so geschähe es nie. In dieser Lage wecke ihr Brief wieder die Erinnerung an sie, „die glücklicher Weise ein wenig ins Dunkel getreten war“. Darum solle sie ihm nicht mehr schreiben, er habe keinen anderen Wunsch als bald zu sterben. In diesen inneren Zerrüttungen sind indessen zwei Lichtpunkte hervorzuheben: in der mehr oder weniger berechtigten Ueberzeugung, in der Fremde und in der Einsamkeit seinen Dichterberuf besser erfüllen zu können, opferte K. ihm seine Liebe, die eine ernste war und machte gerade zu jener Zeit Riesenanstrengungen ihm nachzukommen. Er arbeitete auf der Aar-Insel an verschiedenen Werken, sicher an dem ihn wahrhaft verzehrenden „Robert Guiskard“, vielleicht aber auch an Entwürfen zu den nicht auf die Nachwelt gekommenen Trauerspielen „Peter der Einsiedler“ und „Leopold von Oesterreich“. Nach mündlicher Mittheilung Pfuel's an Wilbrandt war die Hauptscene des ersten Actes dieses letzteren Drama's (weiter war es überhaupt nicht gediehen) die, daß die Ritter Leopolds vor der Schlacht von Sempach würfeln, wer wol umkommen wird und wer nicht. Da nach einander alle Würfel schwarz fallen, so verstummt allmählich das Lachen, das die ersten Würfe begleitete und ahnungsvoll sehen die Ritter ihren Untergang voraus. In Folge einer Erkrankung im Juni 1892 siedelte K. nach Bern über, wo der Arzt und Apotheker Dr. Wyttenbach, ein Freund Zschokke's, ihn behandelte. Er mußte sich von dort im August in verzweifelter Stimmung an seinen Schwager v. Pannewitz um Geld wenden. Ulrike kam selbst und begleitete ihn nach seiner Genesung im October nach Deutschland zurück. Er begab sich, den aus der Schweiz ausgewiesenen Ludwig Wieland mitnehmend, zunächst nach Jena und dann sehr bald nach Weimar, wo er den Dichter des Oberon auf seinem zwei Stunden entfernt gelegenen Gute Osmanstädt besuchte. „Wiewol“, schrieb Wieland später (am 19. April 1804) an einen Pfarrer bei Wiesbaden, der ihn um Aufschlüsse über den ihm räthselhaft vorkommenden jungen Mann gebeten hatte, „mir nichts mehr zuwider und peinlich ist als ein überspannter Kopf, so konnte ich doch seiner Liebenswürdigkeit nicht widerstehen.“ Kleist's Zurückhaltung würde vermuthlich ein näheres Verhältniß abgeschnitten haben, wenn der gutmüthige alte Dichter nicht durch seinen Sohn erfahren hätte, daß ihm eine Einladung in Osmanstädt zu wohnen sehr erwünscht wäre. Sie fand statt und wie Wieland in seinem Briefe an jenen Pfarrer weiter erzählt, wurde K. sein Commensal auf eben dem Fuß, als ob er zu seiner Familie gehörte. Nach langem Drängen gestand K., auf welchen Wieland's hübsche Tochter nicht ohne Eindruck geblieben war, seinem freundlichen Wirth endlich, „daß er an einem Trauerspiel arbeite, aber ein so hohes und vollkommenes Werk darin seinem Geiste vorschwebe, daß es ihm noch immer unmöglich gewesen sei es zu Papier zu bringen. Er habe zwar schon viele Scenen nach und nach aufgeschrieben, vernichte sie aber immer wieder, weil er sich selbst nichts zu Dank machen könne.“ Es gelang Wieland endlich ihn zu bewegen, ihm einige der wesentlichsten Scenen und mehrere „Morceaux“ aus anderen aus dem Gedächtniß vorzudeclamiren. Wieland gesteht, daß er erstaunt war und er glaubt nicht|zu viel zu sagen, wenn er versichert: „wenn die Geister des Aeschylus, Sophokles und Shakespeare sich vereinigten eine Tragödie zu schaffen, sie würde das sein, was Kleist's „Tod Guiskard des Normannen", sofern das Ganze demjenigen entspräche, was er ihn damals hören ließ.“ „Von diesem Augenblicke an“, fährt Wieland fort, „war es bei mir entschieden, K. sei dazu geboren die große Lücke in unserer dramatischen Litteratur auszufüllen, die, nach meiner Meinung wenigstens, selbst von Schiller und Goethe noch nicht ausgefüllt worden ist. In Jena hatte K. Schiller, in Weimar Goethe besucht und war von beiden freundlich aufgenommen worden. Daß er den „Guiskard“ gerade in Weimar wiederholt umdichtete und damit, wie Pfuel Wilbrandt mitgetheilt hat, Goethe, so hoch er ihn auch verehrte, „den Kranz von der Stirne reißen wollte“, ist für diese den Himmel aus Abgründen stürmende Natur sehr bezeichnend.
Anfang März 1803 ging K. nach Leipzig und nahm dort Unterricht in der Declamation bei Kerndörffer. Die Schweizer Freunde hatten indessen „Die Familie Schroffenstein“ ohne den Namen des Verfassers herausgegeben und sie fand in einigen Zeitschriften mehr Lob als man erwarten konnte, während K. seiner Schwester am 14. März schrieb, sie möge das Stück ungelesen lassen, es sei eine „elende Scharteke“. Daß es im Uebrigen nicht durchgerungen war, beweist der Umstand, daß Männern wie Varnhagen, Fouaué, Chamisso, die K. in Berlin kennen lernten, bei dessen Verschwiegenheit unbekannt blieb, daß er der Dichter dieser Tragödie sei. Sie ist sein unreifstes größeres Werk, höchst gewagt in der Motivirung und zum Theil auch im Versbau vernachlässigt, was zu bestätigen scheint, daß K., der sonst unaufhörlich seilte, das Stück aufgegeben hat. Die Festigkeit der Charakteristik und einzelne Schönheiten vermögen für diese Mängel nicht zu entschädigen.
Wir finden K. dann in Dresden, wo er Pfuel, Rühle und die Familie Schlieben wiedersah. Seine Gemüthsstimmung war so verdüstert, daß er Henriette v. Schlieben, die wegen ihres Bräutigams besorgt war, von Doppelmord sprach und Pfuel wiederholt den gemeinschaftlichen Selbstmord antrug. Dieser suchte ihn durch ein neues Reiseproject zu zerstreuen, und nachdem Ulrike wiederum mit Geld und durch persönliches Erscheinen in Dresden zu Hülfe gekommen war und er auch die Freude erlebt hatte von Wieland einen Brief zu erhalten, in welchem dieser ihm schrieb, er müsse den „Guiskard“ vollenden und wenn der ganze Kaukasus auf ihn drückte, reiste er am 20. Juli mit Pfuel, meist zu Fuß, nach der Schweiz. In Genf brach seine volle Verzweiflung aus: er war zu der Ueberzeugung gekommen, daß er den „Guiskard“ nicht vollenden könne und schrieb am 5. October 1803 an Ulrike jenen merkwürdigen bei Koberstein unter Nr. 25 mitgetheilten Brief, der als ein wahres Denkmal dieses Ungeheuern Kampfes der Seelenkräfte gelten kann. „Ich habe nun ein halbtausend hintereinander folgende Tage, die Nächte der meisten mit eingerechnet, an den Versuch gesetzt zu so vielen Kränzen noch einen auf unsere Familie herabzuringen: jetzt ruft mir unsere heilige Schutzgöttin zu, daß es genug sei. Sie küßt mir gerührt den Schweiß von der Stirn und tröstet mich, wenn jeder ihrer lieben Söhne nur ebensoviel thäte, so würde unserem Namen ein Platz in den Sternen nicht fehlen. — — — Die Hölle gab mir meine halben Talente, der Himmel schenkt dem Menschen ein ganzes oder gar keins.“ Die Freunde gingen nun durch Südsrankreich nach Paris; hier aber zerfiel K. in einem Streite über Sein und Nichtsein förmlich mit Pfuel, der, während ersterer in der Hitze hinweggerannt war, auszog und nur ein Billet an ihn zurückließ. Hierauf verbrannte K. alle seine Papiere, worunter der bereits mehrmals zerstörte „Guiskard“ und, wie Bülow vermuthet, die Dichtungen „Peter der Einsiedler“ und „Leopold von Oesterreich“ und ging, während Pfuel, von bösen Ahnungen getrieben, ihn bereits|in der Morgue suchte, nach Boulogne sur Mer, wo er in dem Zuge Napoleons gegen England den Tod zu finden hoffte. Dieser Entschluß, der ihn in Widerspruch mit seinen französischen Antipathien setzte, stand bei ihm so fest, daß er Rekruten denen er unterwegs begegnete, zum Glück vergeblich anbot an die Stelle eines von ihnen einzutreten. Ein französischer Stabsarzt, der ihn zufällig erkannte, rettete ihn von der Gefahr als Spion betrachtet und erschossen zu werden, nahm ihn als Bedienten mit nach St. Omer und von hier aus verschaffte sich K. einen Paß von dem preußischen Gesandten in Paris, der ihn aber direct nach Potsdam zurückverwies. In Mainz erkrankte er lebensgefährlich, wurde jedoch durch den Arzt v. Wedekind nach sechsmonatlichem Leiden wieder hergestellt und nachdem ihm der krause Einfall durch den Kopf gegangen war, sich in Coblenz bei einem Tischler zu verdingen und der bereits erwähnte Pfarrer, bei dem er sich eine Zeit lang in der Gegend von Wiesbaden aufhielt, daran gedacht hatte, ihn im Bureau eines seiner Freunde unterzubringen, kehrte er im Juni 1804 nach Potsdam zurück. Hier standen ihm große Demüthigungen bevor. Er mußte den ihm früher unerträglichen Plan einer Staatsanstellung wieder aufnehmen, während Lucchesini rücksichtslos genug gewesen war den Brief, mit welchem K. sich von St. Omer aus an ihn gewandt hatte, in die Hände des Königs gelangen zu lassen, so daß Friedrich Wilhelm III. in seiner ungünstigen Meinung über den armen Dichter nur noch bestätigt wurde. Der Generaladjutant v. Köckeritz, dem K. sein Gesuch vortrug, warf ihm unter Anderem vor „Versche“ gemacht zu haben, während K. ihm, wie er der Schwester (der er übrigens hatte versprechen müssen, der Dichtkunst ganz den Rücken zu kehren) von Berlin am 24. Juni schreibt, unter Thränen gestand, „seine Einschiffungsgeschichte hätte gar keine politischen Motive gehabt, sie gehöre vor das Forum eines Arztes weit eher als des Cabinets.“ Er theilte Ulriken auch mit, daß er an den König geschrieben habe, „doch weil das Anerbieten meiner Dienste wahrscheinlich fruchtlos bleiben wird, so habe ich es wenigstens in einer Sprache gethan, welche geführt zu haben mich nicht gereuen wird. Du selbst hast es mir zur Pflicht gemacht mich nicht zu erniedrigen; und lieber die Gunst der ganzen Welt verscherzen als die Deinige!“ Unter bangen Hoffnungen und Schwankungen verstrich das Jahr 1804. Eine Zeit lang hatte sich K. die Aussicht dargeboten unter dem wegen seiner glänzenden Eigenschaften bekannten und K. von Potsdam her befreundeten Major v. Gualtieri, der als Gesandter nach Madrid ging, in die diplomatische Laufbahn zu treten; dann war auch die Rede davon ihn in Baireuth anzustellen; endlich aber gab die Gnade des Königs sich darin kund, daß K., welcher allen diesen Plänen leidend und skeptisch gegenüberstand, als Diätar zur Domänenkammer in Königsberg kam, wo er das Glück hatte, den dort gleichfalls beamteten Pfuel, der von ihm übrigens schon in Potsdam mit einem Besuche überrascht worden war, zu finden. Eine eigenthümliche Wendung des Schicksals war es, daß gerade dort seine ehemalige Braut Wilhelmine nunmehr als Gattin W. T. Krug's lebte, Krugs, der demjenigen Philosophen im Lehrstuhl gefolgt war, welcher durch seine „Kritik der reinen Vernunft“ den tiefen Riß in seinem Gemüthe verursacht, ja ihn dem Wahnsinn nahe gebracht hatte. Der Schwerpunkt seines Leidens war indessen so verändert, daß er bei dem Rivalen Hausfreund werden konnte und in Gesellschaft Wilhelminens und der „goldenen Schwester“ sogar neue Nahrung für sein poetisches Schaffen fand. Da ihm, wie es scheint durch Vermittlung von Ulriken's am Hofe verkehrenden Bekannten, von der Königin Luise eine jährliche Pension von sechzig Friedrichsdor erwirkt worden war und er außerdem Diäten bezog, so konnte er, trotz des Zusammenschmelzens seines kleinen Vermögens, seine materielle Existenz eine leidliche nennen; aber in das Beamtenthum konnte er sich schlechterdings|nicht finden, obgleich er mit seinem Chef, dem späteren Minister Freiherr v. Altenstein, auf einem freundschaftlichen Fuße stand.
Bei sorgfältiger Prüfung ergibt sich, daß der Königsberger Aufenthalt den wichtigsten Abschnitt im Leben Kleist's bildet: erst dort, mit dem Eintritte in das Mannesalter, reifte er zum wahren Dichter heran. Gleichzeitig übten die politischen Ereignisse einen mächtigen Einfluß auf ihn aus und die Bedrängniß der vaterländischen Erde zog ihn gewissermaßen von seinen abstracteren Idealen zu dieser überhaupt herab. Schon Ende December 1805 schrieb er an Rühle, zwar mit Nachlässigkeiten im Stile, aber offenbar in ungesuchtem ersten Wurf, einen Brief politischen Inhaltes, in welchem sich nicht allein ein wahrer Seherblick kundgab, sondern auch ein Muth der Ueberzeugung, der ihm, den die geringste Unverschwiegenheit brotlos machen konnte, zu hoher Ehre gereicht. Seine poetischen Arbeiten in Königsberg waren vielseitig. Er verfaßte dort die wenn auch im Hauptmotiv anstößige, doch in der Ausführung mustergültige Novelle „Die Marquise v. O.“ und einen Theil des „Michael Kohlhaas“, zu welchem Pfuel, der aus Schöttgen's und anderen Chroniken geschöpft haben mochte, die erste Anregung gab, indem er den Stoff als für ein Drama geeignet hielt. Ferner arbeitete er an dem, wie wir wissen schon in der Schweiz erdachten „Zerbrochenen Krug", am „Amphitryon“ und aller Wahrscheinlichkeit nach auch an der „Penthesilea“. Aus dem Staatsdienste zog er sich, wie vorauszusehen war, zurück, that dies aber, namentlich aus Rücksichten für Altenstein, unter Beobachtung gewisser Formen. Da nach den schweren Kriegsereignissen die Pension der Königin fast gleichzeitig mit der Weiterzahlung der Diäten aufhörte, gerieth er aufs Neue in Bedrängniß. Er kränkelte und seine damaligen Briefe an Ulrike ergehen sich in herzzerreißenden Stoßseufzern über die Lage des Vaterlandes. In seinen Briefen ist jedoch, bezeichnend genug, keine Spur zu finden, daß er gegenüber dieser äußersten Noth des Vaterlandes daran gedacht hätte selbst wieder Soldat zu werden; aber derselbe dichterische Egoismus, der ihn daran verhinderte, machte aus dem preußischen Lieutenant einen Herold Deutschlands. Doch bevor es dazu kam, sollten ihn seltsame Schicksale erreichen. Im Januar 1807 mit den Offizieren Pfuel, Gauvin, Ehrenberg und einer größeren Reisegesellschaft von Königsberg abgereist, um nach Berlin zu gehen, hatte er sich in Cöslin einen Paß verschafft und denselben in Damm und Stettin, wo er zuerst französische Truppen fand, visiren lassen. Nachdem die übrige Reisegesellschaft sich unterwegs getrennt und Pfuel zu seinem Glücke kurz vor Berlin den Weg nach Nennhausen zu Fouqué genommen hatte, erreichte K. mit Gauvin glücklich Berlin; hier wurden sie aber, weil sie von Königsberg kamen, K., was bei ihm ein Naturfehler war, leicht in Verlegenheit gerieth und ihr Austritt aus dem Heere als eine Fälschung angenommen wurde, auf Befehl des Generals Clarke, als vermeintliche Parteigänger kriegsgefangen nach Frankreich abgeführt und unter schlechter Behandlung in das Schloß Joux bei Pontarlier gesperrt. Den Bemühungen Ulriken's, deren französischer Brief an den General Clarke vom 8. April 1807, sowie dessen Antwort in der Koberstein’schen Sammlung enthalten ist, verdankte K., den man anfangs hatte Noth leiden, später aber in Chalons an der Marne gleich den anderen Kriegsgefangenen frei hatte herumgehen lassen, ungefähr gleichzeitig mit dem Tilsiter Frieden seine Befreiung. Die Gefangenschaft scheint die Muse indessen nicht von seiner Seite verscheucht zu haben, denn er beschäftigte sich während derselben vorzugsweise mit der „Penthesilea“ und überhaupt mit der Vollendung der früher begonnenen Arbeiten.
K. ging über Berlin nach Dresden. Er war unterwegs auf einem Gute in der Lausitz mit Ulrike zusammengekommen und hatte ihr Vorschläge gemacht sich gemeinsam mit ihr niederzulassen; aber wenn sie schließlich auch fühlen mochte,|daß sie den Bruder in seiner dichterischen Laufbahn nicht aufhalten könnte, so scheute sie doch das Mitleben der damit verbundenen Aufregungen und ließ ihn allein nach Dresden ziehen. Er hatte diese Stadt offenbar gewühlt, weil sich dort während der Kriegsstürme ein gewisses geistiges Leben zusammengefunden hatte und weil namentlich Rühle, der inzwischen als Major und Kammerherr des Herzogs von Weimar dessen Sohn Bernhard in Dresden erzog, sowie Psuel, der nach dem Frieden von Tilsit aus dem Heere getreten war, sich daselbst aufhielten. Auch hatte Rühle in Dresden, um K. die Rückkehr aus Frankreich zu erleichtern, das diesem weit werthvollere Manuscript des „Amphitryon“ für nur 24 Louisdor an den Buchhändler Arnold verkauft, wo es mit einer Vorrede von Adam Müller herausgekommen war, so daß K. die beste Aussicht hatte in Dresden als bekannter Dichter auftreten zu können. Er fand sich in dieser Erwartung nicht getäuscht, denn er kam dort mit Leichtigkeit in einen sehr anregenden und anerkennenden Kreis: zu dem Appellationsrath Körner, wo Schiller's günstiges Urtheil sein Erscheinen vorbereitet hatte, zu dem österreichischen Gesandten v. Buol, wo Poesien von ihm vorgetragen wurden und an dessen Tafel er sogar mit einem Lorbeerkranze gekrönt wurde, zu der Familie v. Haza und anderen. Auch Gotthilf Heinrich Schubert siedelte sich damals in Dresden an und stand in vertrautem Umgange mit Adam Müller, der dort nicht ohne Beifall besonders ästhetische Vorlesungen hielt. Zu diesem, der damals erst 29 Jahre alt war, trat K., von dessen Enthusiasmus für seine Dichtungen geblendet, in ein engeres Verhältniß, das für sein übriges Leben entscheidend wurde. Nachdem der mehr mit glänzendem als tiefem Geiste begabte Schriftsteller und spätere österreichische Diplomat schon im Mai 1807, als K. noch in Chalons Gefangener war, dem in den Dresdener Kreisen sehr beliebten Gentz den Amphitryon mit mehr als empfehlenden Worten geschickt hatte, war ihm darüber von dem Freunde unter anderen Lobeserhebungen geantwortet worden: „Selbst da, wo dieses Stück nur Nachbildung ist, steigt es zu einer Vollkommenheit, die nach meinem Gefühl weder Bürger noch Schiller, noch Goethe, noch Schlegel in ihren Uebersetzungen französischer oder englischer Theaterwerke jemals erreichten. Denn zugleich so Molière und deutsch zu sein ist wirklich etwas wundervolles," Dieses Urtheil ist um so bemerkenswerther, als Gentz bekanntlich ein großer Kenner der französischen Sprache war und sich später zu den gleichzeitigen Werken Kleist's, zur „Marquise v. O.“ und zur „Penthesilea“ ablehnend verhielt.
Auf Müller's Anregung entstand nun der Plan zur Errichtung einer Buch-, Karten- und Kunsthandlung, bei welcher außer K. auch Rühle und Pfuel sich betheiligen sollten. Der in praktischen Dingen unerfahrene K., dem es einleuchtete, daß er die buchhändlerischen Vortheile der Verleger selbst einstreichen könnte, verlockte Ulrike mit 500 Thalern statt seiner als Actionär einzutreten, was eigentlich nur ein verkapptes neues Anleihen war. Das Hauptunternehmen der Buchhandlung sollte die Herausgabe eines Journals für die Kunst, des „Phöbus“ werden, in welchem K. den poetischen, Müller den philosophischen und der damals sehr bewunderte Maler Ferdinand Hartmann, aus der Schule Carstens', der Professor an der Dresdener Akademie war, den Theil der bildenden Künste leiten sollte. Dieses Unternehmen kündigte sich unter um so günstigeren Aussichten an, als sogar Goethe, Wieland, Johannes v. Müller und Andere Beiträge versprachen; auch wurde der Buchhandlung der Verlag der Schriften von Novalis angeboten und so eine für K. sehr günstige Lage vorbereitet. Es scheint, daß die Freunde, wol um sich vor feindseligen französichen Einflüssen sicher zu stellen, sich sogar das Wohlwollen des französischen Gesandten in Dresden erworben hatten, denn K. zeigt am 25. October 1807 Ulriken an, daß der Gesandte, dessen nähere Bekanntschaft ihm nun geworden sei, an Clarke|(den früheren Gouverneur von Berlin, damaligen Kriegsminister und späteren Herzog von Feltre) geschrieben habe; doch bittet er sie nicht voreilig zu sein und politische Folgerungen aus diesem Schritte zu ziehen, über dessen eigentliche Bedeutung er sich hier nicht weitläufiger auslassen könne. Merkwürdig genug bleibt immerhin, daß (aller Wahrscheinlichkeit nach Ulrike selbst) an dieser Stelle des Briefes vier Zeilen mit großer Sorgfalt ausgestrichen hat. Bei der Vorstellung einer Schlangenwindung Kleists dem Franzosen gegenüber, muß man unwillkürlich an die Haltung Hermanns gegenüber Varus denken. — Der mit dem Januar 1808 begonnene „Phöbus", der in schön ausgestatteten Monatsheften herauskam und in welchem mit die besten Werke Kleist's, wie Theile der „Penthesilea“, des „Zerbrochenen Kruges“, des „Käthchens von Heilbronn", des „Robert Guiskard". des „Michael Kohlhalls", der „Marquise von O.", „Epigramme", „Die Jünglingsklage“, „Der Schrecken im Bade“, herauskamen, konnte sich indessen doch nicht länger als ein Jahr halten, woran zum Theil die thätigen, zum Theil die nur in Aussicht gestellten Mitarbeiter, zum Theil aber auch die Zeitumstände schuld waren. Die letzte Nummer erschien verspätet erst im Februar 1809; der Rest der Auflage mußte, mit der Auslösung des ganzen Geschäftes, der Walther’schen Buchhandlung in Dresden überlassen werden.
Auch in anderer Weise war der Dresdener Aufenthalt ereignißreich für K. Er hatte mit einem angenehmen und begüterten Mädchen, der Nichte und Mündel des alten Körner, ein Perhältniß begonnen, dem wie es scheint, auch einige Gelegenheitsgedichte im „Phöbus“ galten. Seine uns schon von dem Verhältnisse mit Wilhelminen her bekannte Zumuthung, die Geliebte solle ihm ohne Wissen der Familie schreiben, au' welche diese sich nicht einließ, löste die bereits einst gewordene Verbindung am. Aus diesem Herzensereigniß und wol auch aus Nachklängen des unendlich tieferen Verhältnisses zu Wilhelmine v. Zenge bildete K. das Weib, wie er es sich in seiner grenzenlosen Hingebung an den Mann dachte, indem er das „Käthchen von Heilbronn“ schrieb. Tieck, den er erst in Dresden kennen lernte, wurde, ohne es beabsichtigt zu haben, in Folge eines mißverstandenen Urtheils der Urheber einer wesentlichen Veränderung in diesem Stücke, die er später ebenso wie K. selbst sehr bereute. Weniger erfreulich hatte sich Kleist's Verhältniß zu Goethe gestaltet. Nachdem er ihm das erste Heft des „Phöbus" mit der „Penthesilea“ übersandt hatte, erhielt er unter dem 1. Februar eine wenig günstige Antwort. „Sie ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden Region, daß ich mir Zeit nehmen muß mich in beide zu finden.“ Auch fügte Goethe hinzu, daß es ihn immer betrübt und bekümmert, wenn er junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches erst kommen soll. Weit schlimmer erging es K. aber in Weimar mit dem „Zerbrochenen Krug“. Goethe hatte, um die einactige Länge des Stückes zu kürzen, es in mehrere Acte getheilt. Als es am 2. März 1808 in Weimar zur Aufführung gelangte, fiel es gänzlich durch und man kann kaum annehmen, daß Goethe's Einrichtung hieran schuld gewesen sei. Weit eher dürfte man diesen Mißerfolg auf Rechnung des Kleist’schen derben Naturalismus, an welchen man in Weimar nicht gewöhnt war, und der schlechten Darstellung schreiben; aber unerhört bleibt immerhin, daß Fräulein v. Knebel ihrem Bruder darüber mittheilen konnte: „Wirklich hätte ich nicht geglaubt, daß es möglich wäre so was Langweiliges und Abgeschmacktes hinzuschreiben — der moralische Aussatz ist doch auch ein ernstes Uebel.“ K. gerieth über den Mißerfolg seines Lustspieles derart in Aufregung, daß er Goethe dafür verantwortlich machte und ihn, wie Eduard Devrient in seiner „Geschichte der deutschen Schauspielkunst“ erzählt, zu einem Duell herausfordern ließ. Sicherer als diese Ueberlieferung ist die Thatsache, daß K. sich im „Phöbus“ durch Epigramme|an Goethe zu rächen suchte, namentlich durch ein durchaus unschickliches, das sich auf das Verhältniß zu Christiane Vulpius bezog. Im Herbst 1808 sah er den Mißerfolg des buchhändlerischen Unternehmens, das er zu vernachlässigen angefangen hatte, bereits voraus und machte einen Versuch sich durch Opium zu vergiften, wurde jedoch durch Rühle, der ihn betäubt auf dem Bette fand, gerettet. Auch das deutet auf ernste Gemüthsstörung, daß K., einmal plötzlich behauptend Adam Müller müsse ihm seine Frau abtreten, diesen in die Elbe stürzen wollte.
Es folgte nun ein Zeitpunkt, in welchem die Geschicke unseres Dichters durch die allgemeinen Geschicke Deutschlands und durch die geistige Revolution welche unsere bis dahin von dem politischen Leben entfernte Dichterwelt in patriotischem Sinne aufzurütteln begann, mächtig berührt wurden. Umfassender, tiefer und symbolischer als alle seine Zeitgenossen erfaßte K. das Problem des Freiheitsgesanges, indem er an die Ueberlieferung der Jahrtausende anknüpfend, „Die Hermannsschlacht" dichtete. Er kam zu diesem Stoffe ähnlich wie Goethe zum „Faust“, durch die Verwandtschaft seiner Natur mit der durch die sich aufdringende Ueberlieferung symbolisirten Idee und dieser Beweis seines Berufes muß, obgleich er dichterisch höheres leistete als „Die Hermannsschlacht“, bei der Schätzung seines Genius obenangestellt werden. Der Versuch dieses Drama 1809 auf das Wiener Hoftheater zu bringen mißlang, obgleich die Rüstungen Oesterreichs gegen Frankreich schon in vollem Gange waren und es wurde nicht allein nirgends aufgeführt, sondern es durfte bei Kleist's Lebzeiten auch nicht einmal im Druck erscheinen. Die spanischen Ereignisse belebten inzwischen den deutschen Rachegeist noch mehr, K. dichtete sein Lied „An Palafox“, das im Volkston geschriebene „Kriegslied der Deutschen“ und gelegentlich der österreichischen Erhebung die Strophen an Franz I., die an Erzherzog Karl vom März und vom Mai 1809, die erhabene Hymne mit Chor „Germania an ihre Kinder“ und nicht lange darauf „Das letzte Lied“.
Nachdem Oesterreich, die Abziehung französischer Streitkräfte durch Spanien benutzend, Frankreich am 15. April 1809 den Krieg erklärt und in seinem Aufrufe gesagt hatte, die Freiheit Europa's habe sich unter die Fahne Oesterreichs geflüchtet, wollte K. mit dem kaiserlichen Gesandten nach Wien gehen. Eine Zusammenkunft mit Ulrike ließ ihn zu spät nach Dresden zurückkehren; da er aber durch Hartmann eines Abends auf der Elbbrücke den jungen Friedrich Dahlmann kennen lernte, so kam er mit diesem noch an demselben Abende überein, nächster Tage zu Fuß nach Oesterreich zu wandern. Aus der schönen Darstellung welche Dahlmann für Julian Schmidts einschlägliche Arbeiten entworfen hat ersehen wir, daß die Wanderlust die neuen Freunde hauptsächlich darum ergriff, weil „der sächsische Hof sich der schlechten Sache anschloß und es ihnen daher besser schien die Zukunft abzuwarten." Wer je mit geistig Verwandten intimen Umgang pflegte, den wird die folgende Stelle nicht ungerührt lassen: „Auf dieser mehrtägigen Wanderung“, sagt Dahlmann, „durchdrangen wir eigentlich einander, ergriffen gegenseitig Besitz von uns und wir kamen noch später öfter verwundert darauf zurück, wie so oft es sich getroffen habe, daß wenn wir recht lange schweigend nebeneinander gegangen, dann der eine plötzlich anfing von einem ganz entlegenen Gegenstande zu reden, der doch derselbe war, über den der andere sich eben auslassen wollte.“ In Prag, wo die Freunde wenige Häuser von der Moldaubrücke, an der „kleinen Seite", in zwei Zimmern nebeneinander wohnten, that sich die Handschrift „der Hermannsschlacht“ vor Dahlmann auf „mit Allem was sie Großes, Wildes, Herz und Nieren Ergreifendes, zu Zeiten auch Ergötzendes an sich hat.“ Nach einem in Znaym bestandenen Abenteuer, bei welchem der mit geheimen Unterhandlungen mit dem Erzherzoge Karl beauftragte Oberst v. Knesebeck dadurch verwundet wurde, daß K. trotz aller Warnung die von Dahlmann gekauften Pistolen geladen hatte und nach der Gefangennahme der beiden Freunde auf dem Schlachtfelde von Aspern, wo man sie für französische Spione hielt, kehrten sie wieder nach Prag zurück. In Folge der Schlacht von Aspern eröffneten sich K. gute Aussichten. Gleichzeitig mit den angeführten Gedichten hatte er eine Anzahl politischer Aufsätze theils in Form von Satiren geschrieben und da er durch den Baron Buol bei dem Grafen Kolowrat, der damals den Posten eines Stadthauptmanns von Prag inne hatte, eingeführt wurde, so las er sie, als für ein Wochenblatt bestimmt, in dessen Hause mit Beifall vor. Man faßte, schrieb er am 17. Juli an Ulrike, die Idee ein Wochenblatt, die „Germania“ zu stande zu bringen, lebhaft auf. — — „So lange ich lebe, vereinigte sich noch nicht so viel um mich eine frohe Zukunft hoffen zu lassen.“ Schon war die Einleitung zur „Germania' bis auf den Schluß geschrieben. Rudolf Köpke hat sie uns mit den übrigen prosaischen Arbeiten, von denen soeben die Rede war, in dem von ihm herausgegebenen Buche „Heinrich v. Kleist's politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken“, die Tieck in den nachgelassenen und gesammelten Schriften des Dichters nicht aufgenommen hat, überliefert. Sie gibt uns ein genaues Programm des Unternehmens: „Diese Zeitschrift, heißt es, soll der erste Athemzug der deutschen Freiheit sein. Sie soll alles aussprechen, was während der drei letzten unter dem Druck der Franzosen verseufzten Jahre in den Brüsten wackerer Teutschen verschwiegen bleiben mußte, alle Besorgnisse, alle Hoffnung, alles Elend und alles Glück.“ Bald vernichtete die Schlacht von Wagram auch diesen Traum und wie Laun in seinen Memoiren erzählt, reute nunmehr der Entschluß in K., Napoleon zu ermorden. Er wollte sich durch Hartmann, der den Vorfall Laun mitgetheilt hat, wahrscheinlich für den Fall des Mißlingens, Arsenik verschaffen, aber dieser gab sich zu der That nicht her. Nach einer glücklich überstandenen schweren Krankheit, an welcher die neue Niederlage des deutschen Vaterlandes nicht fremd gewesen sein mag und nach Abschluß des am 14. October zu stande gekommenen Schönbrunner Friedens kehrte K. nach Preußen zurück. Er schien diese Reise indessen weniger um in Berlin zu bleiben, als wegen Verwerthung seines wahrscheinlich letzten Erbantheils am elterlichen Hause gemacht zu haben, wie dies aus dem rein geschäftlichen kurzen Schreiben hervorgeht, das er am 28. November 1809 der in Pommern sich aufhaltenden Ulrike übersandte und in welchem er ihr anzeigt, daß er „nach dem Oesterreichischen“ zurückgehe. Sein Gemüth schien versöhnter zu sein, er traf in Frankfurt Luise v. Zenge und als zufällig die Rede auf den Selbstmord kam, äußerte er, ein Mensch, der einen solchen begehe, komme ihm vor wie ein trotziges Kind, dem der Vater nicht geben wolle, was es verlange und das dann hinauslaufe und die Thür hinter sich zuwerfe. Nach Berlin zurückgekehrt, bestimmte ihn die Familie, die inzwischen immerhin Proben seines anerkannten Dichtertalentes erhalten hatte, vornehmlich aber wol die vielbewährte, ihm sehr nahe stehende Gemahlin des Adjutanten des Königs, v. Kleist, dort zu bleiben und eröffnete ihm die Aussicht durch die Dichtung eines vaterländischen Drama's eine öffentliche Belohnung (Bülow sagt Unterstützung) zu erhalten. So dichtete K. in überraschend kurzer Zeit den Prinzen von Homburg und konnte schon am 19. März 1816 der Schwester schreiben, das Stück würde bei dem Fürsten Radziwil aufgeführt, solle auf die Nationalbühne kommen und wenn es gedruckt ist der Königin übergeben werden. Diese, deren Sympathie für K. wir bereits kennen, war am 23. December 1809 mit dem Könige wieder nach Berlin zurückgekehrt und am darauffolgenden 10. März, ihrem Geburtstage, überreichte K. ihr das bekannte Sonett, von dem er in dem letzterwähnten Briefe an Ulrike schrieb, daß sie es vor den Augen des|ganzen Hofes zu Thränen gerührt habe. So erwartete der an neue Hoffnungen sich Klammernde sogar eine „Hofcharge“ und bat deshalb die Schwester dringend, sich auf einige Zeit in Berlin, wo sie ihm namentlich bei den Altensteinischen Damen sehr nützen konnte, niederzulassen. Ulrike widerstand, der Prinz von Homburg fand in den Kreisen, die Kenntniß davon bekamen, keinen Beifall, er wurde bei Lebzeiten des Dichters weder gedruckt noch öffentlich aufgeführt und etwa vier Monate nach ihrem von K. mitgefeierten 35. Geburtstag starb die Königin in Hohenzieritz. Man muß sich diese und die noch folgenden Schicksalsschläge, die K. nacheinander trafen, vergegenwärtigen, um die eingetretene Verzweiflung des von der Natur zum Tiefsinn Angelegten zu begreifen. Der Tod der Königin war für ihn nicht blos in realer Beziehung der härteste Schlag: er stellte ihn direct wieder vor das Lebensräthsel, von dessen Lösungsversuchen die Wirklichkeit mit ihren Erfordernissen ihn befreien zu wollen schien. Für ihn war es mit der göttlichen Vergeltung gegen den Erbfeind um so sicherer aus, als die welche am meisten berechtigt war sie zu erleben, der Sphäre ihres Leidens und geträumten Triumphes entrückt wurde.
Auch mit dem „Käthchen von Heilbronn“, das inzwischen im Theater an der Wien aufgeführt worden war, machte K. in Berlin schlechte Erfahrungen. Iffland ließ ihn lange auf Antwort warten und wies das Stück zuletzt zurück, wobei es zu einem unerquicklichen Austausch von Briefen kam. Dieses Drama und ein Band Erzählungen erschienen hierauf in der Berliner Realschulbuch-Handlung, aber für Kleist's Existenz war hiermit nicht besser gesorgt. So entschloß er sich zur Herausgabe einer neuen Zeitschrift, der „Berliner Abendblätter“, die wieder mit Unterstützung des in Berlin eine Anstellung suchenden Adam Müller, außerdem aber einiger anderer Schriftsteller, wie Fouqué, Achim v. Arnim. Brentano, Friedrich Schulze, vom 1. October an zu erscheinen begannen. Dieses auch äußerlich schlecht ausgestattete Organ führte im Ganzen ein kümmerliches Dasein, aber es brachte außer der Novelle „Die heilige Cäcilie“ doch noch eine so stattliche Anzahl von Aufsätzen aus der Feder unseres Dichters, daß Rudolf Köpke, obgleich ihm nur 75 Nummern, die vom 1. October bis 28. December 1810 vorlagen, während die bis in den Februar 1811 hineinreichenden unauffindbar zu sein scheinen, eine immerhin bedeutende Nachlese daraus halten konnte. An das Erscheinen der „Abendblätter“ knüpfte sich ein neues Aergerniß. K. hatte bei Gründung derselben auf die weitere Unterstützung der Regierung, an deren Spitze damals Hardenberg stand, gerechnet. Sie würde ihm vielleicht auch zu Theil geworden sein, wenn der in Wien zum Katholicismus übergegangene Adam Müller den hohen preußischen Beamten nicht als besonderer Anhänger Oesterreichs verdächtig gewesen wäre und sich später sogar mit der gegen die Reform wüthenden Junkerpartei verbündet hätte. Dieser maß alle Schuld Friedrich v. Raumer, der bei Hardenberg eine Vertrauensstellung hatte, bei und so entstand zwischen K. und Raumer eine Correspondenz, die, nachdem letzterer sich gerechtfertigt, mit erniedrigenden Entschuldigungen Kleist's, der Bitte ihm die Redaction des „Kurmärkischen Amtsblattes" anzuvertrauen uud zum Theil berechtigten, aber immerhin mißlichen Entschädigungsansprüchen gegen den Staatskanzler endete. Raumer's „Lebenserinnerungen und Briefwechsel“, der Brief Müller's an Heeren in Hoffmann's „Findlingen“, Kleist's Brief an Fouqué vom 25. April 1811 und die auf diese Documente sich stützende ausführliche Entwickelung Wilbrandt's geben über diese letzten Wirren in der litterarischen Laufbahn Kleist's ausführliche Aufschlüsse. Friedrich v. Raumer mag, als Köpke ihm zu seinem 60jährigen Amtsjubiläum, am 8. December 1861, Heinrich v. Kleist's politische Schriften mit einer besonderen Vorrede widmete,|sich doch wol mit Wehmuth der strengen büreaukratischen Weise erinnert haben, mit welcher er, als junger Beamter, den Dichter des Prinzen von Homburg behandelt hat. —
Gegen den Herbst des Jahres 1811 trat plötzlich und zwar zum letzten Male ein Lichtschimmer für K. ein. Wie er Ulriken von Frankfurt aus in einem Briefe ohne Datum (dem 55. der Koberstein’schen Sammlung) mittheilt, hatte der König ihn „durch ein Schreiben im Militär angestellt“ und er machte sich übertriebene Hoffnung, entweder unmittelbar bei ihm Adjutant zu werden, oder eine Compagnie zu erhalten. Wie dieser Umschwung zu stande kam, ist bisher nicht ermittelt, aber es ist nicht unmöglich, daß Gneisenau, von dem man vermuthet daß er Gelegenheit hatte den glühenden Patriotismus Kleists aus ihm mitgetheilten politischen Aufsätzen kennen zu lernen, zu den stillen Beschützern Kleist's gehört hat. Um sich zu einer kleinen Einrichtung die nüthigen Mittel zu verschaffen, reiste K. nach Frankfurt, dort kam es aber innerhalb der Familie zu so peinlichen Auftritten, daß er im tiefsten Innern verletzt, unrettbar der alten Selbstmordsucht verfiel. Die wichtigen Schriftstücke, welche über diese letzten Lebenstage des Dichters Licht verbreiten, waren selbst dem umfassenden und tiefen Werke Wilbrandt's noch nicht erschlossen und sind erst durch Paul Lindau, dem der Nachlaß des Kriegsrathes Peguilhen zur Verfügung stand, in der „Gegenwart“ vom 2., 9., 16. und 23. August 1873 mit Umsicht und Scharfblick der Oeffentlichkeit übergeben worden. Hiernach hatte K. zu jener Zeit ein vertrautes Verhältniß zu seiner Cousine Marie v. Kleist, die selbst sehr unglücklich und kränkelnd, theils in Berlin, theils auf dem Lande lebte. Fast gleichzeitig hatte er durch Adam Müller die Frau des Generalrendanten der kurmärkischen Land-Feuer-Societät Adolphine Henriette Vogel, geb. Keber, kennen gelernt, die drei Jahre jünger als er, in körperlicher und geistiger Beziehung eine wahre Zierde ihres Geschlechtes gewesen sein soll. Sie litt, wie actenmäßig feststeht, an einer unheilbaren Krankheit, welche ihr schwärmerisches Gemüth bis zur Extase erregt haben mochte und soll K. einmal das Versprechen abgenommen haben, sie, die Unheilbare, wenn sie es verlange, zu tödten. Aus den letzten Briefen Kleist's an Marie geht hervor, daß er selbst das Verhältniß zu Henriette als eine Untreue gegen erstere auffaßt; aber er bekennt ihr, „er habe sie nicht mit einer Freundin vertauscht die mit ihm leben, sondern die im Gefühl, daß er ihr ebenso wenig treu sein würde wie ihr, mit ihm sterben wolle.“ Diese und andere Briefstellen bekunden ein die Wirklichkeit vielleicht übertreffendes Ausschweifen des Geistes, während andere sich zur höchsten poetischen Schönheit erheben; so daß wir es hier mit einem inneren dramatischen Kampfe zu thun haben, wie er nur bei tief poetisch angelegten Naturen möglich ist. Sein Erscheinen unter den Verwandten in Frankfurt mit dem neuen Ansinnen auf Hülfe erregte unter ihnen unverholene Bestürzung und dies schmerzte ihn so, daß er Marie am 10. November 1811 schrieb, „er wolle lieber zehnmal den Tod erleiden, als noch einmal erleben, was er das letzte Mal in Frankfurt an der Mittagstafel zwischen seinen beiden Schwestern, besonders als die alte Wackern dazukam, empfunden habe.“ Dennoch würde man fehlgehen, wenn man die Katastrophe vorwiegend diesem Erlebnisse im Elternhause zuschriebe. K. hatte Marien wie Anderen längst vorher den gemeinsamen Tod vorgeschlagen und sagt in jenen letzten Briefen an sie tiefbezeichnender Weise, daß Henriette „seine Traurigkeit als eine höhere festgewurzelte und unheilbare begreife.“ Endlich geben diese letzten schriftlichen Aeußerungen Kleist's den unumstößlichen Beweis, daß die erniedrigenden politischen Zustände wesentlich zu seinem Lebensüberdrusse beigetragen haben. In dem Briefe vom 10. November an Marie heißt es „die Allianz, die der König jetzt mit den Franzosen schließt, ist auch nicht geeignet mich am Leben festzuhalten.|Die Zeit ist ja vor der Thür, wo man wegen der Treue gegen den König, der Aufopferung und Standhaftigkeit und aller anderen bürgerlichen Tugenden von ihm selbst gerichtet an den Galgen kommen kann.“
K. und Henriette hatten ursprünglich den Plan ihrem Leben in Cottbus ein Ende zu machen, wählten schließlich aber eine düstere Gegend am Ufer des Wansees, wo K. schon 10 Jahre früher in Gesellschaft Rühle's und Pfuel's die sicherste Methode des Selbstmordes erörtert hatte und die ihm beim Niederschreiben der fünften Strophe seines letzten Liedes wieder vorgeschwebt zu haben scheint. Nachdem er kurz vorher seine Papiere vernichtet, kam er am 26. November Nachmittags 2 Uhr mit Henriette in einem Miethwagen in dem eine Meile von Potsdam dem Wirth Stimming gehörigen Kruge, der sich dicht am See, gegenüber dem letzten Chausseehause befindet, an. Der zu den gerichtlichen Acten genommene Bericht des Wirthes, den Bülow vollständig mittheilt, gibt die genaueste Auskunft über ihr Verhalten: sie schickten den Wagen leer zurück, aßen vergnügt zu Mittag, nahmen zwei Zimmer, gingen am See spazieren, hatten die ganze Nacht (die sie wahrscheinlich mit dem Schreiben der letzten Briefe zubrachten) Licht und schon um 5 Uhr Morgens kam Henriette herunter und bat um Kaffee. Mittags sandten sie, nachdem sie die Rechnung bezahlt hatten, einen Boten mit einem Briefe nach Berlin, „waren vergnügt und scherzhaft“, erkundigten sich, wann der Bote wol in Berlin sein könne und verlangten, man möchte ihnen gegen besondere Vergütung den Kaffee auf den schönen grünen Platz jenseits des See's bringen lassen. „Die Dame hatte ein Körbchen, welches mit einem weißen Tuch bedeckt war, am Arme, worin wahrscheinlich die Pistolen gelegen haben," Als die Frau, die den Kaffee an den betreffenden Ort gebracht und Zahlung dafür empfangen hatte, etwa 40 Schritt gegangen war, fiel ein Schuß, nach etwa 30 weiteren Schritten ein zweiter, „die Frau glaubte aber, daß sie zum Vergnügen schössen, weil beide so scherzhaft und munter gewesen waren, Steine ins Wasser geworfen hatten und (wahrscheinlich um jeden Verdacht abzulenken) miteinander gescherzt und gesprungen waren.“ Endlich findet man die Unglücklichen entseelt daliegen: „Henriette in einer liegenden Stellung, hinten übergelehnt, den Oberrock an beiden Seiten aufgeschlagen und die Hände aus der Brust zusammengefaltet. Die Kugel war in die linke Brust durch das Herz und am linken Schulterblatt wieder herausgegangen. Der Herr in derselben Grube“ (K. hatte eine durch das Ausroden eines alten Baumes entstandene Vertiefung gewählt), „vor ihr knieend, hatte sich eine Kugel durch den Mund in den Kopf geschossen. Beide waren gar nicht entstellt, vielmehr hatten sie eine heitere zufriedene Miene.“ Um 6 Uhr kamen Vogel und Peguilhen von Berlin in den Krug. Ersterer war ganz untröstlich und ließ sich am anderen Morgen eine Haarlocke von seiner Frau holen. „Um 2 Uhr Nachmittags den 22. kam der Herr Hofmedicus und Polizeioffizianten von Berlin, nahmen alles zu Protokoll, ließen die Leichen nach dem kleinen Hause bringen, daselbst öffnen und untersuchen. Hiernach wurden beide in die von dem Kriegsrath Peguilhen besorgten Särge gelegt und Abends 10 Uhr in ihre Ruhestätte" (dicht, wie sie gewollt hatten, neben dem Orte wo die Leichen gefunden worden waren) „begraben.“ In einem der von diesen Gästen des Todes im Haide-Kruge bewohnten Zimmer fand man nur zwei Bücher: den Don Quixote, wahrscheinlich Kleist's und Klopstock's Oden, wahrscheinlich Henriettens letztes Lesebuch, in welchem die wie für den Fall geschriebene „todte Clarissa“ besonders angemerkt war. Die letzten von K. geschriebenen Briefe sind biographisch höchst merkwürdig: neben den schwärmerischsten und zartesten Aeußerungen nehmen sie Bedacht auf das Ordnen von Kleinigkeiten, nach dem förmlichen Ausschütten eines zerrissenen Herzens athmen sie eine Versöhnung mit dem Schicksal, wie sie schöner nicht gedacht werden|kann. Sein Abschiedsbrief an Ulrike ist ein wahres Denkmal dieses geklärten inneren Zustandes. „Ich kann nicht sterben, ohne mich, zufrieden und heiter wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen Anderen, meine theuerste Ulrike, mit Dir versöhnt zu haben. Laß sie mich, die strenge Aeußerung, die in dem Briefe an die Kleisten (Marie) enthalten ist, laß sie mich zurücknehmen; wirklich Du hast an mir gethan, ich sage nicht was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten: die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl, möge Dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich: das ist der herzlichste und innigste Wunsch, den ich für Dich aufzubringen weiß. Stimmings bei Potsdam den — am Tage meines Todes. Dein Heinrich.“
Der tragische Fall erregte weit über die deutschen Grenzen hinaus großes Aufsehen und es fehlte, namentlich in Berlin, nicht an hämischen und die Wahrheit entstellenden Auslegungen. Diesen gegenüber versuchte Peguilhen, der treue, aber gegenüber den damaligen Verhältnissen in seinem Eifer vielleicht zu weit gehende Freund, in einem in der Vossischen Zeitung vom 26. November 1811 erschienenen Nachruf die öffentliche Meinung zu beschwichtigen, indem er einige Bruchstücke über die Katastrophe vorzulegen versprach und darum bat „nicht eher zwei Wesen lieblos zu verdammen, welche die Liebe und Reinheit selbst waren“. Hierauf erhielt er aber am 6. December einen Erlaß des Polizeipräsidenten, nach welchem der König das Erscheinen dieser Schrift verbietet. Scharf beleuchtet werden diese Verhältnisse unter Anderem dadurch, daß Peguilhen in einer Denkschrift an den Staatskanzler sagte: „ich wollte dieses Ereigniß für das Vaterland benutzen und wahrlich nicht Selbstmord predigen, sondern die schnöde Furcht vor dem Tode als eine Krankheit des Zeitalters bekämpfen.“
Die Zeit, in der K. lebte, hat an ihm nicht weniger gesündigt wie er an sich selbst: so eng hängt sein Schicksal mit dem damaligen seines Vaterlandes zusammen, daß man es nicht öffentlich besprechen konnte, ohne die tiefsten Wunden desselben zu berühren. Darum schlossen auch die dem Hofe und dem Heere so nahestehenden Verwandten sogar einem Tieck gegenüber den Mund und selbst nach dem glorreichen Frieden von 1815 vergingen noch sechs Jahre, bevor die beiden deutschen Nationaldramen „Die Hermannsschlacht“ und „Der Prinz von Homburg“ im Druck erschienen. Aber in einer wie gewöhnlich breiteren Spanne Zeit zeigte sich das Schicksal versöhnlicher als die Menschen, denn 60 Jahre nach dem Tode Kleist's, konnte der Verfasser dieser Biographie, bei der Erhebung des Sohnes Friedrich Wilhelm III. zum deutschen Kaiser im Schlosse von Versailles die Potsdamer Garden, bei denen K. sein öffentliches Leben begonnen hatte, die Ehrenfahnen halten sehen. An K. ist das Eigenthümlichste, daß sein Leben mit seinem Schaffen in weit unmittelbarerem Zusammenhange steht als bei irgend einem anderen deutschen Dichter: seine Fehler sind auf dieses zu ehrliche Dichten seines inneren Lebens zurückzuführen; aber viele seiner Vorzüge würden sicher verloren gegangen sein, wenn er, vorausgesetzt daß dies überhaupt möglich war, sein Leben mehr beherrscht und seine Kunst, wie ein Priester das Heilige vom Ungeweihten, mehr von ihm geschieden hätte. Diese Lebensbedingung Kleist's machte sein Dichterorgan zu einem vorzugsweise dramatischen und selbst wo er in der Lyrik das Höchste erreichte, im „Letzten Lied“, entrollt er auf dem düstern Hintergrunde einer gewitterschweren Zeit den erschütternden Verlauf seiner eigenen Tragödie. Ein sprödes, norddeutsches, aber wie mit Düften des Urwaldes getränktes Element geht durch alle seine Dichtungen, von denen die meisten erst nach einer erstaunlichen Arbeit und Feile vollendet worden sind. Sein Idealismus ist stark von Sinnlichkeit durchdrungen, so daß er zuweilen herb, zuweilen anstößig wird und das Maßlose in manchen seiner Charaktere|und Handlungen hängt mit seiner eigenen Maßlosigkeit im Streben nach dem Absoluten zusammen, während das Hereinziehen des Uebernatürlichen auf den Einfluß der Romantiker zurückzuführen ist. Von seinen acht Dramen ist „Der Prinz von Homburg“ das reifste und insofern auch das seinen Genius am tiefsten kennzeichnende, als es einer an Pessimismus streifenden vollständigen Umkehr des historischen Verhältnisses seine Entstehung verdankt. Nur ein ironischer, die äußersten Folgen menschlichen Handelns durchdringender Geist konnte die in einer Aeußerung des großen Kurfürsten enthaltene Möglichkeit einer kriegsrichterlichen Verurtheilung des Prinzen von Homburg zur Wirklichkeit umgestalten. Der hohe nationale Werth dieses Drama's besteht nun aber darin, daß K. in einem beschränkten, das engere Vaterland umfassenden Rahmen das ewige Verhältniß der Freiheit zur Schranke darstellt, das gegenüber der großartigen Entwickelung eines acht deutschen Fürstencharakters und angesichts meisterhaft motivirter Nebencharaktere, mit der Läuterung des gegen die Schranke sich Auflehnenden, in welchem der Dichter seine eigenen Jugendirrthümer abgespiegelt hat, schließt. Diese in seine letzten Lebensjahre fallende Schöpfung berechtigt zu der Annahme, daß er im Großen und Ganzen die innere Kluft überwunden hatte und daß nur äußere Drangsale sie wieder geöffnet haben. Auch „Die Hermannsschlacht“ gehört, trotz mancher Fehler, zu den urwüchsigsten Werken unserer Litteratur und ebenso ist im „Käthchen von Heilbronn“, obgleich das Problem geradezu verkehrt gelöst ist, das deutsche Element von dem höchsten Zauber der Poesie umflössen. Die Penthesilea und der Amphitryon sind hochpoetische, Schönheiten ersten Ranges enthaltende, aber im Ganzen verfehlte Versuche, wohingegen man in Betreff des Zerbrochenen Kruges Friedrich Hebbel beistimmen muß, wenn er sagt, daß diesem Stücke gegenüber nur das Publikum durchfallen kann. Das gewaltige Fragment des Guiskard läßt durch den äußersten Pathos, der sich gleich zu Anfang des Stückes entrollt, begreiflich finden, warum K. sich vergebens an der Steigerung und Vollendung dieses Drama's abmühte. Von den Novellen ist Michael Kohlhaas nach Inhalt und Form die musterhafteste und sowol in den wenigen lyrischen Gedichten wie in den prosaischen Aufsätzen ästhetischen und politischen Inhaltes, auch in den Briefen, sind Perlen, die noch lange nicht genügend gewürdigt sind.
-
Literatur
Außer Tieck's und Julian Schmidt's Vorreden zu Kleist's Werken sind besonders zu erwähnen: H. v. Kleist's Leben und Briefe von E. v. Bülow; H. v. Kleist von A. Wilbrandt; dessen Briefe an seine Schwester Ulrike von A. Koberstein, seine politischen Schriften von Rudolf Köpke, zu H. v. Kleist's Werken (über die verschiedenen Lesarten) von Reinbold Köhler, H. v. K. und der zerbrochene Krug, neue Beiträge von Karl Siegen (mit dem Taufscheine und dem Todtenscheine), sowie dessen Festschrift und die werthvolle biographische Einleitung zur Brockhaus’schen Ausgabe der ausgewählten Dramen, Rudolf Genée's Einleitung zu seiner Bearbeitung der Hermannsschlacht, H. v. Treitschke's Abhandlung über H. v. K. in den Preußischen Jahrbüchern, December 1858, die Quelle der Kleist’schen Erzählung Michael Kohlhaas von Emil Kuh in Kolatschek's Stimmen der Zeit, 1861, Nr. 31. A. R. Schillmann, H. v. K., seine Jugend und die Familie Schroffenstein. Hebbel's Abhandlungen über K. in dessen sämmtlichen Werken. Bd. XI und XII. Briefe von Tieck, hrsg. v. Holtei. Schwarze's Artikel im Frankfurter Publizisten, 1876 und in d. Gegenwart X, Nr. 44 über Kleist's Familienverhältnisse. O. Wenzel's Beitrag z. Lebensgeschichte H. v. Kleist's in der Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung, Nr. 37 u. 38. Jahrg. 1880. K. Siegen's H. v. K. u. seine Familie in d. Gegenwart v. 13. Mai 1882. Mein Aufsatz über den Prinzen von Homburg in Rötscher's Jahrbüchern für dramatische Kunst und Litteratur, Bd. II und die bereits näher besprochenen jüngeren Arbeiten von Lindau. Zolling und Biedermann.
-
Autor/in
Felix Bamberg. -
Zitierweise
Bamberg, Felix, "Kleist, Heinrich von" in: Allgemeine Deutsche Biographie 16 (1882), S. 127-150 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118563076.html#adbcontent